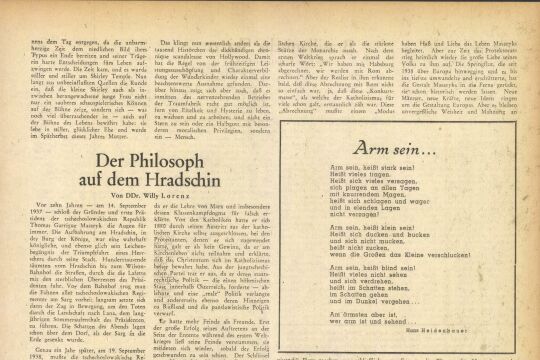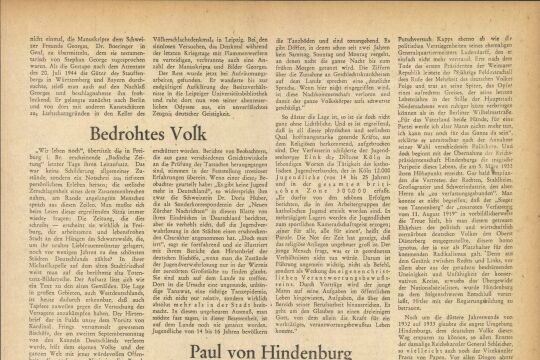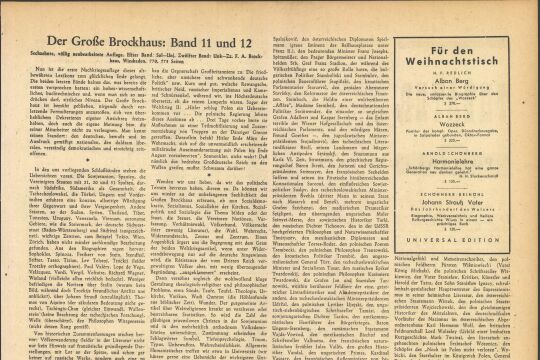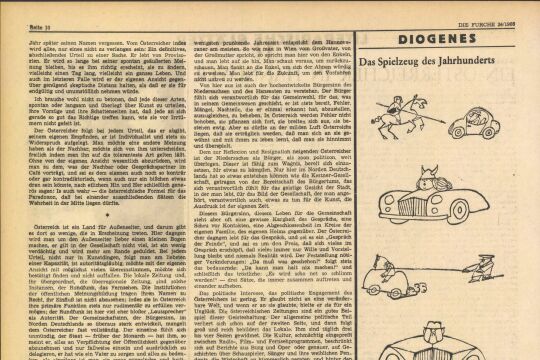Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hindenburg: Legende und Wirklichkeit
Am 23. Juni 1919 begibt sich der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, zu seinem Telephonapparat, um sich mit Generalfeldmarschall Hindenburg in Kolberg verbinden zu lassen. In hastigen Worten schilderte Ebert die in Weimar herrschende Verwirrung und erbat den Rat des Feldmarschalls, wohl die tiefste Verbeugung eines revolutionären Politikers vor einem Repräsentanten des wilhelminischen Deutschland, dessen Existenz der einfache Sattlergehilfe auf dem Amtssitz des ersten Reichspräsidenten durch den Tod zweier seiner Söhne im Felde verteidigt hatte. „Doch in dieser Stunde höchster Not, in der alles aus den Fugen geraten ist, zeigt Hindenburg eine unverständliche Haltung — die die Geschichte einmal streng beurteilen wird. Der Sieger von Tannenberg entzieht sich der Verantwortung. Er geht aus dem Zimmer und läßt Groener allein. Mag er die Antwort finden. Stockend, aber mit fester Stimme, gleichsam auf jedes Wort sich stützend, entschließt sich Groener endlich zu dieser Erklärung: ,Nicht als Generalquartiermeister, sondern als Deutscher, der die Gesamtlage klar übersieht, halte ich mich auch in dieser Stunde für verpflichtet, Ihnen, Herr Reichspräsident, folgenden Rat zu geben: Die Wiederaufnahme des Kampfes ist nach, vorübergehenden Erfolgen im Osten im Enderfolg aussichtslos; Der Friede muß daher unter dęn vom Feinde gestellten Bedingungen abgeschlossen werden. Ich halte es für notwendig, daß der Reichswehrminister Noske die Führung des Volkes und die Verantwortung für den Friedensschluß übernimmt. Nur wenn Noske' in einem öffentlichen Aufruf die Notwendigkeit des Friedensabschlusses darlegt und von jedem Offizier und Soldaten verlangt, daß er auch bei Unterzeichnung des Friedens im Interesse der Rettung unseres Vaterlandes auf seinem Posten bleibt und seine Pflicht und Schuldigkeit
Kroaten — in gleicher Weise vom Maturanten wie vom Stallburschen — nur deutsche Antworten verlangten, Zusammenstöße geradezu provozierten, wobei natürlich der kroatische Rekrut oft laute Vorwürfe wegen seiner mangelnden Sprachbeherrschung einstecken mußte, merkte ich eine deutliche Aufgeschlossenheit der Kroaten, sobald sie spürten, daß auch ich mich um ihre Sprache bemühte. Und nun kratzten auch sie bereitwillig ihre deutschen Sprachbrocken zusammen, um eine Verständigung zu ermöglichen. Der persönliche Kontakt wurde enger. Schreiszenen, wie sie vom Militär her jedem in schlechtester Erinnerung sind und wie sie bisher von engstirnigen deutschen Unteroffizieren wegen der fehlenden Ver- stäridigungsmöglichkeit noch häufiger inszeniert wurden, kamen überhaupt nicht vor. Die starrsinnige Ablehnung der fremden Sprache vertiefte natürlich die Gegensätze und förderte die unheilvolle Abneigung. Es fehlte mit einem Wort den verantwortlichen Stellen jedes Fingerspitzengefühl für die Bedeutung des Sprachenproblems.
gegenüber dem Vaterlande tut, besteht Aussicht, daß das, Militär sich hinter ihn stellt und damit jede neue Umsturzbewegung im Inneren sowie nutzlose Kämpfe nach außen im Osten verhindert werden.“
Die Unterredung ist beendet. Einige Augenblicke später tritt Hindenburg wieder in das Büro Groeners ein und findet ihn in tiefster Niedergeschlagenheit vor.
,Sie haben eine schwere .Last auf sich genommen“, sagt er lakonisch zu ihm. Ob er sich wohl darüber klar ist, daß er selbst sie hätte tragen müssen?“
So berichtet der Franzose Benoit Mechin in seiner „Geschichte des deutschen Heeres“, die 1943 in Berlin erschien und keineswegs korrigiert wurde. — Ergänzend zu dieser Tatsache hat sich auch der jüngste Biograph Hindenburgs, Walter Görlitz („Hindenburg, ein Lebensbild“, Athenäum-Verlag, Bonn 1953, 438 Seiten) zu diesem Vorgang geäußert und klar dargelegt, daß Groener wiederum nach seinen eigenen Aufzeichnungen das „schwarze Schaf“ im Interesse der Nation sein mußte, um Hindenburgs Ansehen — oder, besser gesagt, die Hindenburg-Legende — zu retten. Richtig bemerkt dazu der Historiker Erich Eyck: „Wenn er (Groener) freilich geglaubt hat, er habe sich dadurch Anspruch auf seine Dankbarkeit erworben, so hat er sich darin ebenso getäuscht wie andere, die an die vielgerühmte Treue Hindenburgs geglaubt haben.“
Dieser Vorgang, der erst durch die jüngsten historischen Forschungen erschlossen werden konnte, stößt unmittelbar in den „Komplex Hindenburg“ als historisches Phänomen der jüngsten deutschen Geschichte vor. War der Feldmarschall, den man den „getreuen Ekkehard“ der Zeit nach 1918 zu verherrlichen versuchte, eine überragende historische Persönlichkeit oder nicht doch, wie dies seine Gegner gerne ausdrückten, „ein Koloß auf tönernen Füßen“, der sich jeweils nach der Opportunität der politischen Entwicklungen zu halten versuchte? Der hervorragende sozialdemokratische Parteimann Karl Severing hat in seinen Erinnerungen Hindenburg so charakterisiert: „Die Treue ist das Mark der Ehre, sei ein Spruch gewesen, den er als eine Art von Wahlspruch verkündet habe. Jedoch bei vielen Gelegenheiten sei er von diesem Wahlspruch abgegangen. 1918 ebenso wie 1932 und in den Schicksalsjahren 1933 bis 1934.“ Somit wird das Thema Hindenburg durch die neuesten Veröffentlichungen sachlich zur Debatte gestellt. Wer war der Mann, der einstmals in einer hemmungslosen Propaganda „Retter des deutschen Ostens“ durch den Sieg von Tannenberg, später Inhaber der tatsächlich höchsten militärischen und politischen Gewalt als Chef des Generalstabes und seit 1925 als Reichspräsident die Geschichte entscheidend beeinflußte, in Wirklichkeit? . ..
Weltgeschichtlich betrachtet, wurde der Name Hindenburg durch die Schlacht von Tannenberg am 28. August 1914 bekannt, als der aus der Pensionierung in Hannover reaktivierte General gemeinsam mit seinem Generalstabschef Ludendorff den Einbruch der Russen nach Ostpreußen an einer historischen Stätte, wie die Geschichtslegende dies geschickt formulierte, aufhielt. Aber Ludendorff, der den Ruhm dieser Schlacht ziemlich berechtigt für sich in Anspruch nahm, wollte sie ursprünglich nach dem Ort Frögenau benennen; die offiziellen Verlautbarungen des deutschen Telegraphenbüros sprachen von der Gegend von Gildenburg und Ortelsburg, bis erst Hindenburg durch ein Telegramm an Kaiser Wilhelm II. den Namen der Schlacht von Tannenberg autorisierte, um die Niederlage von 1410 gegenüber den Polen „gründlichst auszuwetzen“ Um diese Schlacht hat i sich eine Fülle von Mythen gebildet, deren letzte Folge die hölzernen Hindenburg-Statuen des Siegers von Tannenberg waren, dem man als Chef der deutschen Obersten Heeresleitung in der Endphase des ersten Weltkrieges unbeschränktes Vertrauen auf den Endsieg entgegenbrachte. Der Oberquartiermeister General von Eisenhart-Rothe meinte später, man könne ein ganzes Zimmer mit Generälen füllen, die bei Tannenberg gesiegt haben wollten. Aber immerhin blieb der Beginn der Hindenburg-Legende bei Lebzeiten des späteren Marschalls sehr problematisch, um so mehr, als Ludendorff nach 1919, „als sich die Wege trennten“, in unzähligen Ehrenverfahren und Pressepolemiken für sich den Löwenanteil des historischen Entschlusses in Anspruch nahm.
Hinter der Maske des Marschalls und letzten Repräsentanten der preußisch-deutschen Wehrmacht stand ein wacher politischer Sinn für die Gegebenheiten der Situation des Tages. Schon bei seiner Einvernahme vor den Abgeordneten der Nationalversammlung am 20. August 1919 sprach der Verabschiedete vor einem Forum, das immerhin auch im Chaos der damaligen Situation international Gewicht haben mußte, das Wort von der „Dolchstoßlegende.“ Kaum ein Teilnehmer dieser historischen Sitzung vermochte zu ermessen, wie sehr diese bewußte Geschichtsklitterung dereinst eine verhängnisvolle Nachwirkung haben sollte. Als der letzte Chef des Generalstabs im Jahre 1925 die Würde eines deutschen Reichspräsidenten errang, gab es bedenkliche Stimmen in Amerika und den westlichen Staaten, aber auch in Deutschland selbst. Die Spitze der Reichswehr unter General Seeckt, der selbst die Würde des Reichsoberhauptes erstrebt hatte, sah nicht ganz zu Unrecht in Hindenburg eine neue, höchst unsichere Kraft im Getriebe der Weimarer Republik emporwachsen. Das erste Opfer wurde Seeckt selbst, der über die Nichtigkeit eines Fürstenbesuches bei den Reichswehrmanövern stolperte und den der „alte Herr“ kühl fallen ließ, um in immer stärkerem Maße zunächst auf dem Feld der Wehrpolitik, aber auch der Innenpolitik die Prärogative eines Staatsoberhauptes wahrzunehmen. Schon Seeckts Sturz hätte für manche Politiker alarmierend wirken müssen, denn keiner hatte selbstbewußter durch den Ausspruch „Die Reichswehr steht hinter mir!“ den Parteiführern getrotzt.
So verbanden sich Außen- und Innenpolitik immer mehr mit der Person des Marschalls und Präsidenten, den die einen als Idol für den abwesenden Monarchen und die anderen als den Repräsentanten der ehrenhaften, guten alten Zeit zu betrachten versuchten.
Die Frage der Vertrauensmänner des Reichspräsidenten wurde in den nächsten Jahren zur Kernfrage der deutschen Innen- und Außenpolitik. Groener, den er persönlich schätzte, erhielt in Schleicher, seinem „Kardinal in politicis“, einen beträchtlichen Konkurrenten, wobei der listenreiche Staatssekretär der Präsidialkanzlei, Dr. Meißner, den Ring der beeinflussenden Persönlichkeiten geschickt schloß. Nicht unerwähnt sei die bisher noch nie klargestellte Rolle des Sohnes Oskar von Hindenburg, der in den zuletzt veröffentlichten Dokumenten, vor allem über den Sturz Brünings (Aufzeichnungen des Grafen Kuno Westarp) eine bisher wenig beachtete Rolle spielt. Diese Gruppe von Politikern trägt die Verantwortung für die Beseitigung eines ehrenhaften, vielleicht allzu nüchternen Politikers wie Heinrich Brüning, der, wie sich aus den Akten ergibt, die das Institut für Zeitgeschichte in München veröffentlichte, außenpolitisch nur 100 Meter vor dem Ziel ermattend resignieren mußte. Der zeitweilige Triumph Papens und des in die Scheinwerfer der Oeffentlichkeit tretenden „jüngeren Freundes“ Schleicher — den Hindenburg gerne an
Diese Dinge fielen mir beim Lesen des ausgezeichneten Artikels wieder ein. Es dürfte gar keine Frage sein, welcher Teil in gemischtsprachigen Gebieten die zweite Sprache zu lernen hat. Aus Gründen der Gerechtigkeit, Vernunft und Höflichkeit selbstverständlich beide.
Dr. Alois Berndorfer, Innsbruck, Schöpfstraße 35/1
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!