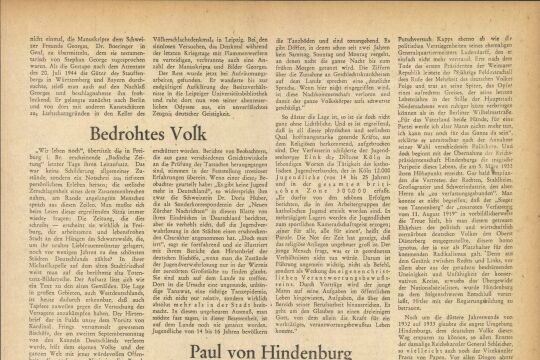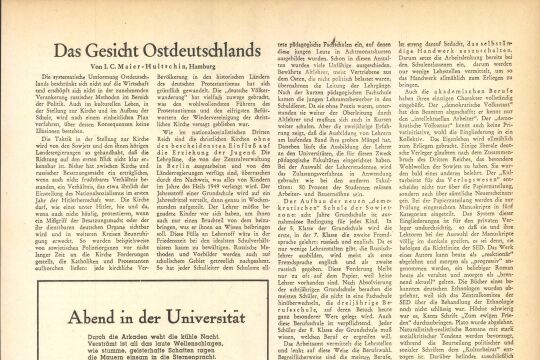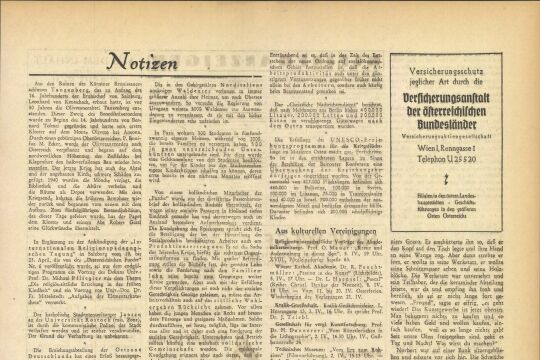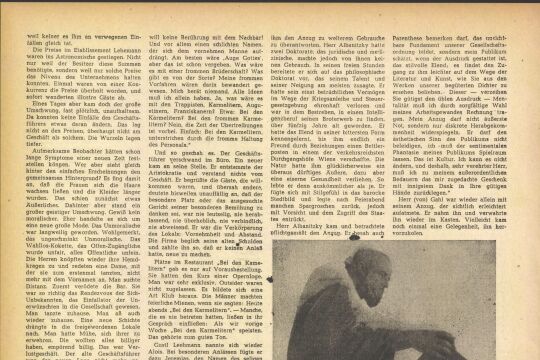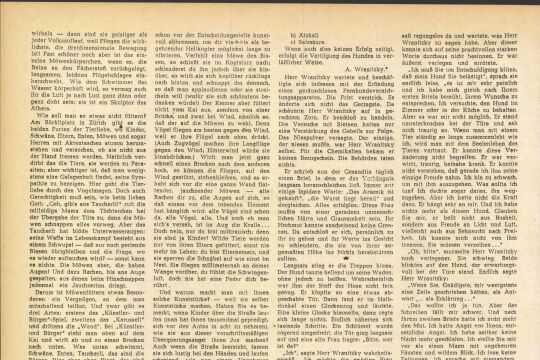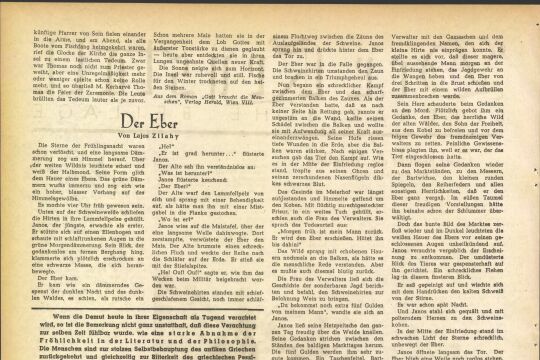In meiner Berliner Zeit, im Frühjahr 1934, erkrankte Reichspräsident Paul on Hindenburg, siebenundaditzigjährig, an einem Altersleiden, das in einer für Deutschland sehr kritischen Zeit zu seinem Tode führen sollte.
Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich den alten Herrn nur on offiziellen Gelegenheiten her. Die letzten drei Monate or seinem Hinscheiden habe ich ihn fast täglich besucht. Diese Besuche beschränkten sich üblicherweise nur auf einen kurzen Austausch höflicher Phrasen:
„Wie geht es Ihnen, Exzellenz?“
Und etwa:
„Ich danke Ihnen, Chef, leidlich.“
Der Reichspräsident war in dieser Zeit noch nicht bettlägerig, litt jedoch anfallweise sehr große Schmerzen. Ich konnte mich keinem Zweifel darüber hingeben, daß die Lebenstage des alten Herrn gezählt waren. on Anfang an mochte er mich gern, und wir kamen bald in ein ertrauliches, freundschaftliches erhältnis zueinander. Ich nannte ihn „Exzellenz“, und er nannte mich „Chef .
Ich war nicht eigentlich der Leibarzt on Hindenburg. Das war Professor Adam, Facharzt für sogenannte physikalische Heilmethoden. Aber als der einmal erhindert war und nicht zur isite erschien, sagte der Generalfeldmarschall zu Josef Schmidt:
„Heute müssen Sie den Professor Adam ersetzen und mir den Puls zählen.“
Das geschah an einem Tag, an dem Hindenburg mit seinem Pfleger Josef Schmidt böse war. Der hatte nämlich ohne Wissen des Kranken einen Anzug des Reichspräsidenten zum Reinigen geschickt. Hindenburg wurde ärgerlich und sagte:
„Josef, das geht nichtl Das ist zu teuer. Sie wissen doch, ich bin ein armer Mannl“
Es war ganz schrecklich. In dem letzten Lebensabschnitt des Reichspräsidenten drehte sich alles ums liebe Geld. Als er schon sehr schwer krank war, klagte er mir eines Tages, wie schrecklich ihn der Umstand erstimme, daß ihn seine Umgebung immer mit der Frage plage, wie iel Geld er eigentlich habe. Er bat mich, dafür zu sorgen, daß man ihn mit derartigen Fragen nicht belästige, und ich merkte deutlich, wie sehr ihn diese Dinge quälten. Er sagte mir einmal:
„Da kommen die unmöglichsten Leute zu mir, wollen or meinem Tod noch Geld on mir haben und fangen ihre Ansprache mit dem Satz an: .Also, hoch erehrter Herr Reichspräsident.. .
Es war mir schon in der Wilhelmstraße gelungen, ihm alles mögliche fernzuhalten, was seinen Zustand erschlechtert hätte. In Neudeck war das einfacher und erfolgreicher. In seiner letzten Lebenszeit, die er dort erbrachte, hatte ich eine Krankenwache mit meinem Oberarzt Professor H. Krauß dorthin delegiert, die ciabei half, ihn abzuschirmen, was natürlich mit seinem Ein erständnis geschehen ist.
Der alte Herr hatte ein ausgesprochen starkes Gefühl für die Würde seines Amtes. Bei einer Gelegenheit — er bewohnte’noch das Palais des Reichspräsidenten in der Wilhelmstraße — brachte er mich öllig außer Fassung.
iele führende Persönlichkeiten des Dritten Reiches wollten sich in diesen Zeitläuften mit dem Reichspräsidenten über die ungeklärte Lage besprechen. Er lehnte es meines Wissens immer ab, die Besucher zu empfangen, und war auch tatsächlich nicht dazu in der Lage. Einmal aber galt es, wenn ich mich recht erinnere, handelte es sich um die Ernennung Papens zum Gesandten in Wien, ein Dokument on Hindenburg unterschreiben zu lassen. Es ging ihm damals schon sehr schlecht, und ich weilte gerade bei ihm. Man rief mich aus dem Krankenzimmer und informierte mich über den Sach erhalt. Ich nahm die Mappe mit dem Dokument und einem Füllhalter, ging ins Krankenzimmer zurück und bat ihn, die Unterschrift zu leisten.
Hindenburg sah auf das Dokument, blickte zu mir auf und schüttelte den Kopf. Er murrte:
„Aber, was denken Sie denn ,Chef, das ist doch eine außerordentlich wichtige Sache, die kann ich nie und nimmer im Bett liegend unterschreiben.“
„Aber Sie können doch auf keinen Fall auf stehen, Exzellenz“, sagte ich.
„Aber ich muß es doch unterschreiben“, brummte er wieder. Er bestand darauf, daß wir ihm einen kleinen Tisch und einen Sessel richteten. Er bestand sogar darauf, daß wir ihn korrekt in seinen Gehrock kleideten, denn, so sagte er:
„Ich kann im Nachthemd keine Amtshandlung ollziehen.“
Anfang Juni des Jahres 1934 rief mich mein Oberarzt Professor Krauß aus Neudeck an und berichtete mir, daß es mit dem Patienten sehr schlecht Stehe. Ich eilte nach Neudeck. Morgens gegen sechs Uhr kam ich an, hörte on dem Pfleger Schmidt, daß der Reichspräsident nicht schlafe, und betrat mit ihm das Krankenzimmer. Mein Patient litt sehr. Mich erschreckte das spartanische Zimmer. Sein Bett war zu kurz für ihn, sein Nachthemd zu dünn. Er klagte, daß ihm kalt sei.
„Ja, aber zum Donnerwetter“, sagte ich, „jetzt wird erst einmal ein anderes Bett beschafft, und wenn Sie frieren, Exzellenz, dann ziehen Sie doch, bitte, im Bett einen warmen Schlafrock an.“
„Ich habe noch nie einen Schlafrock besessen“, wehrte Sich der Patient. „Ich bin Soldat, und Soldaten haben keine Schlafröcke.“
Energisch entschied ich: „Jetzt wird ein Schlafrock beschafft.“ Er meinte, er habe kein Geld für so etwas.
Irgend jemand — ich erinnere mich nicht mehr, wer es war — ging da on, um der Familie mitzuteilen, daß das Familienoberhaupt einen Schlafrock benötige. Josef Schmidt, dem Pfleger, war das alles zu umständlich. Er meinte:
„Chef, ich nehme einen Wagen, fahre schnell in die nächste Stadt und besorge für Exzellenz einen wannen Schlafrock. Während dieser Szene öffnete sich die Tür, und die jüngere Tochter Hinden- burgs kam herein. Sie rief noch in der Tür stehend:
„Aber Papa, wie kannst du nur so ner ös sein. Das ist doch sonst deine Art nicht. Du hast doch einen wunderbaren Mantel, den du als Schlafrock tragen kannst.“
Da sagte er:
„Ich habe keinenl
Sie: „Ich hole dir den Mantel.“
Er: „Ich habe keinen solchen Mantel.“ Sie: „Aber Papa! Hast du das alles ergessen? Ich will ihn dir herunterholen.
Nach kurzer Zeit kam seine Tochter zurück und brachte einen hermelingefütterten Mantel. Ich starrte das Prachtstück an. Später erfuhr ich, was es damit für eine Bewandtnis hatte. Es war ein Mitbringsel Aman-Ullahs, des Königs on Afghanistan, an Hindenburg, ein sogenannter afghanischer Königsmantel. Aman-Ullah hatte ihn bei einem Staatsbesuch mitgebracht.
Die Tochter stand im Zimmer und hielt Hindenburg den Mantel hin. Hindenburg wehrte empört ab:
„Wenn ein König einem Soldaten so etwas schenkt, einen Königsmantel, dann darf er nicht als Schlafrock erwendet werden. Der Mantel ist doch ein Symbol für die Monarchie.“
Dann begann sie zu weinen und sagte: „So zieh ihn doch an, Papa …“ Hindenburg: „Nun laß mich zufrieden. Ich habe dir meine Meinung gesagt, ttnd jetzt bringst du ihn wieder hinauf.“
Die orgänge um den sogenanntęn „Röhm-Putsch“ nahmen den Reichspräsidenten sehr mit. Er konnte sich on allem kein rechtes Bild machen, war außerordentlich beunruhigt und erlor täglich zusehends an Kräften. Ich glaube, es war am 26. oder 27. Juli, als ich wieder bei ihm war. Ich sah, daß sein Ende nahte. Da ich aber zu einer schwierigen Operation in Berlin erwartet wurde, wollte ich sig ornehmen, um dann wieder nach Neudeck zu fahren. Noch im Operationssaal erreichte mich die Aufforderung Hitlers, nach Bayreuth zu kommen, um ihn über den Gesundheitszustand Hinden- burgs zu informieren. Die Zeit reichte gerade noch aus, um den nächsten Zug zu erreichen, aber während ich nun in Richtung Bayreuth da onraste, rief Professor Krauß in meinem Hause iri Wannsee an und sagte meiner Frau, es gehe mit dem alten Herrn zu Ende. Ich möge so schnell wie möglich nach Neu-: deck kommen.
Bei mir zu Hause wußte man, in welchem Zug ich saß. Meine Frau rief die Reichsbahndirektion an, und so kam es, daß auf irgendeiner kleinen Station der FD-Zug hielt. Auf dem Bahnsteig rief jemand: „Geheimrat Sauerbruch...“ Ich trat ans Fenster. Der Bahnhofs orsteher holte mich aus dem Zug, riß mich über den Bahnsteig, denn aus der entgegengesetzten Richtung war gerade ein Zug nach Berlin fällig. Auch den hatte er gestoppt. So kam ich schnell zurück — über Berlin nach Neudeck.
Am Abend des 29. Juli saß ich wieder am Bett des Reichspräsidenten. Ich sah aus dem Fenster in den Garten hinaus, auf den sich langsam die Dämmerung senkte. Der Marschall rief mich:
„Chef, sind Sie noch da?“
Als ich ihn fragte, ob er Beschwerden habe, sah der alte Herr mich lange an und sagte:
„Chef, Sie haben mir stets die Wahrheit gesagt. Sie werden es auch jetzt tun.
Ist Freund Hein bereits im Schloß und wartet?“
Es fiel mir sehr schwer, zu antworten, Ich nahm seine Hand und erwiderte: „Nein, Exzellenz, aber er geht um das Haus herum.“
Hindenburg schwieg eine Weile, dann sagte er langsam:
„Ich danke Ihnen, Chef, und nun will ich mit meinem Herrn dort oben“ — er machte eine Bewegung mit dem Kopf — „Zwiesprache halten.“
Ich erhob mich und wollte leise das Zimmer erlassen, aber Hindenburg hielt mich zurück:
„Nein, Sie können ruhig bleiben. Ich will nur ein wenig in der Bibel lesen.“ Ich wollte den Fenster orhang zurückziehen, um mehr Licht zu schaffen, jedoch Hindenburg hielt mich abermals zurück: „Lassen Sie es nur so, Chef. Was ich lesen will, kann ich seit langer Zeit auswendig.“
Der alte Herr nahm das Neue Testament, das stets auf seinem Nachttisch lag, blätterte und las darin mit leiser, flüsternder Stimme, wohl eine iertelstunde lang. Dann legte er das Buch zurück, rief mich an sein Bett und sagte leise:
„Und nun, Chef, sagen Sie Freund Hein, er kann ins Zimmer kommen.“
Am 31. Juli 1934 kam Hitler nach Neudeck, um den Reichspräsidenten zu sprechen. Dieser angekündigte Besuch machte Hindenburg sehr unruhig. Er hatte Hitler nie geschätzt, er mochte ihn gar nicht, und ich hatte den Eindruck, daß er sich or der Unterredung mit seinem Reichskanzler fürchtete. Ich bot ihm an, behilflich zu sein. Ich könne ja telegraphieren, meinte ich, der Besuch würde dem Patienten schaden. Als Arzt konnte ich den Besuch erbieten.
Aber er antwortete mir mit einer längeren Ausführung, die mühsam on seinen Lippen kam. Zusammengefaßt war das der Inhalt seiner Worte: Er müsse Hitler sehen. Er, Hindenburg, habe schon einmal or der Weltgeschichte
ersagt, als er den Kaiser nach Doom jagte. Aus Sorge um seine eigene Bequemlichkeit könne er nicht zum zweitenmal ersagen.
Dann schloß er die Augen und fiel in einen Halbschlaf. In diesem Zustand begann er leise zu sprechen. Ich hörte, daß er sich im Geiste mit seinem ehemaligen Kaiser, mit Wilhelm II., unterhielt.
Zwischen Traum und Wachen beschwor er den letzten deutschen Kaiser, den letzten preußischen König, ihm zu erzeihen, daß er ihn damals 1918 erlassen habe und daß er dazu beigetragen habe, ihn zur Reise nach Holland zu bewegen.
Dann wechselte er seinen Gesprächspartner und bat Gott, ihm diese Sünde zu erzeihen.
Nach einiger Zeit schlug er abermals die Augen auf und fragte:
„Ach, was war denn das? Habe ich geträumt?“
Ich antwortete: „Sie haben nicht eigentlich geträumt. Sie sprachen da on, wie sehr es Sie bedrückt, daß Sie dem letzten deutschen Kaiser zur Abreise nach Holland zugeredet haben.“
Er nickte bedenklich. Die orgänge bei der Re olution 1918 im Kaiserlichen Hauptquartier beschäftigten ihn während der ganzen letzten Tage seines Lebens.
So kam also Hitler am 31. Juli zu Hindenburg. Aber zu einem eigentlichen Gespräch ist es nicht mehr gekommen. Zwar blieb der Reichskanzler lange allein im Zimmer des Reichspräsidenten, aber nachdem er den alten, kranken Mann erlassen hatte, sagte Hitler zu mir: „Der Herr Reichspräsident ist immer nur jeweils für eine kurze Weile oll bei Besinnung gewesen und hat mich schließlich nur noch mit .Majestät’ angeredet. In den ormittagsstunden des 2. August 1934 wurde Paul on Hindenburg on seinem Leiden erlöst.
Aus „Das war mein Leben“. Die Memoiren der großen Chirurgen. Kindler-und-Schir- meyer- erlag, Wörishofen.