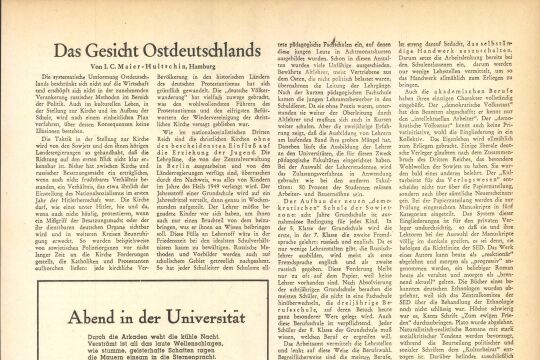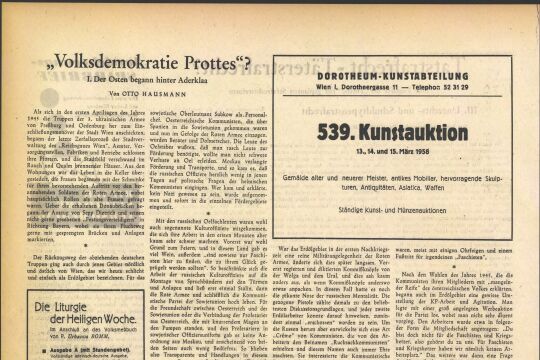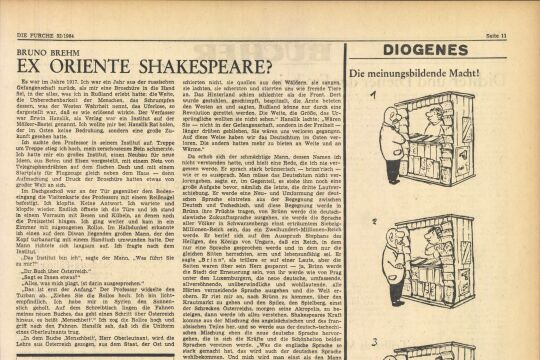Erinnerung an das Kriegsende und die Befreiung vom Nationalsozialismus in Galizien.
Irgendwann im Herbst 1945, vielleicht auch ein Jahr später - aber was soll's, ein Datum hat für die Gefühle wenig Bedeutung - also irgendwann führten die Sowjets in den Kinos der Städte am San und am Pruth, am Czeremosz und am Bug, vielleicht sogar in den Kinos der an der Weichsel gelegenen Orte, den Film "Um sechs Uhr abends nach dem Krieg" vor, der elektrisierte. Dafür waren nicht die üblichen Sujets wie Heldentum, Landesverrat, Treue zum Kommunismus oder russische Kriegslist verantwortlich, sondern zwei filmische Einstellungen. Stalin von der Kremlmauer winkend, so nahe, dass man meinen hätte können, er würde uns, den Menschen im Kino, zuwinken. Und dann die von dramatischem Trommelwirbel begleitete Einstellung, die zeigte, wie Rotarmisten von ihnen erbeutete deutsche Fahnen auf einen Haufen warfen. Dabei hatte man den Eindruck, sie würden ihre Beute dem Generalissimus zu Füßen legen: Wehrmachtsfahnen, ss-Standarten, Flaggen der deutschen Luftwaffe und der Seeflotte, nsdap-Banner und weiß Gott was für Fahnen noch, allesamt die hehren Symbole Hitlers. Gut 300 Fahnen lagen bereits da an der Kremlmauer, als ein junger sowjetischer Gardist mit einem Hammer ein riesiges Hakenkreuz zerschlug, die Beute aus der Reichskanzlei in Berlin.
Wir alle, die wir eng aneinander gedrängt im Kino mit fiebrigen Augen auf die Leinwand starrten, konnten es kaum fassen. Die Geschichte hatte mit uns offensichtlich Gnade gehabt. Noch gestern hatte man uns Slawen, Juden und Zigeuner als Ungeziefer betrachtet, Vernichtung und Tod zugedacht. Und jetzt dieser Triumph, diese unglaubliche Wende des Schicksals, dieses unbeirrbare Urteil der Geschichte! Wir standen Arm in Arm und schrien wie besessen: "Stalin! Stalin! Stalin!" Er, der jetzt auf der Kremlmauer stand, hatte uns verheißen gehabt: "Auch auf Euren Straßen wird man ein Fest der Befreiung feiern!" Siehe da: tatsächlich! Wir lebten und hatten uns nicht in Rauch über den unendlichen Ebenen Polens aufgelöst.
"Stalin! Stalin! Stalin!"
Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Wir haben nicht gerufen "Es lebe die Rote Armee!", auch nicht "Es lebe General Zukov!" oder "Hoch General Malinowski!" oder "Vivat Konjew!" Wir brüllten voller Inbrunst "Stalin! Stalin! Stalin!" Wir waren von der neuen Freiheit berauscht, und in diesen Stunden ist ihm vieles nachgesehen worden, was man hier und da, stets nur flüsternd, murmelte: seine Aussiedlungen nach Sibirien, seine Rachezüge, die Erschießungen, sein kaltblütiges Ränkespiel, selbst das Ribbentrop-Molotow-Abkommen.
Das war die Stunde seines - unseres - Triumphes. Gestern noch hatte man uns Ungeziefer genannt und wollte uns ausrotten, heute aber lag der Tyrann vor uns im Staub, hier im Kino, direkt vor uns: Immer wieder zeigte die Kamera die entehrten Fahnen der Hitlereinheiten.
Befreiung in Galizien ...
Mitten in diesem Gefühlstaumel der Befreiung tauchte in mir die Erinnerung an ein ähnliches Fahnenmeer auf, das ich, ein verwaister Vierzehnjähriger, vor ein paar Monaten rund um das Theater in Lemberg gesehen hatte: Das Theater war beflaggt, mehrere Blasorchester waren auf dem Platz davor postiert, wohin man auch blickte, überall wehten Fahnen. Da wurde ich, der mit offenem Mund die Szenerie bestaunte, unversehens gepackt und abtransportiert. Ich, der wehrlose Junge, hätte ja womöglich ein Attentat auf Reichsmarschall Hermann Göring verüben können, der an diesem Tag das Theater besuchen sollte. Aus welchem Grund sonst hätte ich mich ausgerechnet an diesem Tag vor dem Theater herumtreiben sollen?
Viele, viele Jahre später habe ich in Wien einen lieben älteren Österreicher kennen gelernt, der als Lemberger Theaterdirektor für die damalige Inszenierung verantwortlich zeichnete. Er gestand mir, dass dieser Tag, an dem ich im Gefängnis schmachten musste, für ihn ein ganz besonderer Tag gewesen sei. Wir hatten beide dasselbe erlebt, aber in einer völlig unterschiedlichen Sichtweise. Jeder hat seinen eigenen Blickwinkel, auch der Gestapomann, der meinen Vater auf die Knie gezwungen und ihn genötigt hatte, den Boden abzuschlecken, auf den er das von meinem Vater im Ersten Weltkrieg durch Tapferkeit erworbene Eiserne Kreuz geworfen hatte.
Wozu lange herumreden: Das Kriegsende war für uns in Ostpolen, dem ehemaligen Galizien, das heute in der Ukraine liegt, eine Auferstehung, das Unmögliche war Wirklichkeit geworden: Wir hatten Hitler, den übermächtigen Herren und das selbsternannte größte Genie aller Zeiten, überlebt. Wir gingen vom Kino ohne einander zu kennen Arm in Arm auf den Hetmanenwall. Ich dachte mir: Die himmlischen Heerscharen haben sich gut um mich gekümmert. Sie haben mich lebendig durchgebracht und jetzt reiben sie sich zufrieden die Hände und schauen uns zu, wie wir auf dem Asphalt des Hetmanenwalls tanzen, trunken sind vom Gedanken, den Teufel vertrieben zu haben, und unsere Freiheit genießen. Ich war gerade fünfzehn Jahre alt. Der Kontrast zwischen den triumphierenden Menschen und den noch immer brennenden Ruinen, die Hitlers Gefolgsleute zurückgelassen hatten, brachte mich plötzlich um meinen Atem. Ich musste daran denken, dass unter diesen Ruinen vielleicht meine Lieben liegen und dass mich diese Freiheit, von der ich so berauscht war, vielleicht überfordern würde. Wie sollte ich mich in dieser Ruinenwelt durchschlagen?
... und in Wien?
Und in eben diesem Moment kam mir der Gedanke, irgendwann einmal, wenn es möglich sein sollte, nach Wien zu gehen, in die Traumstadt meines Vaters, in die Stadt seiner Jugendjahre und seiner ersten Liebe. Aber mein Vater war tot und Wien weit weg. Umso fester war ich überzeugt, nach Wien gehen zu müssen. Nichts als hin zu ziehen! Ich war es meinem Vater schuldig.
Bis heute weiß ich nicht, was ich ihm, würde er mich hören können, aus diesem Wien nach dem 9. Mai 1945 zu berichten hätte. Ehrlich gestanden weiß ich nämlich nicht - und das ist auch heute der Fall - ob die Wienerinnen und Wiener das Kriegsende als Sieg und Befreiung oder als eine Niederlage erlebt haben.
Der Autor ist freier Schriftsteller und lebt seit 1957 in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!