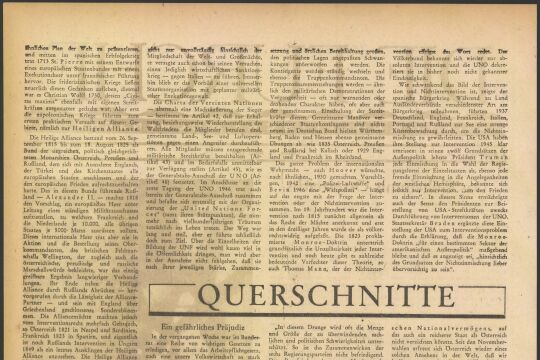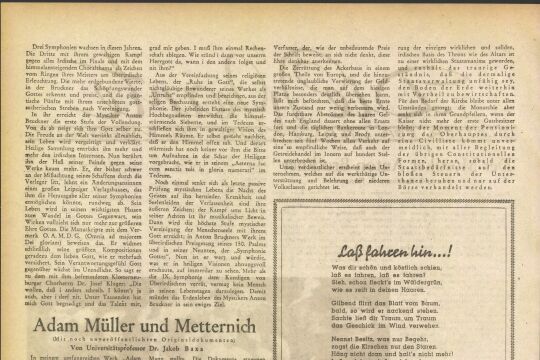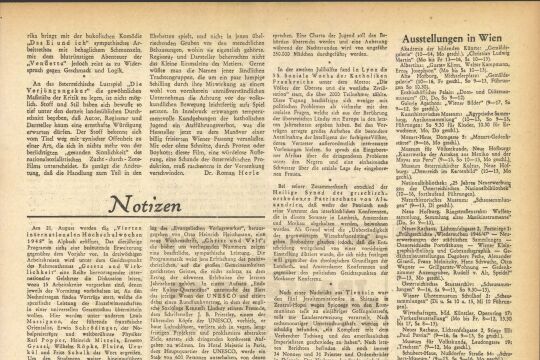Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der befoM ene Roman
Wer die Fülle des Unwahrscheinlichen, das in den letzten Jahrzehnten Ereignis wurde, rückschauend überblickt, der muß schon ein hartgesottener, besser ein stumpfer Fatalist sein, um nicht erschauernd zu erstaunen. Sind die Grenzen des denkbar Möglichen auf vielen Gebieten des politischen, sozialen und materiellen Lebens nicht überschritten oder gespxengt worden wie nie vorher?
Da kämpft ein altes Reich vier Jahre lang um; seine Selbstbehauptung, wird besiegt und zerfällt, obwohl die Großen der Welt uacb seinem Verfall diesen bedauern und gerne ungeschehen gemacht hätten, als es dazu längst zu spät geworden war. — Da wählte anderthalb Jahrzehnte später ein großes Volk in freier Entschließung einen verbrecherischen Irren zum Führer. Folgt seinen Weisungen in Not und Tod und erduldet ihn zwölf Jahre lang in unwahrscheinlicher Einsichtslosigkeit trotz böser Erfahrungen mit ihm und seinen „gewaltigen Gesellen". Erträgt ihn bis zur zwangsweisen Rückführung zu menschlicher Vernunft. — Auch in der Problematik des Heute gibt es reichlich llnwahrscheinlichkeiten, die die
Grenzen des vernunftgemäß Möglichen gefährlich zu verschieben drohen. Von ihnen kann zunächst keine Rede sein. Sie bleiben späteren Be- urteilern Vorbehalten, die einst hoffentlich werden beweisen können, warum das Unwahrscheinlichste, der dritte Weltkrieg, dennoch nicht Ereignis wurde.
Heute mag die höchst unwahrscheinlich anmutende Tatsache erzählt werden, daß im letzten Friedensjahr der österreichisch-ungarischen Monarchie ein Roman dazu ausersehen wurde, die moralischen Widerstandskräfte der Armee für den Ernstfall zu stählen. Ein offiziell befohlener Roman.
Es gab damals in der Präsidialkanzlei des Kriegsministeriums ein literarisches Büro. In dieses waren einige als Schriftsteller nicht unbekannte Berufsoffiziere kommandiert. Sie hatten die Presserapporte für den Kaiser und den Thronfolger zusammenzustellen, eine offizielle Wochenschrift, „Die militärische Rundschau", zu redigieren und wurden von Fall zu Fall mit besonderen reservaten Konzepten betraut. So mußte zum Beispiel ein Hauptmann des Bürosein Kriegsmanifest verfassen, als 19X3 der König Nikita von Montenegro das eroberte Skutari nicht räumte und durch ein kurzfristiges Ultimatum dazu gezwungen werden sollte.
Der Präsidialchef hatte die Weisung gegeben: „Kein Pluralis majestaticus! Nicht Wir von Gottes Gnaden, sondern ich alter, friedfertiger Mann muß notgedrungen an das Schwert appellieren. Mit einem Wort: menschlich ergreifend aufzäumen. Das Konzept morgen 8 Uhr vorlegen. Verstanden?!“
Der Hauptmann verstand gehorsamst, braute sich einen starken Mokka, arbeitete die Nacht durch und lieferte die Arbeit wie befohlen. Sie wurde genehmigt und wanderte um 9 Uhr in die Hofburg zum Generaladjutanten des Kaisers. Um 9.30 Uhr aber langte eine Depesche unserer Gesandtschaft aus Cetinje mit der Meldung ein, daß Nikita knapp vor Ablauf des Ultimatums Skutari geräumt habe. Das Kriegsmanifest ging als gegenstandslos ad acta und ein hörbares Aufatmen durch das Reich. Prestige und Friede waren wieder einmal gerettet.
Im Alltag erledigte der Hauptmann dann laufende Angelegenheiten, schwitzte über Presserapporten aus dem Balkan, denn der Thronfolger hatte verfügt, daß ihm alle persönlichen Angriffe der dortigen Blätter — sie waren zahlreich und gehässig — zur Kenntnis zu bringen seien.
Im Frühsommer flattert auf den Redaktionstisch der „Militärsozialen Rundschau“ ein Buch. Da zeigt auf dem schwarzgelben Umschlag einen mächtigen Doppeladler, der ein Spruchband in den Fängen trägt. Darauf der Titel: „Quo vadis Austria?" Das anonym erschienene Erzeugnis eines reichsdeutschen Verlages wird gelesen und festgestellt, daß es sich um eine Art patriotisches Pamphlet handelt. Der Verfasser bemängelt den „vergreisten Friedenskurs", beschwört den Thronfolger, im Namen Großösterreichs endlich aktivistisch zu handeln, statt mit sich handeln zu lassen, und übt hämisch Kritik am Offizierskorps, das in seiner Mehrzahl aus gleichgültigen „Brotdienern" bestehe, deren einziger Ehrgeiz das „Sammeln von Dienstjahren“ für den „wohlverdienten Ruhestand" sei.
Man einigt sich auf Nichtbeachtung des Machwerks in der offiziellen Wochenschrift. Es naht ufcter allerlei unheimlichen Balkankrisen der Herbst 1913. Eines Tages teilt der Herausgeber der „Armeezeitung" dem Kriegsmanifestdichter telephonisch mit, die Militärkanzlei des Thronfolgers habe sich bei ihm nach dem Namen jenes Pseudonymen erkundigt, der seine Artikel mit „spectator castrensis“ zeichnet.
Dem Hauptmann wird übel. Die Mitarbeit an der großösterreichischen Armeczeitung ist allen aktiven Offizieren strenge verboten.
„Haben Sie das Redaktionsgeheimnis gewahrt?" fragt er atemlos.
„Natürlich, aber ich möchte in diesem speziellen Fall mich doch erkundigen, ob ich es nicht preisgeben darf. Die Anfrage ist zweifellos in wohlwollendstem Sinn erfolgt."
„Also dann — wegen meiner. Auf Ihre Verantwortung.“
„Gewiß", beteuert der in der Armee sehr geschätzte Carl M. Danzer.
Es wird Winter. Der Hauptmann exzerpiert, schneidet aus, redigiert. „Spectator castrensis“ schreibt weiter militärpolitische Aufsätze in der Armeezeitung.
Kurz vor Weihnachten läßt ihn der Kriegsminister zu sich rufen. Der Hauptmann erforscht auf dem kurzen Gang zum Allmächtigen sein Gewissen und findet es keineswegs rein. Er hat reichlich Sünden begangen, für, die letzte Nummer der „Muskete“ besonders freche Verse geschmiedet. Und er sieht sich schon strafweise nach Mosti .wielki oder Trebinie oder zu irgendeinem „Verbannungsbataillon“ versetzt.
Mit klopfendem Herzen steht er vor dem martialischen, noch recht jugendlichen Feldzeugmeister von Krobatin.
„Kennen Sie das Buch ,Quo vadis Austria'?“ „Jawohl, Exzellenz."
„Es verbreitet gehässige Meinungen über die moralischen Qualitäten unserer Truppenoffiziere. Dem muß entgegengearbeitet werden, und zwar sofort. Sie werden einen Gegenroman schreiben.“ Dem Hauptmann verschlägt es den Atem. „Einen Gegen ... ?“ stammelt er.
„Wie lange haben Sie Dienst bei der Truppe gemacht?“
„Sechzehn Jahre, Exzellenz, meist an der Peripherie."
„Weiß ich. Da kennen Sie die brave Truppe, und wissen, mit welcher Aufopferung und fanatischer Hingabe die Offiziere aller Chargengrade unter oft schwierigsten Verhältnissen den Allerhöchsten Dienst tun.“
Das konnte der Hauptmann mit gutem Gewissen bejahen.
„Im Gegenroman werden Sie den Truppenoffizier so schildern, wie er wirklich ist, und damit die leider stark gelesene niederträchtige Publikation richtigstellen. In zwei Monaten spätestens will ich Ihr Elaborat fix und fertig sehen.“
Nun aber regt sich im Hauptmann der Schriftsteller. „Exzellenz“, stößt er hervor, „ich ... ich bitte gehorsamst, das ist unmöglich. Ich brauche bei einer so großen Sache, die genau überlegt sein will, sechs Monate. Wenigstens sechs.“
Die freundliche Miene des Kriegsministers weicht unwirschem Erstaunen: „Was!? Schneller geht’s nicht?“
„Nein, Exzellenz."
Der Feldzeugmeister durchmißt mit raschen Schritten einige Male das Zimmer. „Mhm, ja. — Sie werden von morgen ab ins Kriegsarchiv kommandiert und fangen sofort zu schreiben an. Servus!“
Dem Hauptmann dröhnt der Schädel Er hat noch nie einen Roman geschrieben, weiß aber, daß ein Versagen das Ende seiner ministeriellen Karriere bedeuten würde. Weiß auch, daß der Soldat jeden Befehl zu befolgen hat. Darum überwindet er sein arges inneres Unbehagen und tritt gefaßt vor den Präsidialchef. Der ist schon im Bilde: „Ich enthebe Sie von jedem anderen Dienst. Der Roman ist mir kapitelweise vorzulegen. Jede Woche ein Kapitel. Den Auftrag streng reservat behandeln."
In einem Zimmer der stillen Bibliothek des Kriegsarchivs sitzt nun der Romancier wider willen, brütet, sinnt, versucht zu gestalten. Der Anfang ist grauenhaft schwer, als jedoch Fabel und Konflikt gefunden sind, kommt das Schreiben allmählich in leidlichen Fluß. Die Kapitel werden im Präsidialbüro begutachtet und geeignet befunden. /
Mitte Mai 1914 erscheint im „Neuen Wiener Journal" in großer Aufmachung eine Notiz: „Ein befohlener Roman des Reichskriegsministeriums." In ihr wird nicht nur der Name des Hauptmanns genannt und der Inhalt des Werkes skizziert, sondern auch spöttisch bezweifelt, daß Romandichten zum Aufgabenkreis eines aktiven Offiziers gehöre.
Der Hauptmann eilt zum Präsidialchef. Der
Oberst ist nervös. Niemand hat eine Ahnung, wer die Indiskretion begangen haben könnte. Eine Untersuchung im Büro endet ergebnislos. „Weitere Weisungen erhalten Sie übermorgen.“
Damit ist der verstörte Dichter entlassen. Zum erstenmal seit Monaten gönnt er sich einen freien Tag, geht spazieren, sitzt melancholisch im Stadtpark. Achtundvierzig Stunden später aber schmettert der Oberst schneidig: „Zeitungsnotiz wird ignoriert. Selbstverständlich unbeirrbar Weiterarbeiten!“
Der Roman geht seinem Ende entgegen. Ein Gutes indes hat die fatale Sache mit dem „Journal“ doch. Ein großer Berliner Verlag bietet sich zur sofortigen Herausgabe des Buches an.
Mitte Juni liegt es versandbereit, die letzten Feilungen und Striche sind getan, da dröhnt das Echo der Schüsse von Sarajewo durch Europa. Die Welt wird furchtbar neu.
Der Hauptmann schleudert das Manuskript in die Schreibtischlade und packt die Koffer, um zu seinem Regiment einzurücken. Auf seinem letzten Spazierritt im Prater begegnet ihm zufällig der Dienstkämmerer des ermordeten Erzherzogs. Sie reiten ein Stück des Weges zusammen und sprechen natürlich von der großen Zeit und dem Ende der Schreibsesselreiterei im Ministerium. Zum Abschied sagt der aristokratische Kamerad: „Jetzt kann ich dir’s ja verraten, die Idee mit dem Roman war vom höchsten Herrn selber. Er hat den Kriegsminister die Weisung geben lassen und ausdrücklich dich für die komische Aufgab’ bestimmt.“
Seither, sind schwere und schwerste Jahre Geschichte geworden. Der Hauptmann des literarischen k. u. k. Reichskriegsministeriums von damals ist ein alter Herr. Wenn er an die seltsame Episode mit dem befohlenen Roman zurückdenkt, drängt sich ihm immer wieder die Frage auf: War der Skeptiker und harte Realist Ferdinand von Habsburg-Este in einem versteckten Herzenswinkel nicht doch ein österreichischer Romantiker?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!