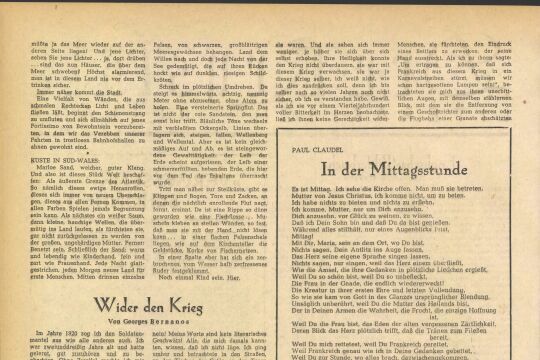DIE KÖNIGSTIGER IM ZOOLOGISCHEN Garten von Darhem werden mit lebenden Enten gefüttert. Aber die Enten scheinen ihnen nicht sehr zu schmecken. Drei weiße Enten standen in einem Winkel des Käfigs. Sie waren längst über die Angst hinaus, sie schnatterten nicht mehr. Eine Ente lag vor den Stäben, nicht zerbissen, tot. Die Tiger gingen wütend und ohne Unterbrechung auf und ab und aneinander vorbei. Sie pfauchten einander an, rissen ihre Schädel hoch, wenn sie auf gleicher Höhe waren und der eine die Körperwärme des anderen spürte. Mit dem Peitschen seines Schweifes wirbelte der eine Tiger die Ente bei den Stäben durch den Käfig. „Da sehen Sie Vietnam”, sagte die Studentin aus Saigon, die mit mir in den Zoologischen Garten von Darhem gefahren war. „Der verschmutzte Käfig. Die tollen Tiger und die Enten, die wissen, daß sie gefressen werden. Die Tiger fauchen einander an, aber wenn sie Hunger haben, oder wenn sie vor Zorn nicht mehr an sich halten können, halten sie sich an die Enten. Das sind wir, die Enten.”
Darhem ist eine Insel des Friedens in Vietnam, einem Land, das seit 27 Jahren den Frieden nicht mehr kennt. Es war zu Anfang unseres Jahrhunderts von den französischen Kolonialherren als Erholungsort für die obersten Tausend des Kolonialregimes ausgebaut worden: „Für Eingeborene Zutritt verboten.” Eingeborene machen sich nicht viel draus. Ganz Indochina war damals ein Paradies — so erzählen sie heute. Doch in Darhem stehen noch die großen Hotels der Jahrhundertwende gähnend leer, und eine Handvoll Vietnamesen und Amerikaner erlebt in riesigen Hotelhallen und in absurd großen Badezimmern „die letzten Tage von Marienbad”. Der Dschungel frißt sich in die großen Plätze des französischen Kurorts, und die meisten Käfige im Zoologischen Garten sind längst leer. Doch die Vietcong kommen nicht nach Darhem; niemand weiß warum, vielleicht deshalb, weil dort einmal „Für Eingeborene Zutritt verboten” stand, oder weil es heute in Darhem nichts mehr zu besetzen gibt. Sonst mußte ich überall dort, wo ich war, ihres Auftauchens gewärtig 9ein.
DEN ENTEN, GANZEN SCHWÄRMEN VON Ehten, begegnete ich auf meinem Wege vom Polizeigefängnis in Saigon zum Abflug mit „mittelgroßem Bahnhof”. Von den Tigern konnte ich nur während kurzer Sekunden etwas sehen: wenn sie vorbeihuschten. Aber ihre Schatten merkte ich immer und überall in diesem Land.
Ich hatte Glück: Ich konnte die ersten Nächte in Vietnam im Polizeigefängnis verbringen. Mein österreichischer Reisepaß war von der Flugplatzpolizei in Saigon mißverstanden worden und führte zu längeren Konferenzen einer immer größer werdenden Schar von uniformierten und nichtuniformierten Polizisten. Ich stand daneben und — wie immer, wenn so etwas vorgeht — wußte genau, wie es enden wird Eine Delegation der Behörde wandte sich an mich. Österreich sei ein kommunistisches Land, Südvietnam stehe im Krieg gegen die Kommunisten. Ich müsse verstehen, daß mir nur die Alternative bleibt, mit dem nächsten Flugzeug abzufliegen oder aber mich gefangen zu geben.
Ich bestritt die Behauptung, sah keinen Grund, mit dem nächsten Flugzeug abzufliegen und konnte den Polizisten doch einige Zweifel an ihrer vorgefaßten Meinung über Österreich einreden. Ich wanderte also nicht in Gefangenschaft, sondern nur ins Polizeigefängnis; es war sozusagen eine ehrenvolle Haft mit vielen Erleichterungen: In Saigon haben die Polizeizellen keine Klimaanlagen — obwohl es notwendig wäre —, und sie sind ziemlich heiß. Ich hatte dagegen das Privileg, im Hof zu schlafen, freilich unter dem Schutz zweier Soldaten. Sie schützten mich jedoch nicht vor den Moskitos, die nachts trefflich durch die Löcher des Moskitonetzes zu mir hereinfanden, aber nicht mehr hinaus, und die mich vor Zorn stachen. Nach 36 Stunden und einigen Beratungen mit dem Außenministerium war man schließlich kompromißbereit. Österreich sei zwar ein kommunistisches Land, aber nur „moitiė — moitiė”. Ich sei ein sympathischer Mensch, so daß man mir zutraute, die nichtkommunistische Hälfte Österreichs zu repräsentieren. Man versah mich mit einem Spezialvisum, kostenlos, und mit sehr viel Hilfsbereitschaft. Sie schlugen mir dann vor, mich als Gast der vietnamesischen Regierung zu betrachten. Doch davon hatte ich genug…
EIN VERGITTERTES FENSTER ist eine scharfe Linse. Durch das Fenster drang die Müdigkeit am Krieg in meine Zelle, drin war Hoffnungslosigkeit. Sie kam nicht von der Gefängnisluft, sondern von der Luft über diesem Land. Ich sah auf eine breite Straße in Saigon, und auf den Dächern spiegelte sich nachts das Neonlicht, fast so lebendig und farbig wie in Tokio. Es wurden jeden Morgen viele junge Menschen eingeliefert. Gefangene und Gefängniswärter sprachen zu mir französisch und der Offizier trank Pernaud, Abglanz französi-
scher Vergangenheit über einem desolaten Trümmerfeld. Als es im Polizeigefängnis bekannt geworden war, daß ich aus einem „kommunistischen” Land käme, das Österreich heißt, spürte ich die Angst der anderen und niemand sprach zu mir. Dann begann ich mich mit meinen Protesten durchzusetzen, zuerst unter den Gefangenen, und man begann zu sprechen. „Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann wandern Sie nicht ins Gefängnis. Dann sind wir selber neutral; neutral oder zugrunde gegangen.” Das sagte mir ein Polizeibeamter. Ein junger Fall schirmjäger, im Kampfanzug und mit Armstumpf, der als Trostpreis für die Verwundung Gefangenenwärter geworden war, meinte „wozu?”. Und er zeigte auf seinen Stumpf.
Im Keller waren die Zellen für die Kommunisten. Sie wurden nie in den Hof geführt. Aber es gab offenbar mehr verhaftete Kommunisten in den Zellen, so mußte man sie auch in den oberen Stockwerken einsperren; in Zellen, die niemals geöffnet wurden und an deren Türen außen große rote Kreise aufgemalt waren.
Viele meiner Kollegen konnten vergleichende Studien des Strafvollzugs anstellen. In den Gefängnissen des Vietcong war es noch schlechter. Im Tagraum erzählte mir eine Prostituierte, nicht wegen ihres Berufes sei sie hier, sondern wegen ihrer Kennkarte. Kennkarten sind eine begehrte Ware im Bürgerkrieg. Viele verkauften ihre Kennkarten, doch später stellte sich heraus, daß der Verkäufer selbst dafür den höchsten Preis zahlen muß. Sie hatte ihre Kennkarte nicht verkauft, sie muß trotzdem zahlen. Das geht so:
Zwei Männer der Vietcong kommen in der Nacht in die Bretterbude, die als Wohnung dient. Sie sagen, sie brauchten eine Kennkarte; die Kennkarte einer Frau von ungefähr 24 Jahren, die aus Bac Lieu kommt, in Saigon lebt und ungefähr 1,60 Meter groß ist. Wie gut sich das trifft, meinen die Besucher, sie sei genau die Gesuchte. Die Männer der Vietcong sagen es mit genügend Nachdruck. Später fällt die Agentin des Vietcong, mit 5er Kennkarte, die der Prostituierten abgenommen wurde, in die Hände der Polizei. Dann kommen wieder Männer, diesmal von der Geheimpolizei, in die Bretterbude der Prostituierten und fragen nach der Kennkarte. Auch die Polizisten stellen ihre Fragen mit Nachdruck, und es macht ihnen sichtlich Spaß, dieses Mädchen zu fragen, wie es den Männern der Vietcong Spaß macht.
Aber dem Mädchen macht es kein Vergnügen, als Kollaborateur der Vietcong in einem Konzentrationslager zu verschwinden oder von nun ab der Polizei jeden Monat ihren Verdienst abzuliefem. Das erste ist offiziell, das zweite mehr privat, und dem Mädchen, das ich im Polizeigefängnis traf, war der private Umgang mit den Polizisten noch gefährlicher als die offizielle Strafe.
SPÄTER ERFUHR ICH, daß mit dem Mädchen ein beliebter Sport getrieben worden war, den Polizei und Vietcong überall in den Städten und am Land mit großer Begeisterung nachgehen. Nur geht es nicht immer um die Kennkarte, und es ist auch nicht immer eine Prostituierte, mit der Ball gespielt wird. Es gibt andere Berufe, eigentlich die meisten im Land, die den, der sie ausübt, genauso rechtlos machen. Vietcong kommt (fast immer in der Nacht): Identitätskarte, Reis, Geld oder nur mit der „Bitte” um Übernachtung für einen Kollegen. Dann kommt die Polizei: „Du hast den Vietcong geholfen, und du bist ein Kommunist. Wir müssen dich einsperren, und wir werden dich wahrscheinlich erschießen müssen.”
Von der Polizeistation wurde ich im Luxuswagen des Informationsministeriums abgeholt, und der Begleitoffizier, meine Ehreneskorte, sagte mir: „Unsere Regierung verfolgt eine neue Politik, wir müssen darangehen, die Sympathien unser res Volkes zu erringen.” Nach zehn Jahren Bürgerkrieg! Doch der Adjutant meinte dies offenbar nicht ironisch, sondern ernst, oder aber er dachte sich überhaupt nichts dabei. Ironie ist in Vietnam den Tigern Vorbehalten, und voller Ironie war, was Brigadegeneral Do Mao mir später sagte. General Do Mao war politischer Referent der Militärjunta, die damals gerade an der Macht war, und Informationsminister; ein Mann voller Witz und Ironie. Während er die Demonstration der Studenten von Saigon gegen die Neutralitätspolitik de Gaulles von seinem Schreibtisch aus lenkte, führte er eine herzliche und intensive Korrespondenz mit dem Prinzen Bao Dai; nicht mit de Gaulle, doch mit dem Prinzen, den de Gaulle vor einiger Zeit aus den französischen Zufluchtstätten alternder Playboys herausgeholt hatte, um ihn als politischen Brückenkopf seiner Pläne in Indochina und als zukünftigen Sihanouk von Vietnam auszuprobieren. Die Korrespondenz zwischen dem vietnamesischen Informationsminister und dem Prinzen in Paris scheint inzwischen abgebrochen worden zu sein. Do Mao wurde vom letzten Putsch, der 6ich zwei Tage nach meiner Abreise aus Saigon ereignete, hinweggefegt: Generalablöse der Machiavellisten aus den Kasernenhöfen von Südvietnam.
FÜNF MONATE SIND SEITDEM STURZ DIEMS vergangen. Und es ist unmöglich, sich in Vietnam das Bild des Diktators zu erarbeiten. Nichts stimmt; nicht der Haß der Feinde Diems, nicht die Apotheose; die er in der Erinnerung seiner Freunde erfährt. Es ist nicht einmal möglich, festzustellen, ob mehr Freunde oder mehr Feinde da waren und geblieben sind. Nur eines: die Erinnerung an Diem ist lebendig, lebendig in diesem Land der oolitischen Lethargie und des politischen Absterbens. Die Selbstverbrennungen der Buddhisten waren das Fanal vor dem Zusammenbruch seines Regimes Doch die Berichte der buddhistischen Mönche sind nicht alle schwarz, und manche zeichnen das Bild des Präsidenten in blendendem Weiß.
Die Mönche der orthodoxen Richtung des „kleinen Gefährtes” brennen heute noch, wenn sie von Diem sprechen, die Mönche des „großen Gefährtes”, meist Chinesen, haben Diem nichts vorzuwerfen. Der Riß geht auch durch das katholische Lager. Doch was nach Diem kam ist ein Konglomerat fast aller Bestandteile der Fäulnis in Südvietnam. Ich sprach mit Duong van Minh, dem „großen Minh”, und fand, daß diese Bezeichnung nur seinem Körperbau gelten kann; ein gutmütiger Gendar- meriemajor, doch wenn es sein muß, skrupellos. Ich sprach mit dem General Ton That Dinh, brillant, dunkel, einer von den Polizeiministern, die Kommunisten massakrieren und bereit sind, mit deren Auftraggebern zu konspirieren. Ich sprach mit General Do Mao; er rezitierte antikommunistische Schlagzeilen, und in seiner Schublade lag wahrscheinlich ein Brief des Bao Dai über „die Wege zum Neutralismus”. Amerika galt das glühende Lippenbekenntnis, an Frankreichs neuer Flamme in Indochina wärmte man seine Suppe. Aber sie sind alle inzwischen wieder verschwunden. Doch ich sprach auch mit dem Mann, der die Falltüre öffnete, durch die sie abrutschten: General Khan. Als ich zu ihm fuhr, flüsterte man mir zu, „sie fahren zu dem Mann, der die Ablöse vorbereitet”.
In dieser furchtbaren Gegenwart ist die Vergangenheit des französischen Kolonialregimes zum goldenen Zeitalter von Vietnam geworden. Das Elend stärkt mit j 3em Tag das Prestige de Gaulles. Am Jahrestag des Falls von Dien Bien Phuh sah ich nirgends Siegesfahnen, doch in der lichtlosen Bar im Keller des Hotels, in dem ich wohnte, sagte mir ein Kellner: „Ich war dabei, als Dien Bien Phuh fiel, ich half mit. Ich wollte, ich wäre nicht dabeigewesen, ich wollte, es wäre nie geschehen.” Ich spürte, wie anonyme Kräfte die Nostalgie nach dem französischen Zeitalter schürten und ich erkannte in einigen der Apostel Frankreichs Kommunisten und Neutralisten, die de Gaulle zum Kronzeugen ihrer Politik erheben. Frankreich kehrte in einem Augenblick in die Politik Indochinas zurück, da die Menschen in ihrer Enttäuschung und ihrer Müdigkeit bereit sind, jedem Glauben zu schenken, der den Krieg in ihrem Land als einen Krieg der Amerikaner stempelt.
Peter Rindl berichtet den Lesern der „Furche” in loser Folge über seine jüngste Ostasienreise und die Eindrücke, die er an diesen Brennpunkten des Weltgeschehen; empfangen hat (siehe auch „Die Furche”, Nr. 11, 18, 20/1964).