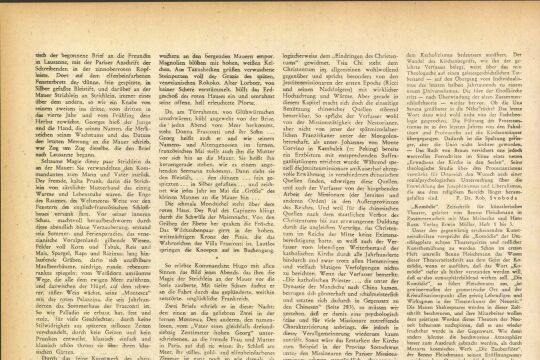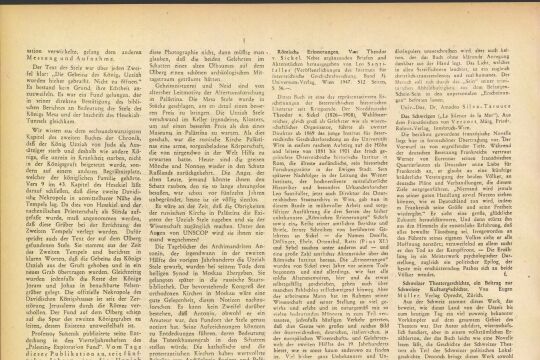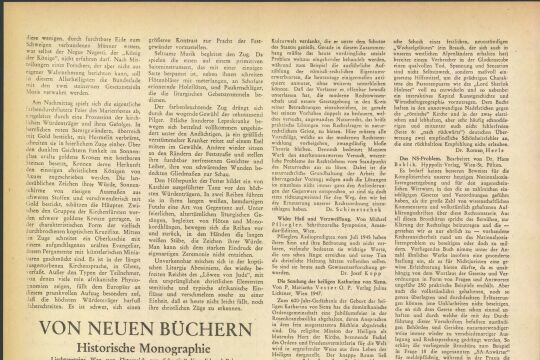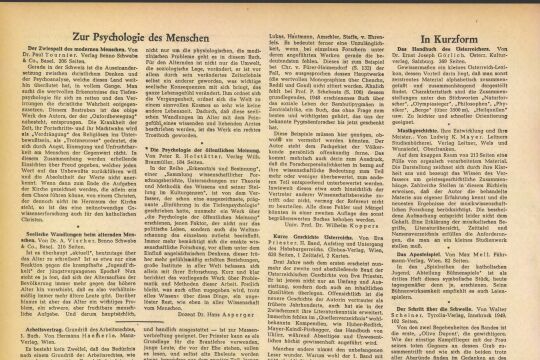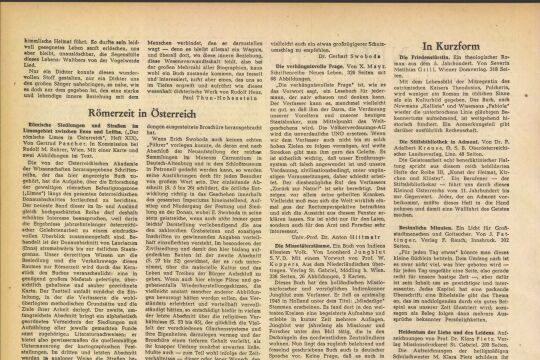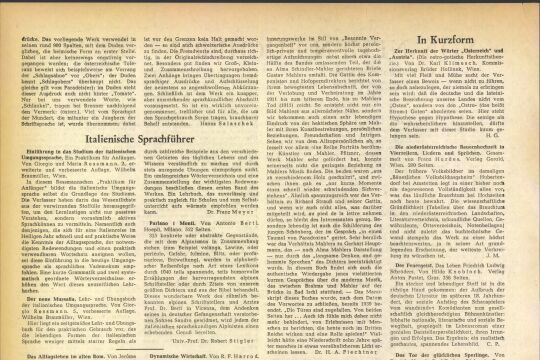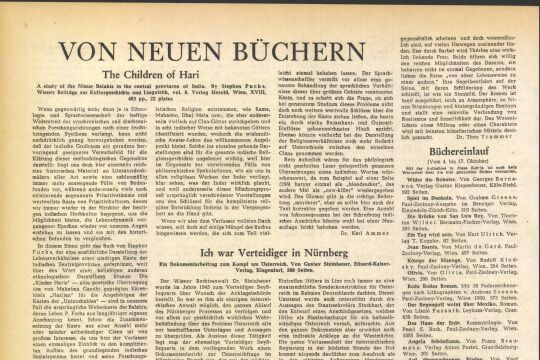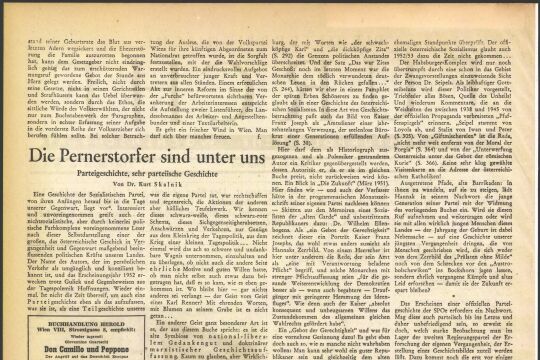ÖSTERREICHISCHE ZEITGESCHICHTE. Vom Ende der Monarchie bis zum Abschluß des Staatsvertrages. Von Hanns Leo Mikoletzky. Austria Edition, Wien; Österreichischer Bundesverlag, Wien-München, 1962. 522 Seiten, 84 Photos. Preis 120 S.
Während die Zeitgeschichte auf akade Büschem Boden in Österreich noch un ihren Ort ringen muß, hat sie auf den Büchermarkt in den letzten Jahren merk' lieh aufgeholt. Zu dem von Univ.-Prof Dr. Heinrich Benedikt herausgegebenen lange einsamen Sammelband „Geschieht der Republik Österreich“ — trotz zeitlicher Überholungen noch immer d a ■ Standardwerk — sind, andere Publikationer getreten, die sich auf die bewegten Jahrzehnte von 1918 bis in die Gegenwarf konzentrieren. Vor einiger Zeit erst konnten wir an dieser Stelle auf die Darstellung Helmut Andics' verweisen, der in der Form der politischen Reportage den Unglücksweg eines Staates, „den keinei wollte“, einem breiteren Publikum nahezubringen versucht.
Welche starke Anziehungskraft die Zeitgeschichte aber auch innerhalb der Zunft der Historiker auszuüben beginnt, zeigt das vorliegende Buch. Sein Verfasser ist im Finanz- und Hofkammerarchiv zu Hause und als Dozent für mittelalterliche Geschichte bisher mit instruktiven Publikationen seines Spezialfaches hervorgetreten, von denen nur jene über „Kaiser Heinrich II. und die Kirche“ (1946) und „Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto II.“ (1950) erwähnt sein sollen. Und nun ein Ausflug in die Zeitgeschichte? Das mag nicht zuletzt vor allem seine Kollegen überrascht haben. Mikoletzky bringt aber für diesen Gang neben einer gründlichen Ausbildung am Institut für Osterreichische Geschichtsforschung und großem Interesse an den Begebenheiten des Tages ein wertvolles Requisit mit, das ihm wahrscheinlich vor allem zu diesem Versuch auf Neuland ermunterte: Sein Tagebuch. Dagegen mußte er wie alle anderen Historiker auf die Verwertung ihm wohlvertraute Archivbestände verzichten. Die Archivsperre bindet selbstverständlich auch den Leiter eines österreichischen Archives und verweist ihn der Öffentlichkeit gegenüber auf den Gebrauch sekundärer Quellen. Mit dem zugegebenen „Mut zum Fragmentarischen und sichtbarer Scheu vor endgültigen Richtersprüchen“ (S. 14) wollte Mikoletzky aber ein Bild zeichnen, das bei aller Unvollständigkeit die Beteiligten möglichst persönlich zu Wort kommen läßt und dadurch den gesjttzbedingtcn Mangel der Archivbenützung jn Österreich teilweise wettzumachen versucht. Diese Methode, „das Geschehen zur Selbstdarstellung zu zwingen“, ist nicht neu und wurde in Österreich auch in einschlägigen Darstellungen der Zeitgeschichte bereits angewandt. Mikoletzky hat sie zur Grundlage seines breit angelegten, fleißig erarbeiteten Werkes gemacht. Da ziehen sie nun also wieder vorüber, die Jahrzehnte zwischen 1918 und heute, randvoll erfüllt mit nicht selten bitterem Geschehen! So interessant das Beginnen, so fleißig die Arbeit, so erfreulich die Aufgeschlossenheit des Autors für das Wachsen und Reifen der Idee Österreich in den Herzen seiner Bürger, ganz froh wird man des vorliegenden Buches nicht.
Da ist zunächst der Mangel an neuen Perspektiven und das völlige Fehlen von neuem, die Geschichtserkenntnis bereicherndem Material. Deswegen erscheint sogar die Frage nicht abwegig, wozu überhaupt die gewiß nicht leichte Arbeit unternommen wurde und ob das erzielte Ergebnis mit dem dafür aufgewendeten Schweiß in rechtem Einklang steht. Dazu kommt noch, daß der aufmerksame kritische Leser auf eine nicht unbeträchtliche Liste von „Errata“ stoßen wird. Hier werden doch jene Grenzen sichtbar, die bei der Spezialisierung unserer Wissenschaft einem Mediävisten in der Zeitgeschichte nun einmal gesetzt sind. Einige Beispiele mögen dies deutlich machen:
Das Ende der „großen Koalition“ wurde nicht durch eine „vielleicht unbedachte Konsequenz“ (S. 89) der Sozialdemokraten nach den von ihnen verlorenen Wahlen herbeigeführt, sondern durch den Einspruch der Christlichsozialen gegen das Vehrgesetz 1920. Bezüglich des Prozesses gegen die Schattendorfer Angeklagten hätte eine Einsicht in die Dissertation von Franz Ollerer, „Seipel, der 15. Juli 1927 und die Wiener Presse“ (Wien, 1952), dem Verfasser bei der Darstellung des einschlägigen Kapitels gewiß neue Perspektiven eröffnet. Auch das grundlegende Werk über die Heimwehrbewegung „Hei-matschutz in Österreich“ (Wien, 1934, rweite Auflage 1935) mit seinen zahlreichen Quellenangaben wird man sowohl im Literaturverzeichnis als auch bei der Berücksichtigung des von ihm vorgelegten Materials vermissen. Aus ihm hätte der \utor zum Beispiel entnehmen können, laß der berühmt gewordene „Komeubur-;er Eid“ schon bei ähnlichen Kundgebun-;en der Jahre 1928/29 seine Vorläufer batte (S. 161). Auch die einschlägige, lehr zahlreiche Zeitschriftenliteratur der ■leimwehrbewegung wurde übergangen. Interessant ist der Hinweis auf einen „rein persönlichen Plan“, den Seipel nach den Wahlen des Jahres 1930 über ein „Statut jer Regierung und der Parlamentseinheit“ konzipierte. Leider fehlt bei dem umfang-
reichen Zitat jede Quellenangabe. Bezüglich der österreichisch-ungarischen Beziehungen der Zwischenkriegszeit härte Mikoletzky die profunden Einleitungen von L Kerekes zu den „Akten des Ungarischen Ministerium des Äußeren zur Vorgeschichte der Annexion Österreichs“ verwerten sollen. An dieser Stelle muß man auch gleich das Bedauern aussprechen, daß der Verfasser die bereits vorhandenen Aktenveröffentlichungen über jene Zeit zuwenig berücksichtigt.
Dollfuß kann man nach den bekanntgewordenen einschlägigen Veröffentlichungen wohl kaum als „Sohn armer Keuschlerleute“ (S. 178) bezeichnen. Univ.-Doz. Doktor Ludwig F. Jedlicka („Neue Deutsche Biographie“) und Gordon Shepherd („Engelbert Dollfuß“) weisen nach, daß Dollfuß der uneheliche Sohn einer begüterten Bauerstochter war. Sein Vater ist längst als der Müllergehilfe Weninger bekannt, was dem Verfasser durch das Pfarramt Texing bestätigt werden wird. Auch ist es zumindest ungenau, zu schreiben, Schuschnigg habe im Jahr 1930 „in Innsbruck die Ostmärkischen Sturm-scharen ins Leben gerufen“ (S. 207). Gründer dieses Verbandes, dessen Aufstieg sich später mit dem Namen Schusch-niggs verband, war der in Innsbruck lebende Fürsorgerat Bator, der zu seiner Idee von einem Vorbild aus dem Rheinland inspiriert war. (Bei Univ.-Prof. Hantsch ist — nebenbei bemerkt — diesbezüglich eine Dissertation in Arbeit.) Bezüglich der Wandlung Dollfuß' vom Katholisch-nationalen zum Vorkämpfer der österreichischen Idee hätte der Verfasser das dem Kanzler gewidmete Kapitel in dem Buch Ernst E. K. Winters, „Christentum und Zivilisation“, nicht vernachlässigen dürfen. Winter kommt überhaupt bei Mikoletzky schlecht weg. Den um die Überbrückung des tiefen Grabens zwischen „Arbeiterschaft und Staat“ — übrigens auch ein Titel, den wir vermissen — rastlos wirkenden Vorkämpfer einer österreichischen Selbstbesinnung kann man 1963 in einer österreichischen Zeitgeschichte guten Gewissens nicht mit dem Nebensatz „ein historisch sehr interessanter Mann“ (S. 289) abtun. Zum Kapitel „Dollfuß“ fehlen außerdem die hochinteressanten einschlägigen Hinweise des Herzogs Max von Hohenberg im „Kaiser-Karl-Jahrbuch 1938“.
Auch bei der Beurteilung des nationalsozialistischen Gegners gibt es manche Kurzschlüsse. So wird Theo Habicht als „Delegierter der obersten Führung der NSDAP in Österreich“ (S. 248) vorgestellt, obwohl er offiziell den Titel Landesinspekteur trug und dem Landesleiter Proksch unterstellt war, der übrigens in Linz und nicht, wie der Verfasser meint, in Wien (S. 253) amtierte. Das ist vielleicht ein „kleiner Fisch“, ehrliches Unbehagen dagegen muß die schematische Darstellung des Februar 1934 hervorrufen. Mikoletzky folgt bei derselben uneingeschränkt der zeitgenössischen „Putschtheorie“, obwohl die inzwischen durchgeführten Forschungen und Studien konservativer Historiker Licht und Schatten gerechter zu verteilen wissen. Aber auch sein Tagebuch muß Mikoletzky in Stich gelassen haben. Sonst hätte er wohl nicht
von den „Panzern der Regierung geschrieben (S. 281), denen die „Gemeindebauten nicht standzuhalten vermochten“. Die Regierung verfügte damals überhaupt nicht über Panzer. Die rasche Entscheidung brachte bekanntlich der später vieldiskutierte Einsatz von Artillerie.
Vom 12. Februar bis 25. Juli 1934! Die Anführer der Revolte wurden nicht durch die Polizei am Eindringen in das Kanzleramt gehindert (S. 298), sondern wollten gar nicht miteindringen, vielmehr erst nach dem Erscheinen von Rintelen sich demaskieren. Den italienischen Außenminister Suvich als „österreichfreundlich“ zu bezeichnen (S. 333), scheint wohl etwas übertrieben. In der Hitze des Gefechtes wird aus dem bekannten Geopolitiker Karl Haushofer ein Hausdorfer (S. 337). Leo Tavs (nicht Franz) war nicht Rechtsanwalt, sondern entlassener hoher Beamter des Patentamtes (S. 347). Bundeskanzler Schuschnigg stand mit Mussolini auf gar keinem „vertrauten Fuß“ (S. 353). Im Gegenteil: Die persönlichen Reserven bestanden auf beiden Seiten. Nicht eine sagenhafte Sekretärin Zer-nattos hat den Plan zur Volksabstimmung 1938 allein verraten (S. 374), sondern viel früher ein Angehöriger österreichischer Industriekreise, der die Mitteilung vom Generalsekretär des Gewerbebundes, Wiedmann, erhielt und an den deutschen Militärattache Muff weitergab (Akten zur Deutseben Auswärtigen Politik, Serie D, Band I, S. 460). Zur Abschiedsrede Schuschniggs: Der Verfasser vermerkt in einer Fußnote (S. 374), daß er in der „Wiener Zeitung“ „merkwürdigerweise“
die Worte „ohne wesentlichen Widerstand“ fand. Daran ist gar nichts merkwürdig. Kurt von Schuschnigg gebrauchte diese Wendung, fügte dann jedoch sofort hinzu: „Ohne Widerstand.“ Ernst Molden war nie Herausgeber der „Neuen Freien Presse“ (S. 415), sondern deren stellvertretender Chefredakteur. Beschließen wir diese Liste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Wir können jedoch nicht Abschied von Hans L. Mikoletzky und seiner „Österreichischen Zeitgeschichte“ nehmen, ohne auf eine — nennen wir es — „Eigenart“ des Verfassers zu sprechen kommen. Immer wenn der Autor an den Höhepunkten der Geschichte angelangt ist, flicht er persönliche, mitunter sehr persönliche Zwischenbemerkungen ein. Dies mag in einem Geschichtswerk gestattet sein, dessen Verfasser (zum Beispiel Churchill) selbst im Zentrum des Geschehens gestanden oder wesentliche Korrekturen aus persönlicher Perspektive anzubringen hat. Ob aber Mikoletzky 1934 mit einem Studentenausweis einer alten Dame frische Semmeln ins Haus trug (S. 280) oder ob er am 10. März 1938 nach einer Aufführung der „Drei Maupins“ (mit Maria Eis) Demonstranten und Gegendemonstranten begegnete oder ob die Polizisten zwei Tage später gerade Hakenkreuzbinden anlegten, „als der Verfasser ins Amt ging“ (S. 386), steht wohl sehr außerhalb der geschichtlichen Ereignisse. Auch die Geburt eines zweiten Sohnes am 12. Mai 1945 (S. 454) ist in einer Familienchronik besser verzeichnet.
So tritt uns Mikoletzky letzten Endes selbst als Spaziergänger in der Zeitgeschichte entgegen. Wir schließen mit der festen Hoffnung, daß der Autor, von diesem Ausflug heimgekehrt, uns noch manches gediegene Werk aus seinem eigentlichen Fachgebiet schenken wird.