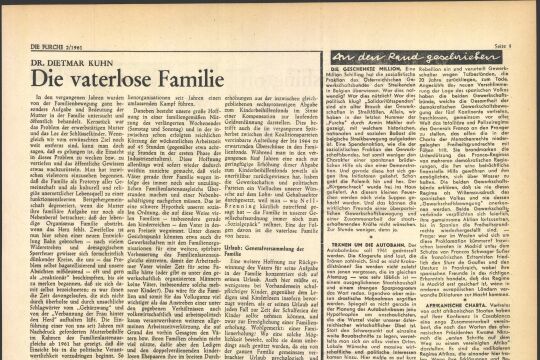Mit der Vervielfältigung von Lebensformen drängt sich die Frage auf, welche Bedeutung dem Ideal der klassischen Familie noch zukommt und zukommen soll. Immer häufiger sprechen Familienpolitiker und Expertinnen von Wahlfreiheit. Doch hinter dem Begriff verbirgt sich ein erbitterter Kampf um Werte.
Es war ein eigenartiges Familientreffen mit einigem Zündstoff: Die kleine Marie feierte ihren siebten Geburtstag. Sie lebt mit ihrer Mutter bei deren neuem Ehemann. Die beiden haben ein gemeinsames Kind bekommen. Der neue Mann der Mutter hat selbst zwei Kinder, die mal beim Vater, mal bei der Mutter leben. Zur Geburtstagsfeier kam natürlich Maries Vater, bei dem Marie oft ist. Der hat auch eine neue Freundin, die einen Buben mit in die Beziehung gebracht hat, der fast so alt wie Marie ist und mit dem sie gerne spielt. Und etwas später in der Feier kam noch die Mutter von Maries Stiefgeschwister, die ihre Kinder abholen wollte und noch für eine Stunde auf Kaffee und Kuchen blieb. Sie hat auch ein neues Kind aus einer neuen Beziehung, das sie im Tragetuch bei sich hatte. Die Begegnungen der Erwachsenen seien gewiss nicht alle ohne Spannung, erzählt später Maries Vater. Aber man müsse sich eben mit der Situation arrangieren. Gewollt habe das niemand so. Wer zu seiner Familie gehörte, war zumindest für Maries Vater, Robert K., klar: Seine Tochter und seine neue Freundin, sonst niemand (mehr). Für seine Tochter würde die Antwort schon komplizierter ausfallen und für den Außenstehenden, den analysierenden Soziologen, nochmals ein Stück.
Und für den Staat, die Gesellschaft? Was würde ein solcher Verband, der dennoch zu gewissen Anlässen zusammenfindet und kommuniziert, darstellen? Familie?
Wer ist Familie?
Für Familienstaatssekretärin Christine Marek (ÖVP) wäre es falsch „Familie“ von außen zu definieren. Wer sich als Familie betrachtet, sei auch eine, sagt sie im FURCHE-Gespräch. Darüber hinaus definiert sie Familie als „Rückzug, das Intimste, das es gibt, und eine positive Energie“. Für die Grüne-Familiensprecherin Daniela Musiol liegt Familie dann vor, wenn Personen gemeinsam ihr Leben gestalten wollen. Für Clemens Steindl, Präsident des Katholischen Familienverbandes, definiert sich Familie über Kinder (siehe Seite 24). Für die Grünen etwa stellt dies eine Diskriminierung von ungewollt Kinderlosen oder gleichgeschlechtlichen Paaren dar. Gerade die letzten Lebensformen zeigen auf: Nicht nur die zunehmenden Scheidungen und daraus folgenden neuen Beziehungen, Stichwort Patchwork, auch die Reproduktionsmedizin schafft neue Familienformen: Zugespitzt könnte man ein gleichgeschlechtliches Paar betrachten, das ein Kind durch Leihmutterschaft und Eizellspende bekommen hat.
Meist werden solche Beispiele nicht ohne Wertung skizziert. Meist sind solche Beispiele indirekt mit der Frage verbunden, ob das Ideal der traditionellen Kernfamilie – Mutter, Vater, Kinder, Großeltern, für immer verbunden – noch hochgehalten werden soll und auch wird.
Hier gehen die Meinungen auseinander: Staatssekretärin Marek betont gegenüber der FURCHE, dass sie, gerade als Alleinerzieherin, zwar ein persönliches Idealbild von Vater, Mutter und Kind habe, die Realität aber anders aussehe. „Meiner Politik liegt die Realität zugrunde.“ Es wäre müßig, ausschließlich ein Idealbild zu fördern, wenn die gesellschaftliche Realität einfach anders aussehe, sagt sie. Diese müsse man anerkennen und dementsprechend Rahmenbedingungen für alle Familien gestalten.
Musiol argumentiert hingegen, dass diese Regierung sehr wohl die klassische Familie bevorzuge, zumindest Paare, die zusammenlebten. Sie nennt als Beispiel das Kinderbetreuungsgeld. Alleinerziehende seien benachteiligt. Zudem: Soziale Eltern würden nicht berücksichtigt.
Auch Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo zieht aus den Ergebnissen ihrer aktuellen Studie zu Familienleistungen in Österreich den Schluss, dass der Familienpolitik ein traditionelles Familienbild zugrunde liegt. „Es gibt sehr starke Anreize, dass Frauen zu Hause bleiben und Betreuungspflichten übernehmen und dass die Männer Haupternährer sind.“ Sie verweist auf das Steuersystem. Zudem: Sobald Kinder kommen, würden viele Familien, die zuvor ein gleichberechtigtes Modell gelebt hätten, auf traditionelle Formen umsteigen: „Das liegt mit Sicherheit nicht nur daran, dass Familien es so wollen, sondern es gibt auch eine Reihe von Frauen, die mehr arbeiten würden, wenn es genügend Betreuungseinrichtungen gäbe“. Ihre Studie, die sie mit zwei weiteren Expertinnen geschrieben hat, kommt zum Schluss, dass Österreich zwar viel Geld für Familienpolitik ausgibt, die familienpolitischen Ziele wie Frauenbeschäftigung, Armutsvermeidung und höhere Geburtenrate nicht erreicht würden. Schratzenstaller plädiert für eine Umschichtung von direkten Transfers zu einem Ausbau der Infrastruktur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Langfristig sollten etwa die Langversion des Kinderbetreuungsgeldes oder steuerliche Maßnahmen wie der Alleinverdienerabsetzbetrag überdacht werden und besser die Berufstätigkeit der Frauen gefördert werden. Schratzenstaller betont: Sie wolle Wahlfreiheit, doch de facto gebe es diese nicht. Das neue einkommensabhängige Kindergeld sei zwar ein „Meilenstein“, bliebe aber ohne weitere Rahmenbedingungen, wie mehr Kinderbetreuungsplätze für die Kleinsten, nur begrenzt wirksam.
Die Wahlfreiheit und ihre Grenzen
Wahlfreiheit ist der Slogan, der in der Familienpolitik häufig fällt. Er wird auch von Christine Marek hochgehalten. Die Wifo-Studie selbst will sie noch nicht kommentieren, meint aber, dass sie es nicht gut heißen würde, direkte Transfers gegen den Ausbau von Infrastruktur auszuspielen. Zu den geplanten Einsparungszielen im Familienressort – es müssen 234,9 Millionen Euro eingespart werden – will oder, wie sie selbst sagt, kann Marek noch nichts sagen. Bis Herbst würden Vorschläge gemacht. An den Einsparungen wird man, so sind sich viele Fachleute in der familienpolitischen Diskussion einig, auch sehen, welche Werte der Familienpolitik zugrunde liegen.
Welche Familienform Marie sich einmal wünschen wird, ist noch unklar. Klar ist, sie muss mit ihrer neuen Familie leben, ob von Freunden, Verwandten oder Lehrern gut geheißen oder nur akzeptiert. Für die Trendforscher, wie etwa jene vom deutschen Zukunftsinstitut, ist Maries Familie, wenn sie zusammenwachsen sollte, ohnehin die Zukunft: Pragmatismus würde die neuen Netzwerke charakterisieren. Neue Großfamilien also, mit viel Spannungspotenzial, aber auch mit einigen Chancen auf gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Vielleicht eine schön geredete Illusion oder einfach ein Muss angesichts der Realität, das sich als Nutzen für alle herausstellen könnte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!