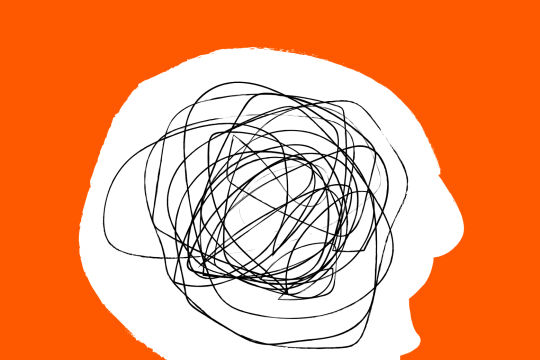Täglich in der Früh geht Peter S.* zur Apotheke, bekommt eine Medikamentenpackung gereicht und drückt drei Kapseln heraus, eine nach der anderen schluckt er hinunter, die Apothekerin schaut zu, manchmal auch andere Kunden, sie dokumentiert die Vergabe des Medikaments.
Peter drückt noch drei Kapseln heraus, seine Abendration. Der 38-jährige Mann geht, nach etwa 45 Minuten beginnt er sich, gut zu fühlen. Die Zigarette schmeckt, der Appetit kommt. Peter nimmt täglich sechs Kapseln Substitol, ein morphinhaltiges Medikament zur Drogenersatztherapie. Bevor er mit der Substitution begonnen hatte, war er zwei Jahre lang auf Heroin: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, man fühlt sie wie im Mutterleib. Drei Monate lang macht das Spaß, dann geht es nur mehr darum, wo kriege ich es her", sagt er. Zwei Jahre lang war die Beschaffung der Droge der einzige Lebensinhalt, bis er wegen Einbruchsdiebstahls im Gefängnis landete. Als er wieder draußen war - im Jahr 2000 - reichte es ihm; weil der Weg immer wieder ins Gefängnis führen würde, erzählt er. Heute ist sein Leben normal - fast.
Er würde einfach nur gerne für drei Wochen vereisen, weg aus Wien, doch der Weg ist versperrt. Durch die Verschärfungen der Substitutionsbehandlung im vergangenen Jahr dürfen arbeitslose Substitutionspatienten wie Peter nur maximal zwei Wochen die Stadt verlassen, oder mit anderen Worten: Sie bekommen maximal eine Zwei-Wochen-Ration an Medikamenten ausgehändigt; jene, die arbeiten, dürfen vier Wochen ihrer Apotheke fernbleiben. Für Peter nicht die einzige Zumutung. Vor der Novelle der Suchtgiftverordnung bekam er einmal wöchentlich seine Ration an Morphin-Kapseln, nun muss er täglich hin (die Sonn- und Feiertagsdosen bekommt er mit). Das Motiv der Verschärfungsmaßnahmen: Schwarzmarkt und Missbrauch sollen eingedämmt werden. Irgendwie verstehe er das sogar, aber es sollten jene strengere Auflagen bekommen, die Probleme machten, bei ihm sei immer alles in Ordnung gewesen. Man müsste nur mehr Gitter an seine Wohnungsfenster machen, dann wäre er erneut im Knast. "Ich bin 38 und halbentmündigt, weil der Staat mich dazu zwingt, er weiß immer, wo ich bin. Daher wird auch der Karlsplatz immer der Karlsplatz sein, da haben sie alle auf einem Haufen."
"Wie im Mutterleib"
"Doch Missbrauch ist Symptom der Suchterkrankung und ein Symptom lässt sich nicht durch Verordnungen wegbekommen", sagt Hans Haltmayer, ärztlicher Leiter der sozialmedizinischen Drogenberatungsstelle Ganslwirt in Wien. Dass die Mitgabe von Drogenersatzpräparaten nun restriktiver ist, sei aber sinnvoll, meint Haltmayer, eine zu lockere Handhabung könnte das Gesamtkonzept der Substitutionstherapie in Verruf bringen, die das Leben vieler Suchtkranker stabilisiert hätte. Dennoch bedinge die Novelle vom März 2007 teilweise auch Missbrauch, erklärt Haltmayer: Denn sie regelt nur orale Substitution, nicht aber intravenöse Formen, die für manche Suchtkranke als Teil eines Rituals und der Erkrankung eine wichtige Alternative wären, um sie in Therapie zu bekommen bzw. zu halten und sie damit vom Schwarzmarkt und der Beschaffungskriminalität fern zu halten. Hans Haltmayer gehört genauso zu den Pionieren in der Substitutionstherapie wie Hans-Joachim Fuchs, Allgemeinmediziner im 9. Bezirk, der seit 20 Jahren, seit Beginn des Therapieangebotes in Österreich, Suchtpatienten behandelt. Von seinen zirka tausend Patienten sind 200 Suchtkranke. Und ähnlich wie Haltmayer kritisiert auch Fuchs etliche Mängel an der Verordnung. "Es muss wieder der behandelnde Arzt, und nicht der Amtsarzt, der den Patienten kaum kennt, die letzte Verantwortung in der Behandlung tragen", betont Fuchs. Nur der behandelnde Arzt könne wirklich auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingehen und das Missbrauchsrisiko einschätzen. "Es geht darum, das Selbstwertgefühl der Suchtkranken zu stärken. Die verschärften Kontrollen zielen aber darauf ab, wieder zu demütigen, und setzen den Suchtmechanismus erst recht wieder in Gang", erklärt Fuchs. Suchtkranke, die sich jahrelang problemlos selbst ihre Wochenration eingeteilt haben, würden die jetzigen Auflagen als Demütigung empfinden, etwa Mütter mit kleinen Kindern, die Angst hätten, von Nachbarn irgendwann in der Apotheke gesehen zu werden.
Diese Angst sei am Land natürlich noch größer als in der Stadt, sagt auch Haltmayer: Zudem sei die Versorgung in manchen Bundesländern, vor allem in ländlichen Gegenden, schwieriger als in Wien, das eine gute Infrastruktur bieten könne. Einige Bundesländer weisen einen gravierenden Mangel an Ärzten auf, die Substitutionstherapie anbieten. Laut Novelle müssen Ärzte, die suchtkranke Patienten behandeln wollen, ein Aus- und Fortbildungsprogramm absolvieren. Für manche Ärzte, die nur wenige Suchtkranke behandeln, eine zu große Belastung. In Niederösterreich etwa seien von 300 Ärzten rund 70 übriggeblieben, wie die niederösterreichische Suchtkoordinatorin Ursula Hörhan im Ärztemagazin beklagt. In der Steiermark hat sich die Anzahl der Ärzte, die in diesem Bereich tätig sind, ebenso halbiert.
"Heroin druntergemischt"
Der Nationale Drogenkoordinator im Gesundheitsministerium, Franz Pietsch, rechtfertigt diese Auflagen als "Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Behandlung von Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen" und mahnt Anstrengungen der Länder ein. Pietsch weist auch darauf hin, dass in Wien entgegen Befürchtungen der Kritiker die Anzahl der Patienten deutlich steigt. Der Schwarzmarkt sei bundesweit um bis zu 50 Prozent zurückgegangen. Vereinzelt habe das Schwarzmarktproblem aber zugenommen. Etwa in der Steiermark, wo vermehrt Substitol, wahrscheinlich aus Wien, aufgetaucht ist und zu Todesfällen bei Jugendlichen geführt hat, die das Präparat missbräuchlich eingenommen hatten. Rufe nach einem Verbot des Medikaments wurden laut. Tatsächlich wird Substitol bereits restriktiv verschrieben, da es nur Mittel zweiter Wahl sein darf, ebenso ein Kritikpunkt der Ärzte, die sich dagegen wehren, dass sich Behörden in ihre Verschreibungspraxis einmischen.
Peter hat aber nur Substitol vertragen, bei Methadon, ein Mittel erster Wahl, wurde ihm übel. Er kennt die Mechanismen des Schwarzmarktes. Missbrauch werde es immer geben, sagt auch er, trotz strenger Regeln gelinge es immer wieder, dass Substitutionspatienten Kapsel ausspucken und verkaufen. Er selbst, sagt er, habe nie den Schwarzmarkt mit bedient. Es gehe ihm gut, nur 20-mal in acht Jahren habe er noch zusätzlich andere illegale Drogen genommen. Durch eine List, sagt er, ist er zum Heroin gekommen. Zuvor hatte er Kokain genommen. Er war von Oberösterreich nach Wien gezogen. Das Motto war: Dabei sein und Vollgas geben, erzählt er heute. Ein angeblicher Freund mischte ihm, ohne es ihm zu sagen, Heroin ins Kokain, er schnupfte es. "Hätte er es mir nur gesagt, dann hätte ich mich entscheiden können. Ich weiß nicht, ob ich Ja oder Nein gesagt hätte." Der Abstieg begann, bis er ohne Job, Wohnung, Frau, Sohn und Freiheit war.
Heute hat er eine Gemeindebauwohnung, seit eineinhalb Jahren ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Er würde aber gerne arbeiten, nur nicht mehr Vollzeit. Das würde sein Körper nicht durchhalten, ebenso einen Entzug: Vor fünf Jahren erfuhr Peter, dass er HIV positiv ist. Nicht durch eine verunreinigte Nadel, meint er, da habe er immer aufgepasst, sondern durch eine Frau, obwohl er sie extra gefragt habe. "Das ist Mord auf Raten. Hätte sie es mir nur vorher gesagt", meint er. Wieder wurde er nicht gefragt. "Aber, lächelt er, ich habe viel erlebt, ich habe wenigstens nicht das Gefühl, etwas versäumt zu haben."
Mitarbeit: Maria Stradner
* Name von der Redaktion geändert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!