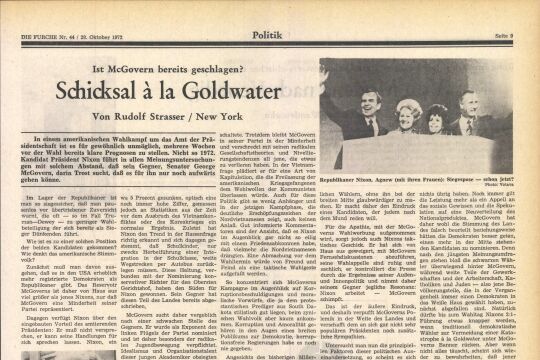Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auswechselbare Gesichter
Amerikas Wahlkämpfer nähern sich der Zielgeraden. Nach einem Sieg der Apparate in den Konventen haben die Kandidaten der Republikaner und Demokraten einen wohl hektischen, aber gesichtslosen Wahlkampf geführt. Und statt sich voneinander abzuheben, sind sie einander ähnlicher geworden: Denn Nixon sah sich einem Druck von der Rechten, die zu Wallace überläuft, gegenüber, wie anderseits der Notwendigkeit, unzufriedene. Halblinke, vor allem aber Neger von der John- son-Humphrey-Administration wegzuholen. Humphrey hatte ein ähnliches Fazit: links gingen die Freunde MacCarthys und Bob Kennedys als Unzufriedene in den Protest und rechts drohte Nixon, alles aufzufangen.
Nixon hat sein „Verlierer“-Image glänzend ausgebügelt, doch die schwache Hoffnung auf einen Vietnamfrieden, auf den Humphrey lange setzte, könnte dem Vizepräsidenten auch in letzter Sekunde noch nützen.
Offenbar aber hat Humphrey im Wahlkampf nicht glaubwürdig genug den „Rechtsrutsch“ des weißen Durchschnittsbürgers abgefangen, der nach „Sicherheit und Ordnung“ verlangt. Auch hat Humphrey — zum Unterschied von Nixon —tei nicht gänzlich hinter sich. Zu viele Demokraten trauern dem Kennedy-Mythos nach, dem Jacqueline Onassis einen Stoß ins Herz versetzt hat.
„Sicherheit und Ordnung“ als Maxime jeder Politik verspricht unterdessen George Wallace, Schreier des „unbekannten“ Amerika. Der Exboxer wird zur großen Unbekannten und zum Symbol einer neuen extremen Rechten, deren Ausbrüche man nicht erwartet hätte. Der Anteil seiner Stimmen wird Barometer des latenten Faschismus in den USA sein — denn über den rassistisch-faschistischen Background des Gouverneurs von Alabama braucht sich niemand Illusionen hinzugeben. Er macht aber auch ein soziales Phänomen sichtbar: die Rechten, die 1964 für Goldwater stimmten, waren „White-collar“- Wähler; im Lager von George Wallace aber trifft sich der Fach- und Hilfsarbeiter, das Landproletariat und die sozialen Minderheiten. Wallaces Auftreten macht einen „Min- derheitenpräsidenst“ wahrscheinlich; das heißt, daß der nächste USA- Präsident zwar nicht 50 Prozent der Wählerstimmen erringt, aber doch genügend Wahlmänner, die eine Mehrheit von 270 garantieren.
Wie sehr hat sich — rückblickend — doch die Landschaft der USA verändert: noch vor vier Jahren hatte seine Par- Johnson den Wahlerfolg des Jahr-hunderts erringen können!
Nun freilich geht die Ära Johnson zu Ende. Der Präsident war zwar glücklos, aber nicht ohne Größe. Er trat in Dallas 1963 eine schweres Erbe an; zu den außenpolitischen Abenteuern der Kennedy-Administration traten die innenpolitischen Konflikte, die ein zu rascher Vorgriff auf die gesellschaftliche Entwicklung provoziert hatte.
Unter Johnson ist Amerikas Frontstellung nach Asien und gegen China ausgerichtet worden, und sein Gent- leman’s Agreement mit den Sowjets hat für die Zukunft der USA existentiellen Charakter. Durch seinen Verzicht auf die neuerliche Kandidatur zwang er seinen Nachfolger in die Gefangenschaft der unbewältigten Gegenwart.
Wer immer der neue Mann im Weißen Haus ist, wir wissen nichts über seine Chance, es besser zu machen als Johnson. Denn weder Nixon noch Humphrey zeigten ein klares Konzept für die Zukunft in Ostasien, sie zeigten keine Klarheiten über ein Profil des Machtausgleichs mit dem Kreml und sie hatten kein Rezept für den Frieden mit den Schwarzen im eigenen Land.
Sie sind — um es schwarzweiß auszudrücken — auswechselbare Gesichter. Europas Konsequenz aus neuer Gesprächspartnerschaft sollte daher logisch sein: Selbständigkeit und Selbstschutz — nicht blinder Verlaß auf den neuen schwachen Onkel im Weißen Haus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!








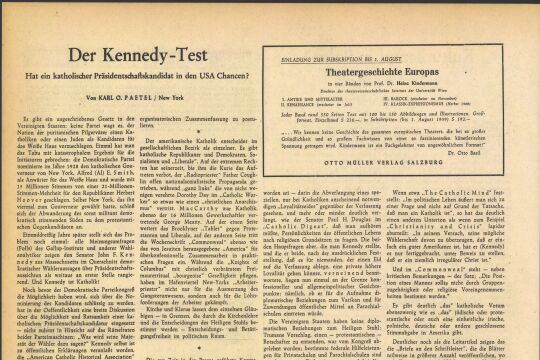












.jpg)