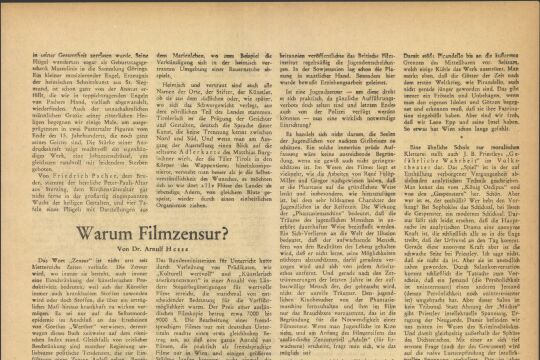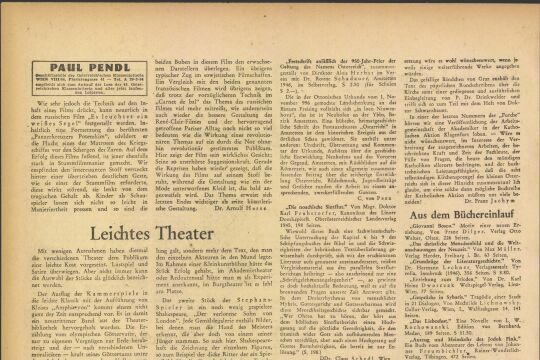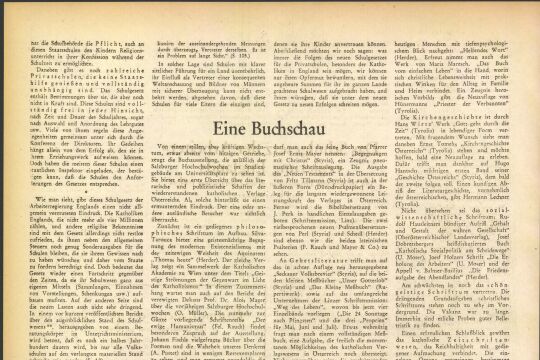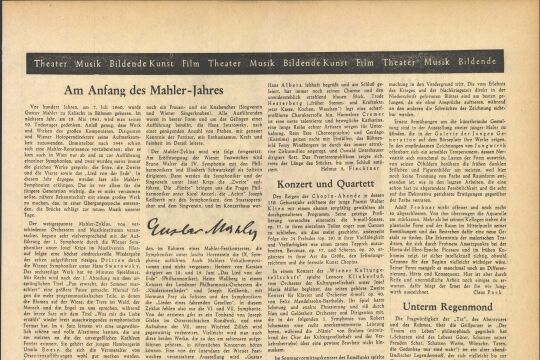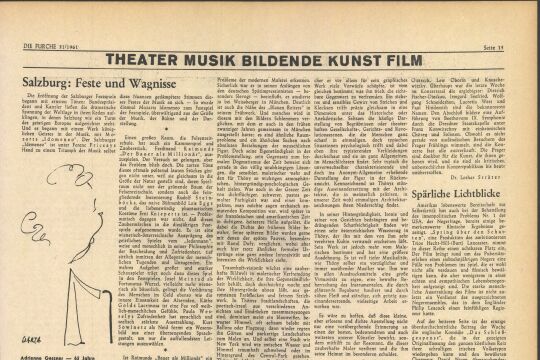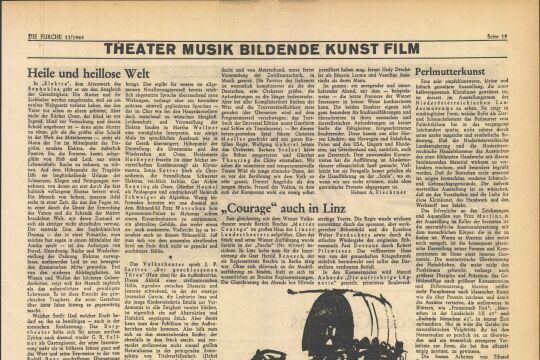Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Berliner Festwochenspiegel
Obwohl die heutige politische Situation noch angespannter ist als vor einem Jahr, finden auch heuer wieder die Berliner Festwochen in gewohnter Reichhaltigkeit statt. Das gilt vor allem auch für die verhältnismäßig große Zahl der dargebotenen neuen Sprechstücke.
Unter den Bühnenwerken aus früherer Zeit wurde die Wiedergabe der Kleist-schen „Penthesilea“ durch die Städtischen Bühnen Frankfurt — Gastspiel im Schiller-Theater — mit besonderer Spannung erwartet, da dieses Stück, trotz gelegentlicher Aufführungen, in weiten Kreisen des Theaters als unspielbar gilt. Selbst der Regisseur der Frankfurter Inszenierung, Heinrich Koch, äußerte sich dahingehend, daß man die „Penthesilea“ bühnenmäßig nicht wirklich voll lösen könne, seine eigene Wiedergabe sei auch nur ein Versuch. Das Problem der Aufführung liege in der Scheidung zwischen Substanz und Beiwerk. Nun, man darf hinzufügen, die größte Schwierigkeit ersteht aus dem Charakter der Titelgestalt, der für uns jenseits einer möglichen psychischen Realität liegt. — Trotz des Monströsen dieser Figur, trotz dramaturgischer Schwächen — die vielen Botenberichte — gelingt es Koch, uns durch die Intensität der Aufführung zu packen. Pausenlos gespielt, dauert die Aufführung durch berechtigt scharfe Striche nur eine Stunde vierzig Minuten. Das Bühnenbild von Franz M e r t z zeigt im Vordergrund immer wieder die „Koch-Platte“, dahinter zwei verschieden hohe Felsen vor schwarzem Himmel. Diese kreisrunde, steinfar-bene Platte erweist ihre wirkungsvolle Funktion besonders in der Szene, in der Penthesilea irrtümlich glaubt, Achilles sei ihr Gefangener: Er steht in der Mitte, sie geht in ihrer Freude im Kreis, der Platte entlang, um ihn herum. So wird das Spiel, besonders auch in der Schlußszene der Penthesilea mit dem toten Achilles, optisch zentriert, Lola Mathel gelang es, das Besessene dieser Gestalt so. weit überzeugend darzustellen, als es sich überhaupt darstellen läßt. Heinz B a u m a n n war ein männlich schlichter Achilles.
In der Reihe der abendfüllenden Sprechstücke gab es nur eine Uraufführung; sie fand im Schiller-Theater statt, und zwar: „Eiche und Angora“, eine „deutsche Chronik“ von Martin Walser. Da wird in zwölf Stationen an einer kleinen Gruppe Menschen von den Tagen des Zusammenbruchs 1945, von stramm-deutscher NS-Haltung bis in den Konformismus der Gegenwart die Wandelbarkeit der Gesinnungen ironisch dargetan. Die Haupt1 gestalt, ein ehemaliger KZ-ler, in den ersten Szenen Hausmeister des Kreiseiters, ist eine Art Schwejk, dessen jeweilige pfiffig dienstbeflissene Unterwürfigkeit witzig mancherlei Sabotage deckt. Unter dem Sinnbild „Eiche“ geht es wider die einst parteigeförderte penetrante Deutschtümelei, das Wort „Angora“ bezieht sich auf Grübeis Angorahasen, deren Felle maßgebliches Requisit der Handlung sind. Das Stück bleibt nun freilich zwischen Satire und Realismus stecken. Der Vorwurf würde die Schärfe Sternheims oder die' des „Untertan“ von Heinrich' Mann erfordern, diese Schärfe fehlt dem Spott. Hiezu kommt, daß die Inszenierung von Helmut K ä u t n t r das Stück nun auch noch völlig ins Gemütliche, Verharmlosende verlagert. So wird in der Aufführung immer wieder gelacht, doch ohne Bitterkeit, sondern wie von Humorigem bewirkt. Nicht die Ansätze zur Satire arbeitet Käutner heraus, sondern das Milieuhafte. Daher verharrt auch das Bühnenbild von H. W. Lenneweit in einem schon etwas peniblen Naturalismus. Horst Bollmann bietet als Gräbel in der Verbindung von Naivität und Pfiffigkeit eine Meisterleistung.
Was man schon vor einem lahr erwartete, davon wird nun in Berlin allenthalben gesprochen: vom neuerlichen Aufkommen einer deutschsprachigen Dramatik. Besondere Hoffnungen setzt man in den 37jährigen Tankred D o r s t. In Wien war bereits sein Einakter „Die Kurve“ zu sehen, der noch Unsicherheit im Einsatz des Ideellen, der Ausdrucksmittel zeigte. Der Einakter „Freiheit für Cle-m e n s“, der in der Vaganten-Bühne mit der „Kurve“ aufgeführt wird, wirkt geschlossener. Die Bitternis unserer Zeit steht im Zeichen des Gitters, der politisch Bedrohten und Gefangenen. Aber Dorst pinselt diese heutige Bitternis bereits als Clownerie vor uns hin, wobei er allerdings das Politische kurzerhand eskamo-tiert: der Gefangenenaufseher ist Harlekin, der Gefangene Pierrot, die Tochter des Aufsehers eine Balletteuse. Daß hier Bewegungsmäßiges ideell entscheidend eingesetzt wird, ordnet das Stück den Bestrebungen in der Richtung „totales Theater“ zu.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!