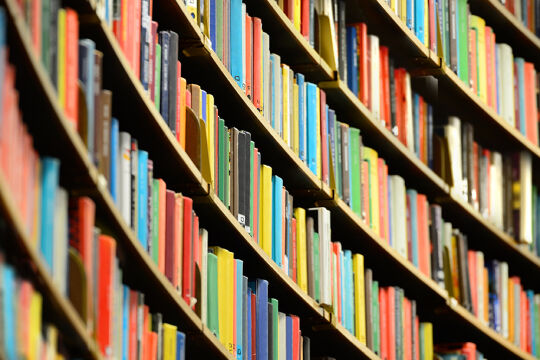Neuseeländische Literatur steht im Mittelpunkt der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Klassiker sind ebenso zu entdecken wie Gegenwartsliteratur.
Es verhält sich keineswegs so, dass mit der Kolonisierung Neuseelands Kultur - und damit auch die Literatur - auf die Insel gekommen wäre. Die Maori überlieferten ihre Mythen und Geschichten in mündlicher Form, damit blieben sie Dokumente einer Selbstverständigung für eine verschworene Gemeinschaft. Die christlichen Missionare zeichneten diese Zeugnisse einer fremden Kultur auf Englisch auf. So bekam der Europäer einen Eindruck davon, dass die Wilden ganz so wild auch wieder nicht waren. Aus der Maori-Sprache wurde bislang noch kein Buch ins Deutsche übersetzt, aber ein Satz wird im Oktober die Runde machen: "He moemo¯ea, he ohorere“ - Bevor es bei Euch hell wird. Er wird als Motto der diesjährigen Frankfurter Buchmesse vorangestellt. Tatsächlich wird man umdenken müssen, wenn man dachte, dass Neuseeland und Literatur nicht zusammenpassen. Die neuseeländische Dependance des PEN-Club weist 1300 Schriftsteller auf, jährlich erscheinen 2000 Titel. Im Verlegerband sind 80 Verlage Mitglied. Bei einer Bevölkerungszahl von vier Millionen wirken diese Zahlen eindrucksvoll.
Europäische Standards
Wie aber ist es bestellt um die Literatur dieser Insel? Mit Katherine Mansfield betrat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine junge Frau fulminant die Szene. Geboren 1888 in Wellington verließ sie im Alter von zwanzig Jahren ihre als viel zu eng empfundene Heimat. Im Alter von 35 Jahren verstarb sie, die schwer an Tbc litt, in Frankreich. Tatsächlich wirkt sie wie eine von uns. Auch wenn ihre Erzählungen in Neuseeland angesiedelt sind, das Milieu der in bürgerlichen Konventionen befangenen, sich um Wohlstand und Behaglichkeit kümmernden weißen Elite verließ sie kaum. Und die orientierte sich an den europäischen Standards, die man zu imitieren trachtete. Diese Gesellschaft war Mansfield als Tochter eines englischen Bankiers vertraut. In Europa pflegte sie Umgang mit den Spitzen der zeitgenössischen Literatur und Geistesgeschichte, mit Virginia Woolf und D. H. Lawrence, Bertrand Russell und Aldous Huxley. Aber gehörte sie je ganz zu ihnen? Woolf beschrieb sie als das "blasse Gespenst mit den festen Augen, den spöttischen Lippen und, gegen Ende, dem Kranz auf ihrem Haar.“ Sie war gefürchtet, als "intrigant und hinterhältig“ beschrieb sie eine Biografin.
Durchdringender Blick
Wir aber haben Glück, dürfen wir uns doch in ihrem einzigartigen Werk umsehen. Fünf schmale Erzählbände hat sie hinterlassen, dazu kommen Briefe und Tagebücher. Das genügt, um in ihr eine der herausragenden Gestalten der Literatur des 20. Jahrhunderts zu erkennen. Sie verfügt über den die Seele durchdringenden Blick, der niemanden verschont. Wen immer sie in den Blick fasst, darf sich schon als zur Strecke gebracht betrachten. So langweilig kann sich eine Gesellschaft gar nicht präsentieren, dass Mansfield nicht sofort ein paar Figuren rauspickt und ihre Schwächen zur Schau stellt. Das hat nie etwas aufdringlich Besserwisserisches, davor bewahrt sie ihre Ironie, die jedem Scheiternden eine Spur von Größe zugesteht. Keine Geste ist zu nebensächlich, keine Einzelheit zu belanglos, als dass sie nicht etwas Besonderes über die Eigenart eines Menschen verraten würde. Ein Mann verlässt am Morgen das Haus, um zur Arbeit zu gehen und mit einem Schlag verbessert sich die Stimmung. Alice, das Dienstmädchen, hält die Teekanne unter Wasser, "gerade als wäre sie ein Mann, und Ertränken wäre noch zu gut für ihn“ ("An der Bucht“). Ohne dass großartige Ereignisse eintreten würden, ohne dass die Menschen Gewaltiges heimsuchen würde, zeigt Mansfield, dass latent Aggression, Wut, Gewalt und all die anderen unangenehm brodelnden Gefühlswässerchen einen in Unruhe versetzen, und nur Konvention, Stil und Etikette verhindern das Ärgste.
Zugegeben, Katherine Mansfield ist eine schwere Vorgabe. Sie hatte höchste Skrupel, ihre Geschichten an die Öffentlichkeit zu entlassen, sie ging unerbittlich mit ihren eigenen Arbeiten um. Wenn sie im Abstand von einiger Zeit dachte, dass ein Erzählband ihren Maßstäben nicht gerecht wurde, ließ sie eine weitere Auflage nicht zu.
Schafft es irgendjemand sonst, diesem hohen Anspruch an Literatur gerecht zu werden? Bei Janet Frame (1924-2004) darf man sich in dieser Hinsicht gut aufgehoben fühlen. In ihren Romanen allerdings geht es heftig zu. An Freundlichkeit ist von ihr nicht viel zu erwarten. Das darf angesichts ihrer Biografie nicht verwundern. Wieder bekommen wir es mit einer unglücklichen Frau zu tun, einer wahren Ikone des Leidens. Ihr eigenes Leben stellte ihr das Material zur Verfügung, aus dem sie, die als Nobelpreis-Kandidatin gehandelt wurde, kraftvoll herrische Literatur schlug. Sie entstammt bedrückenden Familienverhältnissen. Jahrelang wurde sie aufgrund einer falschen Diagnose in einer Nervenheilanstalt mit Elektroschocks gegen Schizophrenie behandelt. Als drei Jahre nach ihrem Tod der Roman "Dem neuen Sommer entgegen“ erschien, kam das einer Sensation gleich. Frame schrieb das Buch 1963 und verstaute es in einer Schublade. Sie dachte, zu viel von sich preiszugeben, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. An Handlung ereignet sich wenig, das eigentliche Geschehen wird ins Innere einer Person verlegt, die mit sich und der Welt nicht zurande kommt. Dabei hätte Grace Grund zum Jubeln. Die junge Schriftstellerin aus Neuseeland wird von einem Kritiker zu einem Besuch in den Norden Englands eingeladen. Sie wird ernst genommen, sie erfährt Aufmerksamkeit, Zuwendung und Ermunterung, alles, was sich eine, die sich als Autorin etablieren will, nur wünschen kann. Ihre eigene Persönlichkeit steht ihr im Weg. Sie fühlt sich fremd im Alltag und verloren unter anderen Menschen. Inmitten freundlicher Personen durchlebt sie die Qual, in ihrem Ich nicht behaust zu sein.
Widerstand im Schreiben
Als Janet Frames eigentliches Hauptwerk gilt der Roman "Ein Engel an meiner Tafel“, berühmt geworden durch die Verfilmung Jane Campions. Hier bewegt sich Frame zurück in die frühen Jahre ihrer schmerzhaften Existenz, gezeichnet von Armut und Schicksalsschlägen. Bei all der Finsternis bricht der Widerstandsgeist einer Gepeinigten durch, die im Schreiben die Energie vorfindet, gegen alle Widrigkeiten bestehen zu können. Die Literatur als rebellische Institution, die den Mächten der Zerstörung einer Person die schöpferische Kraft entgegensetzt, das ist ein schönes Bild für den Aufstand gegen alles Niederziehende.
Als Exportartikel der jüngsten neuseeländischen Literatur haben sich in den letzten Jahren die Romane von Anthony McCarten, Jahrgang 1961, bewährt. Seit er im Jahr 2007 mit seinem todtraurigen Roman "Superhero“ die deutschsprachigen Leser erreichte, sind fünf Bücher erschienen. Er hat keine Angst vor großen Gefühlen, scheut es nicht, sein Publikum zu rühren. Dass er dennoch nicht ins sentimental Kitschige abdriftet, ist dem besonderen Vermögen des Verfassers zugutezuhalten.
Stoffe der Gegenwart
"Superhero“ bringt alle Voraussetzungen mit, zum Rührstück herunterzukommen. Der vierzehnjährige Delpe hat keine Chance. Er ist sterbenskrank und verkriecht sich dennoch nicht ins Unglück. In Comics schafft er sich eine Gegenwelt, und er möchte es ganz genau wissen. Die Sache mit der Liebe reizt ihn. Der Gedanke, von der Welt abzutreten, ohne jemals Glück bei einem Mädchen gehabt zu haben, ist ihm unerträglich. McCarten bedient sich der Form eines Drehbuchs: "Aufblende…DONALD DELPE. Vierzehn. Magerer Junge, Schultern dürr wie ein Kleiderbügel.“ Wie eine Stimme aus dem Off mischt sich ein Erzähler ein, der Donalds Innenleben öffentlich macht. Im jüngsten Roman, "Ganz normale Helden“, sehen wir, wie es mit den krisengeschüttelten Delpes nach dem Tod Donalds weitergeht. Jetzt macht der zweite Sohn, Jeff, nur Probleme. Er verschwindet in den Weiten des World Wide Web, und ob er jemals für die Familie wieder greifbar sein wird, ist ungewiss. Auf Anthony McCarten müssen wir achtgeben. Von ihm ist noch einiges zu erwarten. Ihn müssen wir nicht nur unter die leidenschaftlichen Erzähler einreihen, er beliefert uns mit Stoffen, die unsere Gegenwart unmittelbar berühren. Obendrein ist ihm ein grüblerisches Wesen eigen, das ihn dazu herausfordert, mit der Form seine eigenen Wagnisse anzustellen.
Wovon ist weiters zu berichten? Von David Ballantyne zum Beispiel, der 1969 im Alter von 44 Jahren den Roman "Sydney Bridge Upside Down“ veröffentlichte, dem heute nahezu schon Klassikerstatus zukommt. Ihm ist die Wucht großer Tragödien eigen, die sich mit gnadenloser Unausweichlichkeit über Menschen ergießen, die die Regie über ihr eigenes Leben schon aufgegeben haben. Oder Lloyd Jones, geboren 1955, dessen Roman "Die Frau im blauen Mantel“ uns soeben zugänglich gemacht wurde. Eine junge Frau steht im Mittelpunkt, die es von Nordafrika nach Europa schafft. Geschafft hat sie damit noch gar nichts, denn von nun an beginnt eine Geschichte der Demütigungen und Unterdrückung. Jones gibt jenen, die wir bestenfalls als Massenphänomen kennen, eine individuelle Biografie. Ohne dass er als Ankläger in Erscheinung treten müsste, steigt die europäische Politik allein kraft der Erzählung gar nicht gut aus. Dagegen stellt er ein kampfbereites Individuum, das nicht vorhat, sich aller Einschränkungen und Bevormundungen zum Trotz unterkriegen zu lassen.
Sämtliche Erzählungen
Von Katherine Mansfield Aus dem Englischen von Elisabeth Schnack. Diogenes 2012 523, 376 S., geb., e 45,90
Ein Engel an meiner Tafel
Eine Autobiographie von Janet Frame Übersetzt von Lilian Faschinger C. H. Beck 2012 288 S., geb., e 20,60
Ganz normale Helden
Roman von Anthony McCarten Übersetzt von Gabriele Kempf-Allié und Manfred Allié. Diogenes 2012 453 S., geb., e 23,60
Sydney Bridge Upside Down
Roman von David Ballantyne Übersetzt von Gregor Hens Hoffmann und Campe 2012 333 S., geb., e 20,60
Die Frau im blauen Mantel
Roman von Lloyd Jones Übersetzt von Grete Osterwald Rowohlt 2012 316 S., geb.., e 20,60