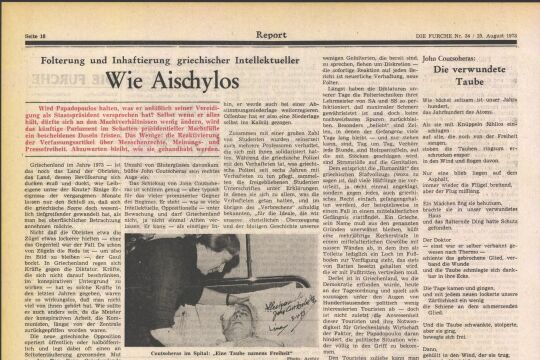Durch Bekenntnis zu den Menchenrechten auf internationaler Ebene hat sich Brasilien das Image eingehandelt, demokratisch zu sein. Tatsächlich herrschen in vielen Bereichen jedoch weiterhin unhaltbare Zustände, vor allem im Strafvollzug, berichtet ein Augenzeuge.
die furche: Sie leben in São Paulo. Können Sie Ihren Wirkungsbereich für unsere Leser charakterisieren?
Günther Zgubic: Zunächst wirkte ich am Aufbau eine Pfarre im gewalttätigsten Stadtteil von São Paulo mit. Hier herrscht größte Armut. Es gibt fast nur Favelas. Mehr als die Hälfte aller im großen Armenfriedhof Begrabenen sind Jugendliche, die durch Gewaltakte ums Leben gekommen sind.
die furche: Wie kommt es zu dieser Gewalttätigkeit im Alltag?
Zgubic: Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit nehmen zu. Es kommt zur Eskalation der Gewalt. Die Familien organisieren sich in Gangs: Ringe, die Autodiebstähle oder Banküberfälle durchführen, mit Drogen oder Waffen handeln. Die Menschen versuchen sich eben durchzuschlagen. Diese allgemein praktizierte Kriminalität füllt die Gefängnisse. Allein im Staat São Paulo gibt es fast 100.000 Gefangene, die Hälfte aller Häftlinge in ganz Brasilien. Und die Zahl steigt rapid, monatlich um 800 bis 1.000 Personen.
die furche: Wie ist die Situation in den Gefängnissen bei solchen Zahlen?
Schrecklich. In Räumen mit zwölf Quadratmetern werden bis zu 30 Menschen monatelang festgehalten, in irregulärer Untersuchungshaft.
die furche: Sprechen Sie da von Ausnahmefällen oder ist das typisch?
Zgubic: Wir haben in der Stadt 100 Polizei-Gefängnisse, wo die Menschen so, wie geschildert, über Monate zusammengepfercht leben. Aber es kann auch Jahre dauern. Oft schlafen sie im Klo oder bei der "Dusche", einem Loch, aus dem dauernd Wasser rinnt und alles nass macht. Wer nachts aufs Klo muss, steigt auf die anderen. Fürchterliche Zustände! Viele haben Tuberkulose, Aids. Es gibt eine enorme Ansteckung. Und sagenhaft ist, was sich an Gewalt unter den Insassen tut.
die furche: Müssen Verhaftete nicht dem Richter vorgeführt werden?
Zgubic: Ja, spätestens nach drei Monaten müsste ein Urteil gefällt worden sein. Tatsächlich ist diese Frist aber mindestens doppelt so lang. Die Gefängnis-Seelsorge hat verschiedene Untersuchungen gemacht und eine Dokumentation über die Lage der Dinge zusammengestellt, die 1998 auch der UNO übergeben worden ist. "Amnesty international" hat die Frage aufgegriffen, "Human Right Watch" hat sich eingeschaltet. Beide haben einen Bericht über die Lage in den Gefängnissen erarbeitet. Im Vorjahr hat sich Mary Robinson, die UN-Kommissarin für Menschenrechte, die Lage vor Ort angeschaut und ich konnte ihr berichten.
die furche: Und was ist außer dem dichten Besatz zu kritisieren?
Zgubic: Die trostlose soziale Lage führt dazu, dass die aus dem Gefängnis Entlassenen sich sofort verbrecherischen Organisationen anschließen. Außerdem gibt es keine Alternativen Strafmaßnahmen zum Gefängnis, etwa dass man durch Gemeinschaftsdienste eine Wiedergutmachung leistet. Es fehlt auch die Möglichkeit, auf freiem Fuß auf seinen Prozess zu warten. Außerdem führt bei uns ausschließlich die Polizei die Untersuchungen durch - eine Art Inquisitionsverfahren. Auf dieses stützen sich dann Richter und Staatsanwalt. Da in dem Verfahren weder Rechts-, noch Staatsanwalt eingeschaltet sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Folterungen kommt, ganz enorm. Die Merkmale sind also: Überbelegung, mangelnde Gesundheitsversorgung, Unregelmäßigkeiten im Strafvollzug, zu wenig Richter und zu viel Macht für die Polizei. Und dann kommt es eben zu Gefängnisaufständen.
die furche: Was spielt sich bei solchen Aufständen ab?
Zgubic: Am 28. Februar kam es heuer zu einer Megarebellion in den Gefängnissen. 30.000 Häftlinge haben zur selben Stunde Aufstand gemacht. Das war von einer mächtigen Gang organisiert. Aber es kann auch ganz anders verlaufen: November 1998 im 3. Polizeibezirk, ein Tuberkulosekranker, der schon nicht mehr gehen konnte, wird von der an sich ausgezeichneten Polizeidirektion schon zum 20. Mal zum Gesundheitsposten geführt. Der Arzt verweigert Medikamente. Sie würden nur zur Immunisierung der Krankheitserreger in diesem durchseuchten Umfeld führen. Man müsse den Patienten im Krankenhaus behandeln. Dort ist aber die Lage so katastrophal, dass man ihn nicht aufnimmt. Man trägt ihn also ins Gefängnis zurück und legt ihn vor das Gitter der überfüllten Zelle. Als die Gefangenen um zwei Uhr morgens merken, dass er im Sterben liegt, machen sie Lärm, um Hilfe herbeizurufen. Sie schreien und schlagen an die Gitter. Ohne nachzufragen, alarmiert der diensthabende Offizier die Sondereinheit. Sie trampelt über den Sterbenden hinweg und prügelt alles in der Umgebung nieder. Es wird geschossen und alles, was die Gefangenen mithaben (Radios, Dokumente...) wird zerstört. Die Botschaft: Wenn Ihr den Mund aufmacht, dann soll es das letzte Mal sein.
die furche: Sie sagten aber, das sei ein besonders gutes Revier gewesen ...
Zgubic: Der tagsüber verantwortliche Offizier, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, wurde leider nicht verständigt, obwohl er zuständig gewesen wäre. Es gibt eben schwerste Unregelmäßigkeiten im Strafvollzug.
die furche: Kann man unter diesen Verhältnissen missionarisch wirken?
Zgubic: Wir stehen da vor der Frage: Wie kann man Christ sein? Ich versuche auf die Leute zuzugehen und frage zuerst: Wie geht es euch? Indem sich die Menschen aussprechen, spüren sie, dass da jemand ist, der ihnen zuhört. Hier kommt Glaube und Gesellschaftsaufbau in eins. Jesus hat mit den Armen und Unterdrückten gelebt. Sie haben sich bei ihm zu Hause gefühlt, weil er nicht moralisierend über sie hergefallen ist. So können die Menschen erfahren: Wenigstens bei Gott werden wir gehört. Ich habe noch nie so oft das Wort Gott gehört wie im Gefängnis. Wenn sie mir von ihrem Elend erzählen, dann beten wir zum Schluss miteinander. Die Menschen beten ja unglaublich gerne. Sei schreien ihre ganze Verzweiflung hinaus, legen sie in die Hand Gottes und bitten um ein Licht, einen Segen ... Ich versuche es aber nicht bei dem zu lassen. Ich stelle immer die Frage: Was wollt ihr machen? Und: Wie können wir es machen?
die furche: Und was kommt da heraus?
Zgubic: Ich erzähle Ihnen, was geschah, als ich das erste Mal Gefolterte sah: Ein dunkler, hermetisch abgesperrter Gang, in 40 Zellen blutüberströmte Menschen. Ich frage: "Was war da los?" - "Eine bestimmte Nachtschicht, meist betrunken, kommt herein, öffnet eine Zelle und fällt mit Eisenstangen über uns her." Ich melde das dem Direktor. Verlegen bittet er um Entschuldigung. Es wird nicht mehr vorkommen. Als ich das nächste Mal dort bin, dasselbe Bild: Blutergüsse, offene Platzwunden ... Was war geschehen? Einem war in der Nacht schlecht geworden. Man ruft um Hilfe, es kommen mit Eisenstangen bewaffnete Wärter. Was los sei? Einer brauche Beistand. Sie öffnen die Zelle, verprügelen alle - auch in den anderen Zellen. Als ich das hörte, wusste ich: Mit der Leitung dieses Gefängnisses - mit 7.000 Häftlingen das größte in Lateinamerika - verliere ich kein Wort mehr. Was tun wir? Die Gefangenen trauen sich nicht, sich durch Anzeigen zu exponieren, hatten damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich schlage vor: Wir treten gemeinsam an die Öffentlichkeit, berichten, was da jede zweite Nacht passiert. Für mich ist klar: Wenn ich jetzt nicht helfe, kann ich nie wieder zurückkommen, nie mehr vom Evangelium reden, von der Liebe Gottes. Jetzt geht es um alles. Was mich gerettet hat, war die Frage, ob ich bereit war, in diesen Menschen - darunter auch schwerste Kriminelle - meine Brüder zu sehen, für sie mein Leben zu riskieren? Mir fielen die Wandlungsworte ein: Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. Bin ich bereit, das, was ich täglich spreche, hier existenziell zu praktizieren?
Meine Entscheidung, mich für die Männer einzusetzen, hieß nämlich, mich dem Tod auszusetzen. Wenn ich das anzeige, weiß ich nicht ob und wann ich niedergemacht werde. Vielleicht aber passiert auch nichts.
die furche: Und wie ist die Sache ausgegangen?
Zgubic: An einem strahlenden Sonntag ging ich - nachdem ich die gemeinsam geschilderten Ereignisse angezeigt hatte - in das Gefängnis. Als ich zu dem Pavillon mit der Folterabteilung komme, sehe ich die Gefangenen. Sie stehen hinter Gittern, aber in einem Gang in der Nähe des Eingangs. Sie brechen in einen Jubelschrei aus. Mir war klar: Die Anzeigen hatten Erfolg gehabt. Mittlerweile ist die Folterabteilung geschlossen. Tausende Gefangene haben Hoffnung geschöpft.
Das Gespräch führte
Christof Gaspari.
Zur Person: Ein Leben für Prostituierte, Aidskranke und Kriminelle
Geboren ist Günther Alois Zgubic am 17. Oktober 1949 in Pöls, in der Steiermark. In den Jahren 1960 bis 1968 besuchte er das Akademische Gymnasium in Graz. Danach studierte er in den Jahren bis 1976 Theologie und Philosophie in Rom und Innsbruck. 1975 wurde Zgubic zum Priester geweiht und wirkte bis 1976 im Priesterseminar in Graz. Es folgten vier Jahre als Kaplan in der Pfarre Bad Radkersburg und weitere acht Jahre in der Pfarre Weiz.
Ab 1988 trat er in den Dienst der Erzdiözese São Paulo in Brasilien. Dort wirkte er bis Ende 1994 als Pfarrer am Aufbau der Gemeinde Capao Redondo/Jardim Angela, Campo Limpo mit. Von 1995 bis 1997 teilte er das Leben Obdachloser in einer Baracke im Zentrum von São Paulo und widmete sich der Betreuung Aids-Kranker und Prostituierter. Seit 1997 ist er in der Gefängnispastoral der Erzdiözese tätig und ist Mitbegründer der brasilianischen Sektion der "Aktion von Christen zur Abschaffung der Folter" und des "Menschenrechtsforums São Paulo" zur Frage von Folterungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!