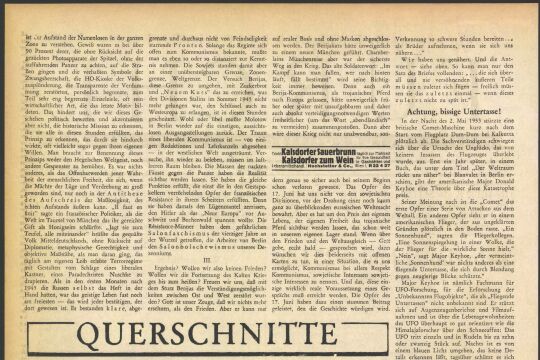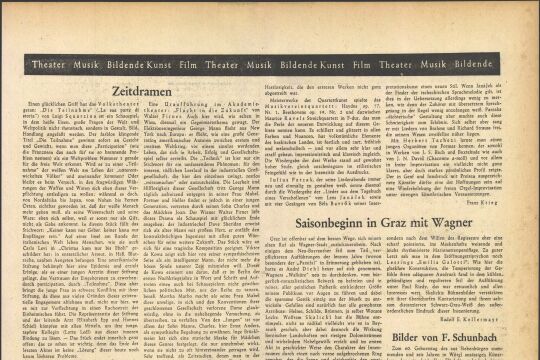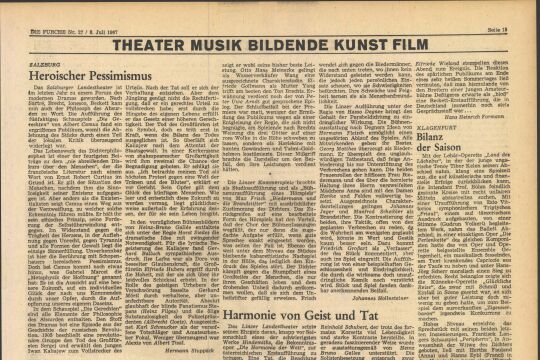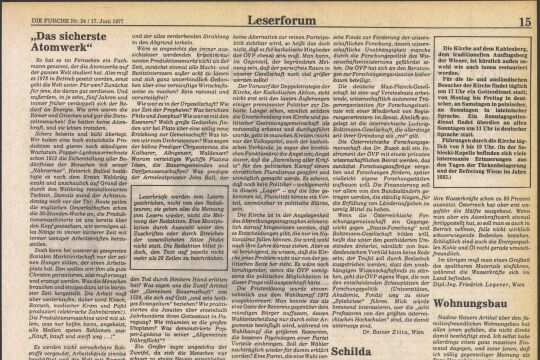Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Güte und die Machtgier
Die Puritaner halten sich für Auserwählte, es geht ihnen gut, weil sie gut sind. Wer schlecht ist, den straft Gott, ihrer Meinung nach, durch Armut. Dem entgegen ist Bertolt Brecht in seinem Parabelstück „Der gute Mensch von Sezuan“, das derzeit im Volkstheater aufgeführt wird, der Ansicht, daß im Leben scheitert, wer die Gebote der Nächstenliebe befolgt.
Drei Götter wollen erkunden, ob ein guter Mensch zu finden ist, der ein menschenwürdiges Dasein führen kann. Die Dirne Shen Te verkauft sich, um leben zu können, als sie aber drei Unterkunft suchende- Götter, die von allen abgewiesen wurden, beherbergt, erhält sie von ihnen so viel Geld, daß sie sich einen Tabakladen kaufen kann. Da nun zeigt sich der Schematisierer Brecht mit geradezu berserkerhafter Lust am Werk, darzutun, daß Shen Te in ihrer Gutherzigkeit von Schmarotzern ausgesogen wird, dadurch in Bedrängnis kommt, und nur wenn sie, in Maske als ihr hartherziger Vetter Shui Ta auftretend, rücksichtslos handelt, geht es ihr wieder besser. Das wird uns mit Holzhammermethode vorgeführt, damit wir Einfältigen es nur ja kapieren.
Ist das eine Anklage gegen unsoziale Zustände, die zu verändern sind? Brecht, der entgegen den Dramatikern unseres Jahrhunderts die direkte Aussage nicht nur nicht meidet, sondern sie einem meist brutal ins Gesicht schleudert, verharrt hier bis zum Schluß bei der Anfangsthese, daß das Gutsein ins Elend führe. Shen Te sagt da noch: „Wer den Verlorenen hilft, ist selbst verloren!“ Klagt also Brecht die metaphysischen Mächte, die Götter an? Sie werden als unbeholfen, ratlos, in dem ernsten Stück fast als Possenfiguren dargestellt. Nun fordert der Epilog den Zuschauer dazu auf, selbst nachzudenken, wie man dem guten Menschen „zu einem guten Ende helfen kann“. Die Katze ist aus dem Sack. Der Dümmste muß sich nun sagen: Wir müssen die Verhältnisse ändern, :nn es die Götter nicht vermögen. Der Rationalist, der Zweckdenker Brecht sieht nur das eine Extrem des ins Elend geratenden Guten, er ist überzeugt, daß Änderungen die Erde _ in ein Paradiesyerwahäei .. tiie Geheimnisse deS Lebens' sind den'schematischen Vorstellungen Brechts verschlossen.
Das unentwegt Lehrhafte der Geschehnisse und Songs wirkt ermüdend, so ist es berechtigt, daß Gustav Manker als Regisseur die zahlreichen Zwischenspiele mit den
Göttern nicht vorführt. Den Brecht- schen Zeigestab läßt er möglichst wenig wirksam werden. Georg Schmid teilt die Bühne sehr effektvoll in einen flach sich hindehnenden Spielbereich und darüber einen flachen Streifen Projektionen: Assoziation an die Weite Chinas. Jutta Schwarz bietet als Shen Te eine bemerkenswerte Leistung, Ausstrahlung fehlt. Eugen Stark übersteigert den Wasserverkäufer Wang komödiantisch, Bernhard Hall gibt dem Sun, dem Geliebten der Shen Te, das kraß Egoistische. Eindrucksvoll gerät die Darstellung der Götter und der Schmarotzer. Die Musik von Paul Dessau ist zuwenig konturiert und reicht an Brechts ersten Komponisten, Kurt Weill, nicht heran.
Im Theater im Palais Erzherzog Karl gelangte das Dreipersonenstück „Finale“ des 48jährigen Tschechen Dalibor Plichta zur Uraufführung, das verschlüsselt die Zustände in einer Diktatur angreift. Der Autor unterlegt seinen Szenen Schemata von Beckett, es gibt einen als „Person“ bezeichneten Mann im Lehnstuhl, um ihn herum schreitet sein Gehilfe wie im „Endspiel“ und es wird auf einen Geheimnisvollen gewartet wie in „Godot“, der diesmal allerdings kommt. Die „Person“ trägt Maske, es 1st der Oberbefehlshaber, der Gehilfe, ein Trommler, wirkt als Propagandist, der letzteigentlich alles bestimmt. Als der Erwartete, ein Friseur, erscheint, nimmt er an der Frisur der „Person“ nur winzige Veränderungen vor. Ein bißchen nach links, ein bißchen nach rechts, alles so sein lassen wie es ist, erklärt er. Wir verstehen. Schließlich taucht ein zweiter Mann mit gleicher Maske auf, der den ersten Maskenmann verdrängt und nun selbst im Lehnstuhl sitzt. Nichts ändert sich.
In diesem Spiel ist alles Anspielung, es gibt keinen direkten Angriff, dennoch wirkt fast jeder Satz als bissige Ironie, als Hohn auf die politischen Machenschaften eines Totalitärstaats, vor allem auf die entlarvende Widersprüchigkeit großmäuliger Parolen, auf die Methoden, sich mit allen Mitteln an der Macht zu halten. Was dunkel bleibt, dient - wohl zur .Tarnung vor dem Zugriff ' des Zensors, pfeffliche. Aufführung unter der Regie von Paris Kasmidis mit Florentin Groll als Trommler, mit Bertram Mödlagl und Andrė Miriflor wechselnd als „Person“ und als Friseur. Es ist zweifellos ein Verdienst des Schauspielers Oskar Wülner, dieses Stück übersetzt zu haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!