
Im Gesang der Engel und ihrer Frohen Botschaft an die Hirten Bethlehems ist mit der Zeit eine Dissonanz eingetreten, die sich jedes Jahr
zur Weihnachtszeit immer wieder bemerkbar
macht und feinbesaitete Christen unangenehm berührt. Es sagt sich von selbst, die Engel trifft keine Schuld. Die Schuld liegt einzig ilnd allein bei ihren Dolmetschern, den Bibelübersetzern, die hier, wie so oft bei der Uebertragung zugleich, ein wenig transponiert haben. So ist es gekommen, daß wir nun einmal hören: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind“, und ein anderes Mal: „ . . . und Friede den Menschen von Gottes Wohlgefallen“. Ja, in manchen Bibelausgaben nach der Luther-Uebersetzung gibt es noch eine dritte Version: „Ehre sei Gott in der Höhe / Friede auf Erden / Den Menschen ein Wohlgefallen.“
Die neulich in der Wüste Judas entdeckten Texte versetzen uns nun in die glückliche Lage, diese inveterierte Dissonanz zu beseitigen und die Weihnachtsbotschaft in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen.
Bei der Intonation herrscht bei allen Ueber-setzern die schönste Harmonie. Erst beim „Frieden auf Erden“ meldet sich der Mißton. Dennoch dürfte auch beim Anstimmen schon ein Mangel festgestellt werden. Hier hat nämlich bei der Uebertragung ins Deutsche der ursprüngliche Ton an Fülle und Vollklang eingebüßt. Rein phonetisch hat unser Wort „Ehre“ — wie von Georg Molin anläßlich der Qumran-Texte mit Recht hervorgehoben wurde — eine weit blassere Tonfarbe als das entsprechende hebräische Wort kabod (langes „o“). Das lateinische „gloria“ kommt in dieser Hinsicht dem Original näher. Schlimmer ist es um den Begriff bestellt. Dieser leidet unter der allgemeinen Proletarisierung. Der Begriff „Ehre“ wird unter uns tagtäglich zerknüllt, wenn man bedenkt, wie mit „auf Ehrenwort“ und „Habe die Ehre“ herumgeworfen wird. Vielleicht wäre daher der Ausdruck „Herrlichkeit“ hier besser am Platze, obwohl es um die Herrlichkeit auch nicht viel besser bestellt ist. Sind doch . die Herren aus der Höhe allmählich in die demokratische Ebene heruntergestiegen und haben somit ihre Glorie — ihre Herr lichkeit — hinter sich gelassen. Wird doch heutzutage jeder beliebige dahergelaufene Fremde, wenn er auch nur einen halbwegs weißen Kragen und eine billige Krawatte trägt, mangels eines richtigen Titels, mit „Herr“ angesprochen. Das war anders, als man sich in der Umgebung eines Kaisers Domitian über seine Anmaßung entsetzte, als er sich in den Staatsakten den Titel „lcyrios“ beilegen ließ. Und als ein Paulus, mit Hinblick auf den in der Provinz schon eher propagierten Kaiserkult, das Alleinrecht der Herrn titulatur für Jesus Christus vindizierte, I Korinther 8, 5—6, Ja, das waren andere Zeiten für die Begriffe Herr, Herrschaft und Herrlichkeit. Schade, daß man nicht rechtzeitig auf dem Gebiet der Sprache einen Denkmalschutz ins Leben gerufen hat, um der Verschandelung hochwertiger Begriffe vorzubeugen. Nun gibt es keinen anderen Ausweg als die Flucht ins Archaische. So greift man heutzutage gern auf das griechische Wort „kyrios“ zurück, wenn von der Gottheit Jesu die Rede ist. Vielleicht müßte man auch von der kabod Jahwes sprechen, um nachzuempfinden, was Israel und Urchristentum beim Erwähnen der Herrlichkeit Gottes empfunden haben. Hieß es doch im Alten Bund: Keiner kann Gott sehen, ohne daran zu sterben. Und nach seiner Begegnung mit Jahwe am Sinai war die Stirn des Moses dermaßen leuchtend, daß die Kinder Israels dessen Glanz, den Wiederschein der kabod Jahwes, nicht auszuhalten vermochten. Eine solche Ehre-Herrlichkeit gebührt Gott in der Höhe!
Und nun zum zweiten Teil unseres Distichons. Distichon: denn die Lesart Luthers, nach der unser Text in drei Glieder aufzuteilen wäre, ist textkritisch so schwach bezeugt, daß sie hier außer acht gelassen werden kann. Es bietet sich die Weihnachtsbotschaft in einem Satz dar, der nach dem der hebräischen Lyrik eigenen par-allelismus membrorum in zwei gleiche Teile zerfällt. Gegenüber der dominierenden Herrlichkeit Gottes in der höchsten Höhe, wird hier nach der Art eines Kontrapunktes der Friede der Menschen angekündigt. Hier ganz am Schlu£ geschieht es dann, daß der Zwiespalt in der Uebersetzungen zutage tritt. An welche Adress ist der Friede von Gott unter den Menscher gerichtet? Sind es die Menschen, die guter Willens sind? Oder die Erdenbewohner, dii
Ge genstand des göttlichen Wohlgefallens sind?
Unter den vier Evangelisten ist Lukas der einzige, der uns über die Geburt Jesu und das anschließende Intermezzo auf dem Hirtenfeld bei Bethlehem einen Bericht hinterlassen hat. Parallelen aus den übrigen Evangelien scheiden demnach in diesem Falle aus. In dem lukanischen Bericht nun Werden die Menschen, denen der Friede angesagt wird, mit einem Wort spezifiziert: es sind die Menschen der e u d o k i a. Eudokia heißt wörtlich: gute, freundliche Gesinnung. Es bleibt nur die Frage, wessen Gesinnung hier beabsichtigt wird. Ist es Gottes gnädige oder der Menschen folgsame Gesinnung? Rein .sprachlich sind beide Deutungen gleicherweise berechtigt. In solchen Fällen empfiehlt es sich, analoge Schriftstellen zu Rate zu ziehen. Schriftstellen, in denen das gleiche Wort vorkommt, gibt es genug im Neuen Testament, doch sie geben hier keinen Ausschlag, da in diesen verschiedenen Stellen einmal dies, einmal 'jenes gemeint ist. Somit war es den Exegeten und Bibelübersetzern bisher überlassen, je nach eigenem Gutdünken eine Wahl zu treffen. Der eine hielt sich dabei an das durch die altehrwürdige lateinische Vulgata verbreitete und in der römischen Liturgie seit eh und je eingebürgerte „hominibus bonae voluntatis“. Andere dagegen — und unter den modernen Ueber-
setzern, die unmittelbar aus der Grundsprache übertragen, allmählich eine überwiegende Mehrzahl — bevorzugen es, in diesem Falle die zuvorkommende göttliche Huld hervorzuheben.
Diese letzte Version hat nun neuerdings von unerwarteter Seite Schützenhilfe bekommen, und zwar aus den in der Wüste Judas entdeckten alten Handschriften. Unter den dort aufgefundenen Leder- und Papyrusrollen befanden sich auch ein paar zusammengelegte Blätter, die eine Sammlung Hymnen enthielten. In einem dieser Lobgesänge kommt der Ausdruck b e n e r e s o n o, das heißt Söhne oder Kinder seines Wohlgefallens, vor. Um das Gewicht dieser Stelle für unsere Weihnachtsbotschaft zu bemessen, soll man bedenken, daß diese ganze, in Höhlen am Ufer des Toten Meeres gefundene Literatur einer jüdischen Sekte entstammt, die bei dem jetzigen Ort Qumram südlich von Jericho ihren Sitz hatte, und zwar vom ersten Jahrhundert vor bis Ende des 1. Jahrhunderts nach Christi. Wichtiger jedoch als die geographische und chronologische Nachbarschaft ist die. enge religiöse Verwandtschaft zwischen den Anhängern der Qumram-Sekte und den ersten Jüngern Jesu. Wie aus den bisher veröffentlichten Schriften hervorgeht, handelt es sich nämlich um durchweg orthodoxe Juden, die sowohl dem jüdischen Priestertum wie dem Pharisäertum nahestanden, wenn sie sich auch geflissentlich von beiden distanzierten. Die Priesterschaft Jerusalems war ihnen zu sehr verweltlicht. Von den Pharisäern unterschieden sich diese Schismatiker durch eine strengere Auffassung der Sabbat- und Reinlichkeitsvorschriften. Auch herrschte in ihren Kreisen strenge klösterliche Zucht. Wie eine Art vorchristliche Benediktiner oblagen sie der Arbeit
und dem Gebet. Jüdische Idealisten waren es, die unter der Führung eines „Lehrers der Gerechtigkeit“ aus allen Kräften dem Reiche Gottes Vorschub zu leisten suchten.
Auf Grund eines eingehenden Vergleiches zwischen dem Neuen Testament und den Qumram-Schriften ist Georg M o 1 i n zu folgender Ueberzeugung gekommen: „Man kann
ruhig mit Kuhn von einer .überraschenden Aehnlichkeit' sprechen und ihm recht geben, wenn er meint, die Schriften der Sekte stünden zeitlich und sachlich der Zeit Jesu und der Entstehung des Urchristentums so unmittelbar nahe wie sonst keine bisher bekannte Schrift“ (Die Söhne des Lichtes, Wien 1954, S. 176). Ja, der gleiche Verfasser scheut sich nicht, die Hypothese aufzustellen, daß der Apostel Johannes, sein Vater Zebedeus und die übrigen Fischer-Apostel einst Mitglieder dieser jüdischen Qumram-Genossenschaft gewesen seien. Weniger gewagt dürfte es sein, sich vorzustellen, daß die frommen Hirten aus der Bethlehemgegcnd mit der Qumram-Gemeinde in Fühlung gestanden sind. Allenfalls werden sie bei Gelegenheit im Mutterhaus in Qumram ihre Einkehr genommen oder bei den in den süd-
liehen Höhlen weilenden Einsiedlern Unterstand gefunden haben. Dabei werden es die „Heiligen der. letzten Tage“ kaum unterlassen haben, diese einfachen Seelen für ihr Frömmigkeitsideal zu gewinnen. Genau so hielt ja auch der Wüstenprediger Johannes in der gleichen Gegend seine Predigten für Söldner und Soldaten. Oben genannte Hymnen nun atmen einen gewissen Pessimismus in der Beurteilung des Menschen. „Ich aber“, so heißt es dort, „weiß wohl, daß beim Menschen keine Gerechtigkeit ist und beim Sohn des Menschen keine Vollkommenheit des Weges.“ Demgegenüber wird die alles beherrschende Allmacht Gottes stark hervorgehoben. „Bei Gott, dem Allerhöchsten, sind alle Werke der Gerechtigkeit, der Weg des Menschen dagegen ist nicht beständig, es sei derin durch den Geist des göttlichen Instinkts. An ihm liegt es, den Weg des Menschen zu vervollkommnen, damit alle seine Werke erkennen, welche Kraft seiner Macht zustande gekommen sind und seine Barmherzigkeit über alle die Söhne seines Wohlgefallens.“ Es ist dies nicht die einzige Stelle, wo in den Texten von Qumram das dem griechischen eudokia entsprechende hebräische Wort r a s o n vorkommt. Besonders in den Statuten des Ordens kommt der gleiche Ausdruck wiederholt vor und zwar im Sinne des göttlichen Gefallens, der g ö 11-lichen Huld in bezug auf die Söhne des Lichtes, das sind ja gerade jene, die Gott kraft seines liebevollen Ratschlusses auserwählt hat.
Noch näher rücken wir dann an die Weihnachtsbotschaft heran, wenn nun auch, wie es hier der Fall ist, dieses göttliche Wohlgefallen als die Urquelle des Friedens dargestellt wird. Denn den Söhnen seines Wohlgefallens wird der Herr seinen überreichen Frieden schenken, und zwar dann, wenn die jetzigen Zeiten des Belial, das sind böse Zeiten für die Kinder des Lichtes, vorüber sein werden und die „Zeiten des Friedens“ heranbrechen.
Somit erscheint im Lichte des aufsehenerregenden Handschriftenfundes am Toten Meer die weihnachtliche Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Felde bei Bethlehem als die Antwort auf eine bestimmte, unter dem frommen Volke lebende Erwartung. Kein Wunder, wenn die Antwort von oben in genau die gleichen Worte gekleidet wurde, worin auch die Bitte ihren Ausdruck gefunden hatte:
Verherrlichung (sei) Gott in der höchsten Höhe,
Und auf Erden Friede den Menschen seiner
Huld!


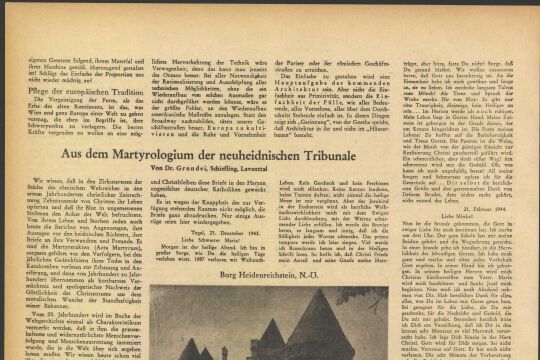



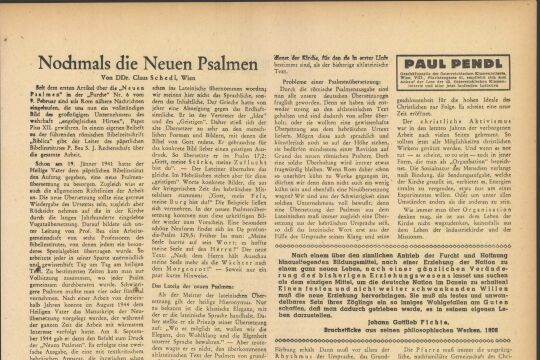








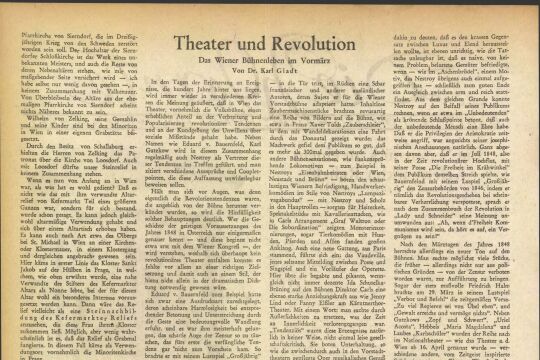



















.jpg)















































.jpg)











