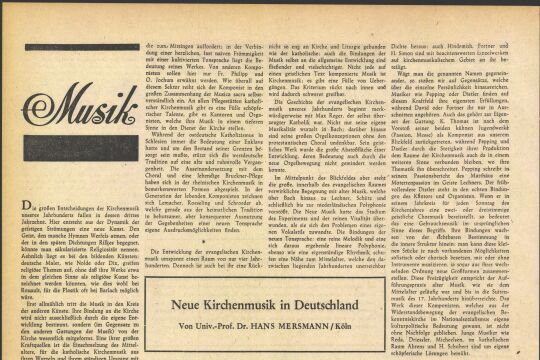Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
HEILMITTEL ODER RAUSCHGIFT?
Die psychologische Wirkung der Musik auf den Menschen ist bekannt. Schon das Alte Testament erzählt vom Harfenspiel, mit dem der junge David die Melancholie König Sauls vertrieb (1. Könige 16, 16 und 23). Unter den Werken Johann Sebastian Bachs befinden sich die „Goldberg-Variationen“, geschrieben für Greif Kayserling, der sich vom Spiel seines Cembalisten Goldberg eine Linderung für schlaflose Nächte erhoffte. Daß die Musik aber nicht nur beruhigen, sondern auch „aufregen“ kann, beweisen die Exzesse Jugendlicher nach Jazzkonzerten. Unsere Zeit weiß davon ein Lied zu singen, von zerstörten Klavieren, Sesseln, Polizeiaufgeboten und nachfolgenden Gerichtsverhandlungen. Hierin offenbart sich eine verhängnisvolle Steigerung: Musik als Freude zur „Bewegung“ führt in den Auswüchsen zur Bewegung als „Betäubung“', als „Rausch“, und das Gift, das dies bewirkt, heißt „Musik“, genauer gesagt; Rhythmus und Klang. Das muß jedoch nicht so sein, die Musik Wird dazu „hineingesteigert", mißbraucht als „Rauschgift“.
Die in der Kunst der Töne Verborgen liegenden, auf den Menschen wirkenden Kräfte hat sich die moderne Heilkunde zunutze gemacht: sie setzt die Musik ein, um zu „heilen“. Die „Musikheilkunde“ (Musiktherapie) hat seit über einem Jahrzehnt Platz gefunden in der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst und hat in diesem Zeitraum eine rege Tätigkeit entfaltet, die auf beachtliche Erfolge hinweisen kann.
Musik als Heilmittel, das bedeutet eine ausdrückliche Betonung der in dieser Kunst liegenden seelischen Kräfte, eine Musik-„Anschauung“ und Musik-„Verwendung“, die es verdient, daß man dazu einige Überlegungen anstellt. Es handelt sich dabei einerseits um Gedanken, die selbstverständlich anmuten (aber gerade das Selbstverständliche kann nicht oft genug gesagt werden), anderseits aber um Ereignisse aus unserem täglichen Leben, an denen die meisten Menschen gedankenlos Vorbeigehen.
Musik kann Heilmittel sein, sie wird aber oft nur als „Rauschgift“ verwendet. Klingt dieser. Gegensatz nicht überspitzt, wenigstens in seiner zweiten Komponente? Man muß leider sagen „keineswegs“, denn auf welche Weise die Musik heute in unserem täglichen Leben „aufscheint“ — von Oper, Konzert, Kammer- und Schulmusik soll hier nicht gehandelt werden —, das spottet oft jeder Beschreibung und verursacht Unbehagen, ja Ärgernis.
Unser Jahrhundert verbraucht ungeheure „Quantitäten" an Musik. Die Rundfunkstationen in aller Welt versenden sie „tonnenweise“, und die „Konsumenten“ an den Radio- und Transistorgeräten verwenden sie oft und oft in der unsinnigsten Weise. Gewiß, dafür trifft weder den Rundfunk noch die Radioindustrie ein Vorwurf, sie sorgen dafür, daß die Musik da ist, gesendet und empfangen wird. Dank unserer hochstehenden Technik ist der Empfang so, . daß er nicht mehr als „Surrogat“ empfunden wird, sondern als fast vollwertiges künstlerisches Erlebnis, gleich der Schallplatte und dem Tonband, die nicht mehr „Konservenmusik“ mit unangenehmen Nebengeräuschen, sondern reine, unverzerrte Töne bieten.
Was macht daraus aber die Menschheit? Einem Großteil von ihr sind diese Darbietungen nur noch „Geräuschkulisse“, nicht mehr Musik, wobei es gleichgültig ist, ob es sich dabei um ernste oder Unterhaltungsmusik handelt. Einige dem täglichen Leben entnommene Beispiele mögen dies verdeutlichen. Man kommt in eine Küche; die hier zu vernehmenden Geräusche deuten auf zielbewußte Zurichtung einer Mahlzeit, dazu ertönen aus dem kleinen grauen Transistorgerät Opemarien, die doch von ihrem Komponisten bestimmt nicht für solche Gelegenheiten gedacht waren. Im Badezimmer mischen sich die Klänge einer Bauernkapelle oder die Stimme eines Vortragenden mit dem Wasserrauschen einer Dusche. Vollends unterhaltsam aber wird die Sache, wenn zu einem elektrischen Rasierapparat, dessen „Betriebseigenton" etwa g mit der deutlich hörbaren Dezime h1 ist, Tanzmusik ertönt, die in E-Dur steht. Dem „hörenden“' Menschen (im Sinne Hans Kaysers) sträuben sich bei dem Gegensatz von g und gis die Haare, wogegen es dem Elektrorasierenden gar nichts ausmacht, er „hört“ die Musik nicht! — Der Mensch unserer Tage nimmt bei allen diesen Gelegenheiten die Musik nicht mehr als „Kunst“ entgegen, sondern als „Stimulans“. Der Rhythmus ist es, der ihm als „treibendes“ Element willkommen ist, als eine „Droge“, die ihm helfen soll, flotter und rascher zu arbeiten (etwa so, wie Marschmusik das Marschieren erleichtert), die ihm dafür aber auch den „Verlust der Stille“ beschert.
"Tver Mensch verliert die Stille, mehr noch, er verliert die Freude am Stillsein der ihn umgebenden Natur, er braucht „Bewegung“ um sich, es soll sich etwas rühren, denn er muß ja „schaffen“, die „schöpferische Pause“ kennt er nicht. Das hat natürlich keinen Bezug auf den einsamen oder kranken Menschen, der sich damit seine ihn oft beängstigende Stille gliedern und mit Erlebnissen „erfüllen" kann. Wie soll der „moderne“ Mensch dm übrigen die Stille an sich erfahren, wenn er selbst in seiner Wohnung die naturgemäß nicht abwendbaren Geräusche des Straßenverkehrs mit quietschenden Autobusbremsen usw. und die noch schrecklicheren der Preßluftbohrer und sonstiger Baumaschinen hört? Nicht jeder kann zwischen Gärten am Stadtrand leben. Eine Straßendecke, das wissen wir, ist bald aufgerissen, denn auszübes- sem gibt es immer etwas, gelegentlich mehrmals hintereinander. Wie sagt doch Weinheber: „War net Wien, wann net durt, Wo ka Gfrett is, ans wurt.“
Dieses „Gfrett“ in der akustischen Sphäre unseres Lebens verursachen aber die Menschen selber. Man braucht nur während eines Waldspazierganges, bei dem man sich an allen Schönheiten der Natur erfreut, Menschen begegnen, die ein Transistorgerät in voller Tätigkeit bei sich tragen. Sie schlenkern es in den Händen und denken gar nicht daran, daß sie dem Mitmenschen die Stille zerstören. Das laute Radiospielen in Hinterhöfen, im Auto, auf dem Parksessel, am Strand, beim Mittagstisch, ja selbst bei geselligen Zusammenkünften im Familienkreis, all dies gehört zu jenen vom Teufel der Unruhe inszenierten Gelegenheiten, bei denen Musik nicht mehr Musik, sondern nur noch stimulierende Droge ist. Und so wie bei gewohnheitsmäßigem Gebrauch von Drogen ihre regelmäßige Verwendung zur „Sucht“ wird, so verfällt der Mensch unserer Tage im Mißbrauch von Radio, Fernsehen und Schallplatte der Musik als „Rauschgift“.
,
Wir wissen auch noch gar nicht, wieviel von der allgemein vorhandenen Nervosität auf den übermäßigen Genuß von Fernsehen und Radio zurückzuführen ist. Untersuchungen an Schulkindern haben beispielsweise anhaltende Leistungsverminderungen festgestellt. Darüber und über so manche andere unliebsame Auswirkungen dieses unsinnigen „Musikgebrauches“ wissen Lehrer und Nervenärzte noch mehr.
Dieselbe Kunst der Musik, die „holde Kunst“, von der Schubert singt, wird nun als „Musiktherapie“ angewendet, sie soll der leidenden Menschheit helfen, jener Menschheit, die sich an ihr durch unmäßigen und unmenschlichen Gebrauch versündigt. Wie die schon jahrelangen Erfahrungen von Univ.-Prof. Dr. H. Hoff, Primarius Dr. A. Rett, Primarius Dr. W. Podhajsky, Prof. Editha Koffer-Ullrich u. a. in Wien bezeugen, tut sie dies mit besten Erfolgen. Sie hilft zur „Wiederherstellung des Selbstvertrauens, zur Befreiung von Angst- und Spannungszuständen, zur Förderung der Konzentration, zur Weckung von Eigeninitiative, sozialen Kontakten und damit zu positiver Einstellung zum Leben“. (Editha Koffer-Ullrich, Musiktherapie in Österreich. „Österreichische Ärzte-Zeitung“, Jg. 20, 1965, Heft 6.) Das „Rauschgift“ Musik ist wieder „Heilmittel“. Man kann der jubilierenden Wiener Musikakademie nur wünschen, daß diese „heilende“ Kraft der Musik in ihr weiter gepflegt und gelehrt wird. Dies aber nicht nur in dem speziellen Unterrichtsfach „Musiktherapie“, sondern in allen musikalischen Fächern. Dann bleibt sie nicht nur die seit 150 Jahren berühmte und bewährte österreichische Bildungsstätte für Musiker aller Kategorien, sondern wird ein Segen für die Menschheit, die, dem berühmten Wort Handels folgend, durch Musik nicht nur unterhalten, sondern „besser“ werden soll.
Aus der Festschrift der Akademie für Musik und darstellende Kunst
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!