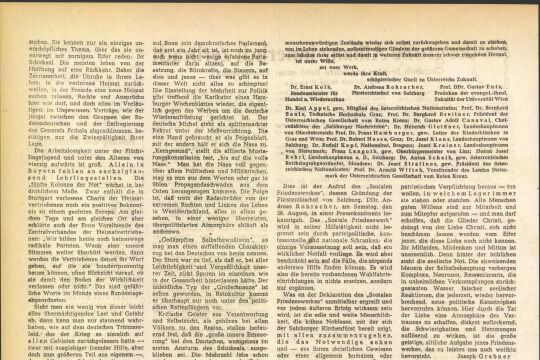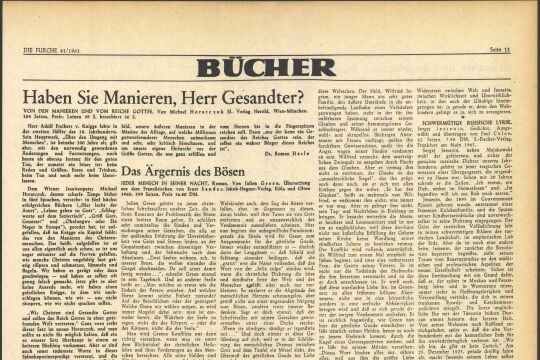Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
IMMER IST ANFANG
In einem Gespräch mit dem Dichter Rudolf Henz, das im Oktober 1966 für die „Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur” aufgezeichnet wurde, sagte der damals bald 70jährige Dichter: „… wenn man die Sache … bedenkt, fragt man sich: Was hast du eigentlich geschrieben? Nichts hast du geschrieben, gar nichts hast geschrieben! Du mußt erst anfangen, du mußt erst das Richtige schreiben! Dieses Immer-wieder-Anfangen-müssen, das erhält uns aber auch jung, so daß wir heute jünger sind als die zur Perfektion neigenden jungen Zwanzigjährigen, die Texte schreiben, die perfekt sein sollen..
In seiner „Meditation zum Siebzigsten” nimmt der Dichter diesen Gedanken wiederum auf:
„Immer die Angst vor dem ersten Gedicht.
Jedes neue wieder das erste.
Wärst du erst Achtzehn,
du wüßtest, was ein Gedicht ist,
unfehlbar.
So bleibst du Anfänger, alter Knabe, hilflos und töricht,
immer noch jünger als die wissenden Enkel.
Was willst du noch?”
Der Kenner der Werke von Rudolf Henz, die in diesen Spalten oft gewürdigt worden sind, wird an den Arbeiten seiner letzten Jahre einen merkwürdigen Stil- und Sprachwandel feststellen können. Der Dichter ist in den letzten Jahrzehnten — nach seiner großen epischen Häresiologie unserer Zeit, dem gewaltigen Terzinenepos „Der Turm der Welt” (siehe „Die Furche”, Jahrgang 1951, Nr. 42, „Die Warte”, Seite Iff) — knapper und aphoristischer geworden. Das liest man an seinen wie „hingesagten” neuen Gedichten ebenso ab wie an seinen jüngsten Prosaarbeiten und Hör- und Fernsehspielen, in die sehr oft ein satirisches Element einfließt, das sich bis zur Farce steigern kann, wie etwa im „Kartonismus” (1964) oder auch in seinem neuen Glasmaler- Roman, an dem er eben arbeitet. Die satirisch-aphoristische Art zeigt sich auch in dem jüngsten Gedichtzyklus „Der Zeitfischer”, der nach des Dichters eigenen Worten von der Überlegung ausgeht, daß „wir zu tief in der Zeit fischen. Die anderen haben das nie so gemacht. Wir bringen den ganzen Urschlamm herauf. Wir greifen zu tief, dadurch, daß uns die ganze Welt gehört… wir beschäftigen uns zu viel mit, wir leiden zu viel an der Welt.”
Auch der überzeugte Christ Rudolf Henz leidet an dieser „unvorstellbaren Welt”, wie sie sein Altersgenosse Rudolf Felmayer einmal genannt hat, und er bittet darum in diesem Gedichtzyklus:
„Laß mir den Glauben, Herr, an dein menschliches Antlitz, nur diesen kindlichen Glauben!
Auch wenn er eines Kenners unwürdig ist, eines Experten gar.
Wenn der Wortnebel sich zwischen uns beide schiebt,
helfen mir alle Bücher über dich nicht,
die exaktesten Beweise für deine Existenz,
das Erstaunen eines Physikers,
die Lobgesänge alter Poeten auf deine Herrlichkeit, meine eigenen frühen nicht.
Auch nicht die Zeugnisse der Märtyrer und Bekenner, nichts als eines alten Mannes kindliche Gewißheit.”
Der Bedenker der Ordnung, als den wir Rudolf Henz aus allen seinen Büchern kennen, sagt Nein, zu den Scheinordnungen dieser Gegenwart:
„Auf dem Bauplatz der Mechaniker liege ich, ein unbrauchbarer Stein,
zu naturgewachsen für den Prunkpalast des Fortschritts,
die Glaskathedrale der Elektronengötter.
Wenn sie mich nur nicht doch noch in die Grundmauer stecken!
Ich rufe Gott an, der auch die Steine anhört:
Ich will diesen Tempel des Hochmuts nicht mittragen, auch nicht als verachteter Stein, als fragwürdiger Eckstein!”
Welchen Ordnungen sann und sinnt dieser Dichter, der sich als Siebzigjähriger noch immer „am Anfang” fühlt, eigentlich nach? Man könnte meinen, den „ewigen” Ordnungen, die sich immer wieder im vergänglichen Wandel des Zeitlichen spiegeln. Er sinnt aber auch kritisch über die Ordnungen, die der Mensch hier und jetzt stiftet, schon ein Leben lang nach. Denn der Mensch hat, beseelt vom Fortschrittsglauben, nun über den Ordnungen der Primärschöpfung seine eigenen Ordnungen einer „Sekundärschöpfung” — eben die „Glaskathedralen der Elektronengötter” — aufzurichten begonnen, nicht nur die hybriden Ordnungen der „Blinden, Tauben und Stummen” aus dem „Turm der Welt”, sondern jene Ordnungsfortbildungen, die auf den Entdeckungen der geheimsten Sphäre der Schöpfung beruhen, deren Natur er zu dechiffrieren gelernt hat. Mit ihren Kräften baut er in zunehmendem Maße eine „unnatürliche Natur” und eine „unzivilisierte Zivilisation” auf, in der ein „unmenschlicher Mensch” „unbehaust” haust. (Das haben sowohl Romano Guarddni als auch Hans Freyer schon überzeugend dargetan!) Ein Mensch also, der in seiner „Computerwelt” den Menschen als solchen immer mehr aus seinen Überlegungen über die „reinen Strukturen” auszuklammem beginnt, wie es uns eben jetzt der „Strukturalismus” als „demier cri”‘ der Philosophie vor Augen führt.
Selbst der atheistische Existentialismus eines J. P. Sartre hat noch den Menschen als „Entwurf seiner selbst” anerkannt und gelten lassen! Der Strukturalist sieht ihn nur noch im funktionalen Zusammenhang aufzudeckender biologischer und soziologischer „Strukturen”. Er stellt die uralte Frage des achten Psalms schon gar nicht mehr: „Was ist der Mensch?”
Rudolf Henz glaubt nun noch immer — das geht bei aller Skepsis, die es durchwaltet, aus seinem Alterswerk hervor — an die zwar stets gefährdeten, aber dennoch bestehenden Ordnungen der „Primärschöpfung”, die die Freiheit des Menschen, der sich entscheiden darf und soll — trotz seiner teilweisen naturhaften Determination! — garantieren. Er lebt die Antinomie von Freiheit und Bindung in sich und seinem Werk aus. Er will in einer totalen durchfunktionalisierten und durchrationalisierten, von den Gesetzen der Kybernetik beherrschten Welt „dennoch Mensch” bleiben, der weiß: „jeder Mensch ist Gottes Kind”, wie es sein „Lobgesang auf unsere Zeit” verkündet hat. Mensch bleiben, auch noch in den Höllen des Krieges, das wollte ja schon der Held seines Romanes aus dem Jahre 1936, „Dennoch Mensch”, der ja viele autobiographische Züge des Dichters selbst enthält. Mensch blieb auch noch der Steinmetz inmitten der „Lemurenwelt” im „Turm der Welt”. Aber dieser Mensch macht eben in unserem sich völlig wandelnden Äon nicht nur eine „Mutation” im Sinne Teilhard de Chardins durch, sondern er erleidet gleichzeitig auch alle Qualen und Prüfungen Hiobs! Der Dichter kämpft nun in seinem jüngsten Femsehspiel „Hiob” stellvertretend für den uralten Glauben dieses Leidgeprüften, dem Gott in unserer Zeit eben die „Blinden, Tauben und Stummen” als Verführer zum „Computer-Babelbau” gesandt hat. Er kämpft für die Hoffnung, die wider alle Hoffnung hofft wie Charles Pėguy, und für die Liebe noch zur ärmsten Kreatur: eben „dennoch Mensch!”
Vielleicht gehört zu diesem ewigen Anfang im Zeichen der drei Kardinaltugenden heute mehr Mut als zu allen kollektiven Protestaktionen wider eine versagende Welt- und Gesellschaftsordnung, die nur darum Repressionsgesellschaften duldet, weil sie eben von Menschen errichtet worden ist, die trotz 2000 Jahren Christentum das Liebesgebot des „Menschensohnes” in den Sturmwind der Zeiten geschlagen haben. Der „Dichter zwischen den Zeiten”, als der sich Henz zeitlebens empfand, nahm aber den „großen Sturm” dieses Gebots in seinem Innersten wahr, und trotz aller.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!