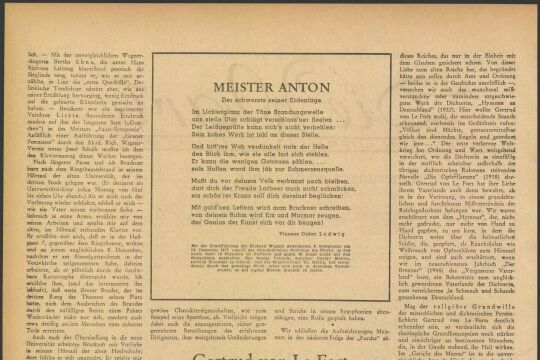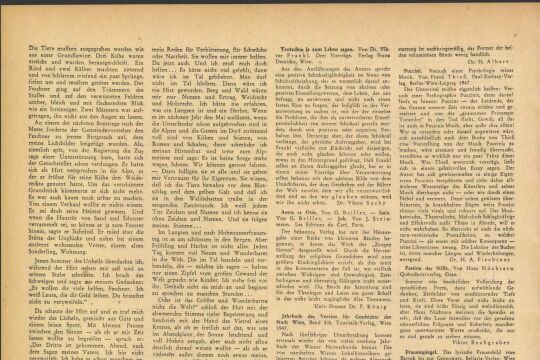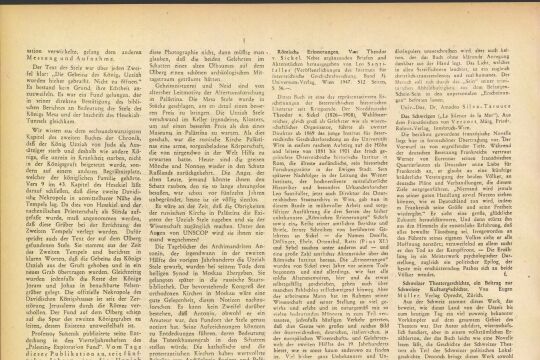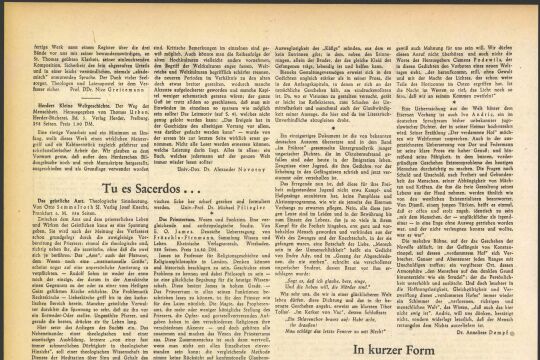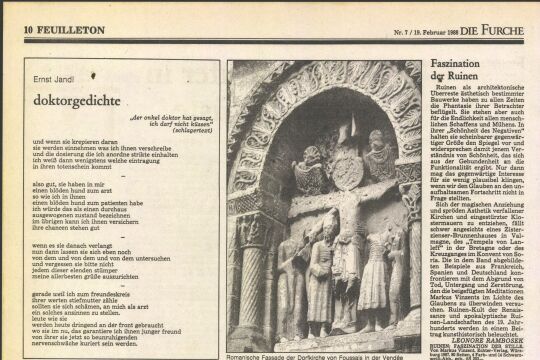Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lyrik gegen Vergessen
Ich bin des unterwegs-seins müde / ich möchte bleiben können irgendwo / im nie-mandsland vielleicht”: In den Einleitungsversen des Gedichts „grenzgänger” -ein 'I 'ext, der 1968 während ihres Lektorats in Bukarest entstanden ist -bündelt Marie-Therese Kerschbaumer zentrale Themen ihres Schreibens. Das lyrische Ich erlebt das Schweben, das Ineinandergreifen der heterogenen Identitäten, die es in sich fühlt.
Im Zustand des Nicht da Nicht dort, der Ortlosigkeit, der Wanderschaft, der Grenzüberschreitung - „immer unterwegs / von mir zu mir” - wird Freiheit erst möglich, eine Freiheit al -lerdings, die mit I .eid verbunden ist. I )ie Suche nach dem „niemandsland” vollzieht sich zunächst als Selbstbefragung, als bildhafte Beschreibung existentieller Gefährdungen, zum anderen jedoch als eine Reflexion über die Sinnhaftigkeit und Denkmöglichkeit' von Utopien (im eigentlichen Wortsinn, utopia als Nirgendland, das nur in der Phantasie existieren kann).
Die soeben erschienene Sammlung „bilder immermehr” (Verlag Otto Müller) dokumentiert Kerschbau-mers lyrisches Schaffen von 1964 bis 1987. Indem die Chronologie durchbrochen wird und die Anordnung thematischen Kriterien folgt, eröffnen sich spannende Deutungsmöglichkeiten, da Texte aus unterschiedlichen Enstehungszusammenhängen in ein Verhältnis gegenseitiger Interpretation gerückt werden. Formal schöpft die Autorin das Repertoire europäi-her Lyrik - von volksliedhaften Formen bis zur Litanei, von der Elegie bis zum Gebet, vom Stab- bis zum Kreuzreim - aus, zitiert Märchenelemente, religiöse Motive und mittelhochdeutsche Worte. All diese Materialien aus der Lyriktradition verwendet sie souverän als Bausteine zur Konstruktion eigenständiger Sprach-Kunstwerke. Konstruktion erfolgt auf dem Wege der Destruktion beziehungsweise Irritation des Sprach- und Formenmaterials - Syntax wird aufgelöst, Sätze werden fragmentiert, Worte nach phonetischen Assoziationen in neue Zusammenhänge gebracht. Thematisch umfaßt ihre Lyrik Leiden und Sehnsüchte des Individuums (Liebe, Abschied) ebenso wie Sozialkritik, den Kampf gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Verbrechen ebenso wie die utopische I Ioffnung.
In einem 1985 in Wien geschriebenen Gedicht empfindet sich die Lyrikerin als „eine fremde”, eine 'Verbannte, die „durch dieses fremde land” geht. Immer wieder ist ein Gefühl der Fremdheit in Österreich fühlbar, speziell in Wien, seiner Atmosphäre der alltäglichen Bösartigkeit, Minderheitenfeindlichkeit und Vergangenheitsverdrängung, an Orten, an denen es nach Wein und Verwesung riecht und wo ein „dunkles loch” in einer Mietskaserne mit unbewußtem Zynismus als „lichthof” bezeichnet wird. Aus dem Land der Täter und der vergessenen, an den Band gedrängten Opfer sucht die Lyrikerin zu entkommen. Nomadisch durchstreift sie Länder und Zeiten. Doch auch hier gibt es keinen Ruhepunkt, keine Fluchtmöglichkeit, sondern die beständige Erinnerung an Kampf, Tod und 'Trauer.
Biblische Themen adaptiert sie in „david an absolom”, einem Epitaph des biblischen Königs für seinen im Kampf gegen den eigenen Vater gefallenen Sohn, oder in „josuah vom berg”, einem sprachspielerischen, die Bedeutungsnuancen der biblischen Schlüsselwörter „Berg” und „Botschaft” auslotenden Gedicht über den
Kundschafter Josuah, den späteren Nachfolger Mosis. Wortspiel enthüllt sich als Worternst, sichtbar gemacht durch phonologische Relationen (bot-schaft/botung/bergung/berg/bergen /beten und so fort). Spielerisch werden Assoziationsfäden freigelegt, vom „Berg”, dem Ort der Offenbarung, zur Ge- wie auch zur Verborgenheit und von der „Botschaft” zum „Gebot” und „Gebet”. In einem Gebet an Jesus schließlich tauschen Gott und Mensch ihre Bollen, so daß Jesus aufgefordert wird, der leidgeschüttelten Menschheit auf Golgatha nachzufolgen und sie ans Kreuz zu nageln.
Der Blick in die Kindheit, die sie während der Kriegsjahre in Tirol verbrachte, löst die Erinnerung aus. Frierende und hungernde Kriegsgefangene aus Serbien, Polen und Rußland, die im „tiroler winter” des Jahres 1942 die Straßen von Schnee säubern, stehen stellvertretend für die Opfer des Nationalsozialismus. Zur” entscheidenden Erfahrung für das Kind, das den Gefangenen Brot und Fäustlinge gibt, wird es, im Kleinen einen Kampf gegen die Ungerechtigkeit zu führen, der Parole folgend: „widerstand / ist möglich”. Wie in ihrer Dokumentation über den Widerstandskampf von Frauen, die 1980 unter dem Titel „Der weibliche Name de? Widerstands” erschien, thematisiert Kersch-baumer auch in ihrer Lyrik die Brutalität der Vernichtungsmaschinerie, sei es am Beispiel des Spanischen Bürgerkrieges oder des Massakers, das SS-Männer am Perschmannhof in Südkärnten angerichtet haben. Die bruchstückhafte, durch Fragesätze, assoziative Unterbrechungen, Silbentrennungen, typographische Hervorhebungen und die wiederholte, tastende Formulierung von Satzfragmenten gebrochene Wiedergabe des Geschehens „mord begangen am Perschmannhof” macht die Schwierigkeit bewußt, Unmenschlichkeit und individuelles Aufbegehren zu beschreiben. Dieser aus der Perspektive einer Freiheitskämpferin der Gegenwart fik-tionalisierte Text -„briefe einer gefangenen an die mit-und nachweit” - bewahrt die Vorläufigkeit, den Experimentcharakter der Textentstehung (Anspielung an die Kassiberform, das Überlebens-Zeichen aus dem Gefängnis), so daß die darin proklamierte Forderung, die alten Hierarchien und den alten Gehorsam abzuschaffen und die Gesellschaft zu demokratisieren, ohne falsches Pathos vorgetragen werden kann. Manche Gedichte lassen Assoziationen an die blaue Blume der Bomantik heraufklingen. Bomantische Motive wie der Traum, die Ruine, das Einhorn oder der Undine-Mythos deuten zwar eine literarische Fluchtbewegung an, fügen sich aber doch in den gesellschaftskritischen Kontext der Lyrik Marie-Therese Kerschbaumers ein. Der Kampf gegen das Verdrängen und das Engagement für die Außenseiter der Gesellschaft sind begleitet von der Sehnsucht nach einem utopischen „gelobten land”. Solidarisch mit den Lebewesen, gefangen hinter den Gittern eines Käfigs, einem ungeheuren „angstloch” ausgesetzt, stilisiert sich das lyrische Ich zu einer Ruferin in der Wüste („dieses fremde land”). Lyrisches Schreiben gestaltet sich als Überbringen von Rotschaften - als Versuch, dem Lärm der Vereinfachung die Re-hutsamkeit der Differenzierung entgegenzusetzen. Erinnerungsarbeit vollzieht sich als Spracharbeit. Literatur, wie sie sie versteht, dient der Bewahrung des Gedächtnisses, dem Si-syphos-Kampf gegen den „schwarzen staub” des Vergessens.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!