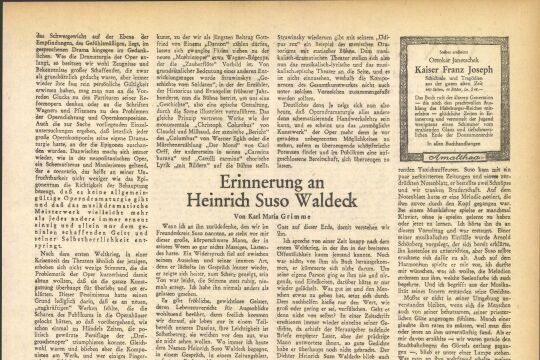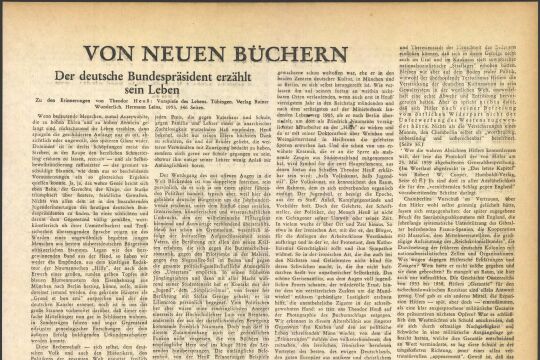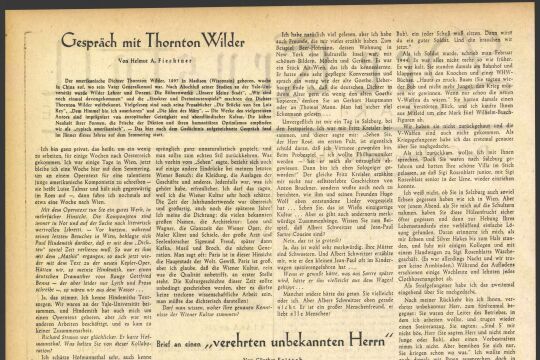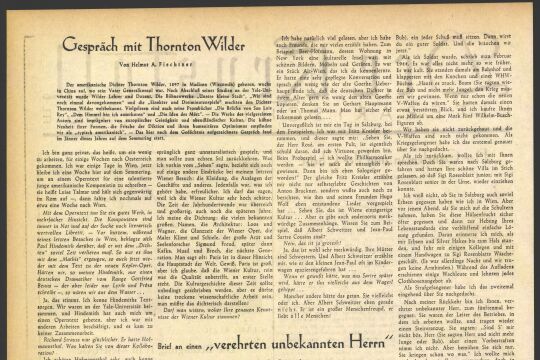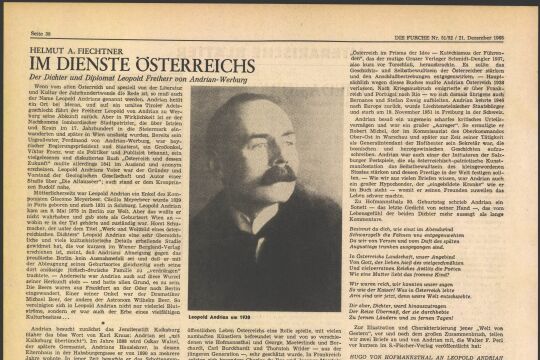Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nur allzusehr dem Schönen zugewandt
Johannes Guthmann, der Sohn eines Berliner Baumaterialfabrikanten aus den Gründerjahren, gehört zu jener Generation der ästhetisch Hochbegabten, der Rilke angehört hat, Rudolf Alexander Schröder, Hugo von HofmannsthaL Monibert, Richard von Schaukai und mit einem kleinen zeitlichen Abstand auch Stefan George. Das war die Generation, die den Jugendstil inaugurierte, den deutschen Symbolismus und die literarische Neuromantik. Sie suchte das Schöne: Der eine suchte es mit Pathos und der großen Attitüde, der andere mit der geistreichen Nuance, der eine wurde ein Dichter-Philosoph und der andere ein sensitiver Künstler, eine hochkomplexe und mimosenhafte Gestalt. Mit dem Naturalismus hatten sie nichts mehr zu tun; sie haßten ihn und sie fühlten sich als seine Ueber-winder. Sie waren die Zarten, Feinen, Tiefen oder die ganz groß Gearteten, die in kosmischen Dirnensionen zu denken pflegten. Auf allen ihren Tafeln stand „Odi profanum vulgus et arceo“.
Aber alles Aesthetentum brauchte eine finanzielle Unterlage, die nicht zu knapp sein durfte, und so war es denn ein Glück für Johannes Guthmann, daß er gleich in eine komfortable Umgebung hineingeboren wurde, in der man das Vergnügen nicht zu budgetieren pflegte. Er studierte, was ihm beliebte, vor allem Kunstgeschichte, und machte das mondäne und fashionable Doktorat von damals, war Schüler von Thode und Schmarsow und Assistent von Hugo von Tschudi an der königlichen Nationalgalerie. Dann befreundete er sich mit Slevogt und Ansorge, baute sich ein schönes und anmutiges Haus am Wannsee, machte Reisen und führte vor dem Krieg und zwischen den Kriegen das Leben eines kultivierten und gebildeten Herrn, der es sich leisten konnte, seinen Liebhabereien nachzugehen, Pferde zu halten, Bilder zu sammeln und mit der Prominenz von Kunst und Dichtung Umgang zu pflegen. Frauen spielten in diesem Leben offenbar keine Rolle, sie gehörten nur zur Geselligkeit. Der Politik, der häßlichen, wurde aus dem Wege gegangen, was zum „Volk“ gehörte, kam nicht in Betracht, Religion blieb ein Residuum, das man humanitär säkularisierte, und das Dasein wurde eine Aufgabe, die man vor allem kunstgewerblich zu lösen hatte. Es war schön, es war angenehm, es machte Freude und Vergnügen, sich geschmackvoll einzurichten mit Hilfe von Schultze-Naumburg und Grenander (wobei man über die hundert Nuancen von Grau Gespräche führen konnte), noble Häuser zu bauen, Theater und Konzerte zu besuchen, über Verse und Bilder zu plaudern, selbst auch ein wenig zu dichten und vor allem und immer Gentleman zu sein und sich alles Unangenehme vom Leibe zu halten. Summa sum-marum: man war eben ein Aesthet und wollte gar nichts anderes sein.
Soll man sich darüber mokieren? Nun, der eine wirft sich ins Geschäft, ein anderer reitet abenteuersüchtig alle Dschungel ab, ein dritter reißt Menschen an sich und traktiert sie moralisch, politisch, pädagogisch, ein vierter erfindet neue Religionen und Weltanschauungen oder weint seine Sehnsucht in Versen aus, und ein fünfter ist eben Aesthet und hat sein Vergnügen an dem, was andere nicht zu schätzen wissen. Wenn er's mit Anstand tut und ohne Arroganz, wird man sagen müssen: er hat neben den Raffern und Schaffern auch seinen Platz, auch wenn er nicht zu den Schöpferischen gehört und mehr rezeptiver als produktiver Natur ist. Seien wir in dieser Hinsicht keine Pharisäer, selbst wenn wir schließlich sagen müssen, daß ein Guthmann-Leben, von heute aus gesehen, beinahe etwas Orchideenhaftes hat. Aber vergessen wir die Zeit nicht, das Fin de siecle, die Jahrhundertwende, die Wilhelminische Aera, das Kaiserwetter und den großbürgerlichen Lebensstil, den ein Guthmann eben wie selbstverständlich als den seinen und den ihm angemessenen empfunden hat. Ein wenig verspielt kommt er uns vor und in unsere Zeit nun nicht mehr ganz passend, ein wenig zu rokokohaft — aber, lassen wir das Räsonieren. Sagen wir nach solchen Vorbehalten und Randbemerkungen, daß Guthmanns Erinnerungsbuch „Goldene Frucht“ angenehm zu lesen ist, geschickt und amüsant geschrieben wurde und mit einer Mischung von feinem Humor, leichter Ironie und Sachkenntnis; daß es diskret bleibt, wo das der Takt verlangte, und ein wenig maliziös, wo das angebracht erschien, aber immer so, daß es einem guterzogenen Herrn wohl ansteht. Es hat nur einen Fehler, es dreht sich streckenweise ein wenig zu sehr um den geliebten Slevogt, der sicher ein guter Maler war, aber doch nicht' das Genie, das Guthmann aus ihm machen möchte. Man hat aber auch sonst hin und wieder den Eindruck, das Guth-mannsche Gefühl- für Qualität sei etwas zu ge-schmäcklerisch gewesen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!