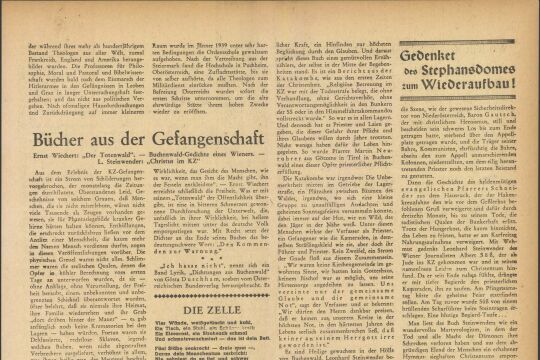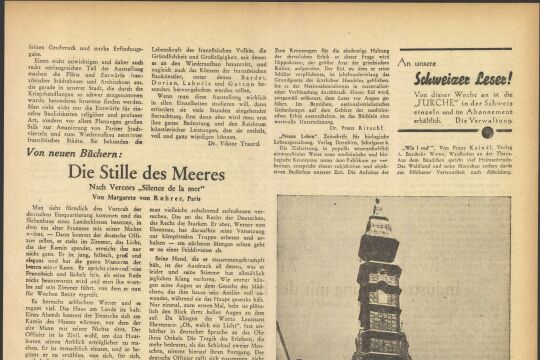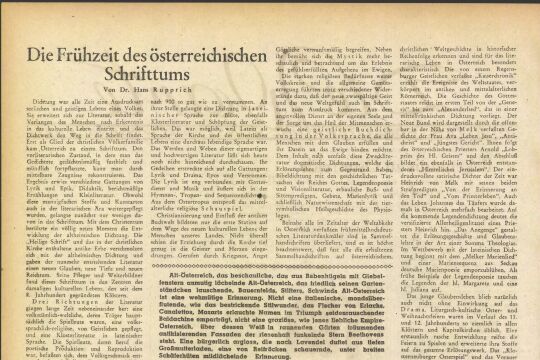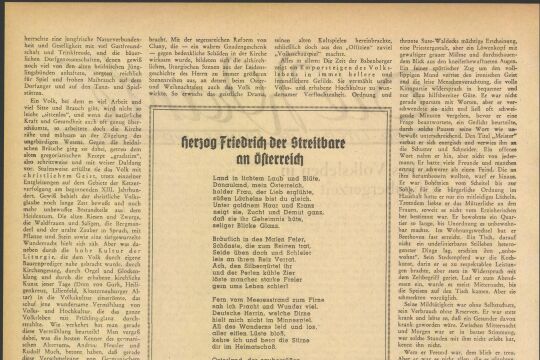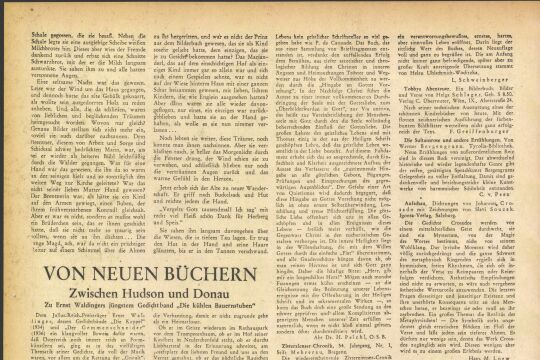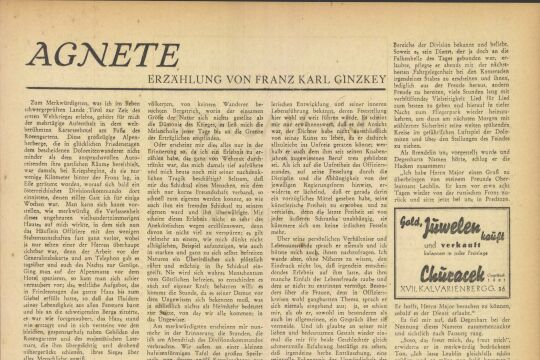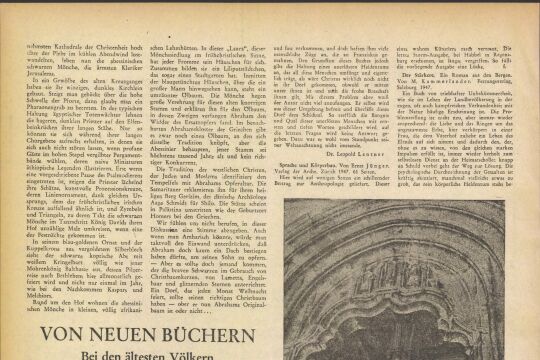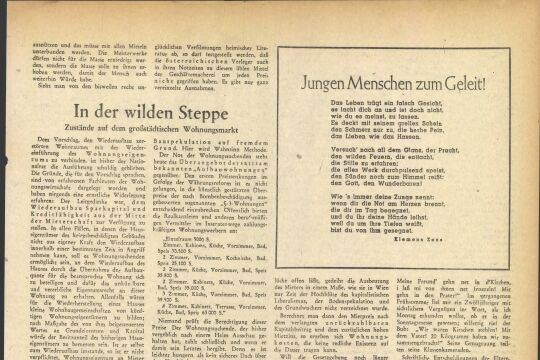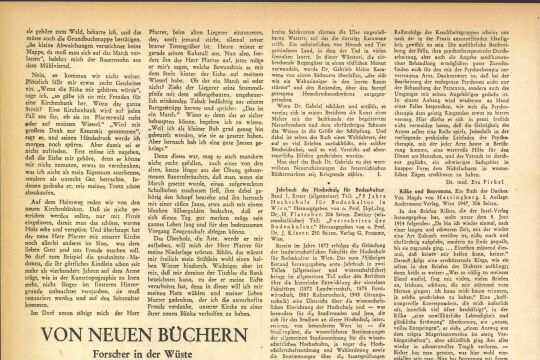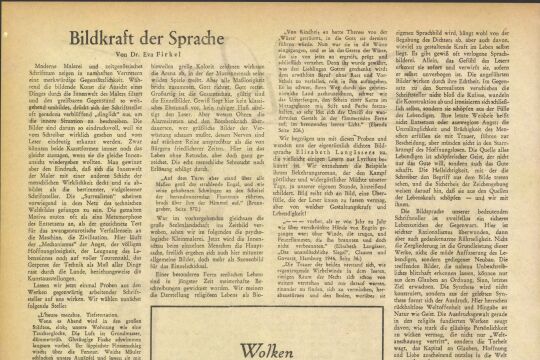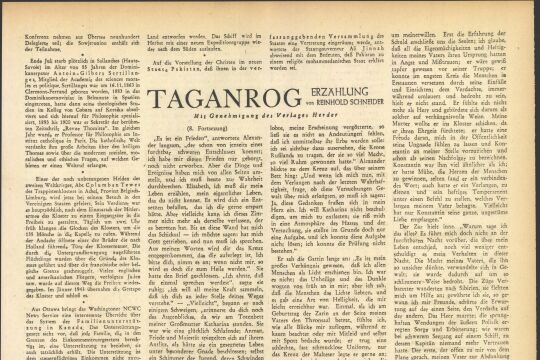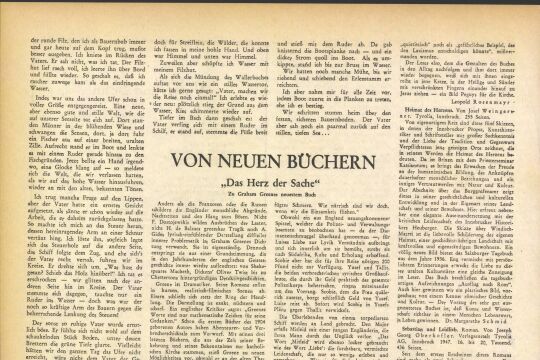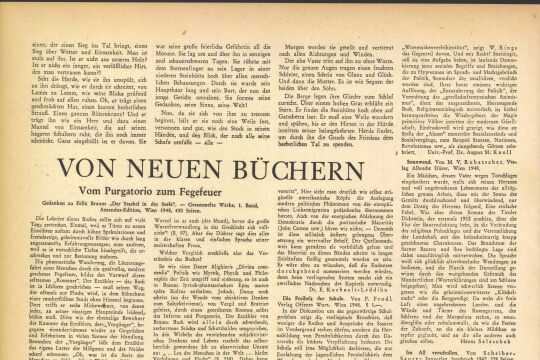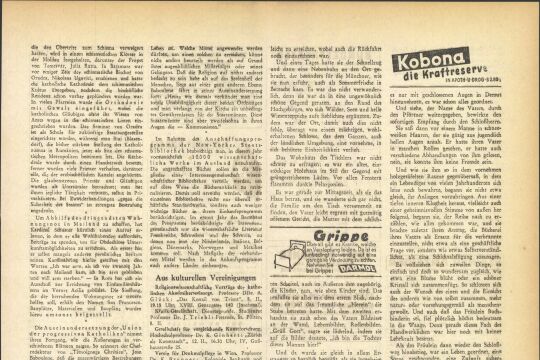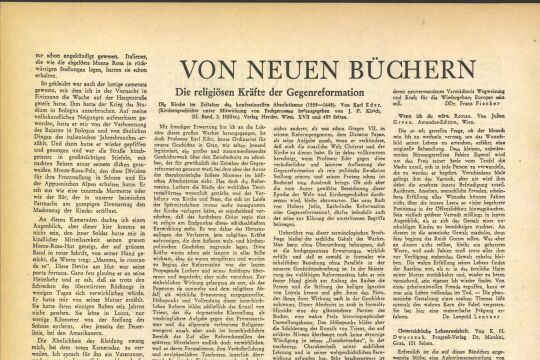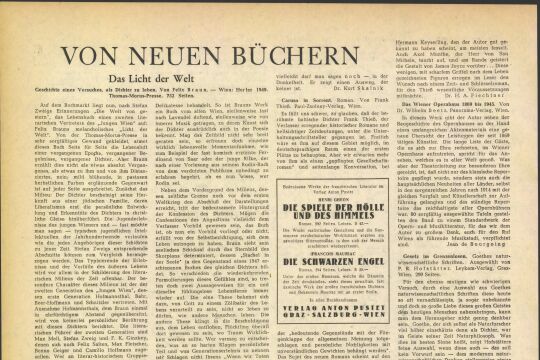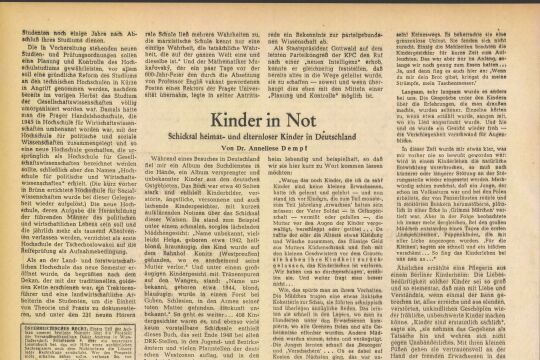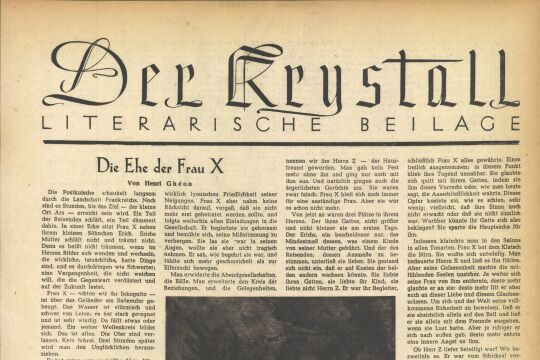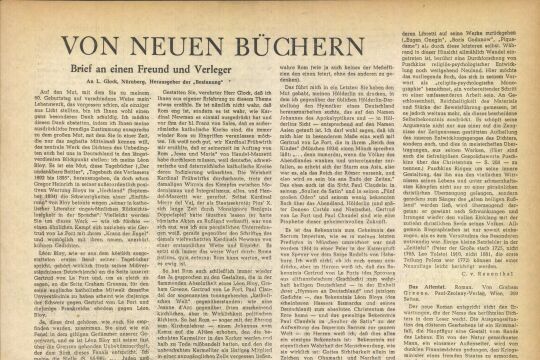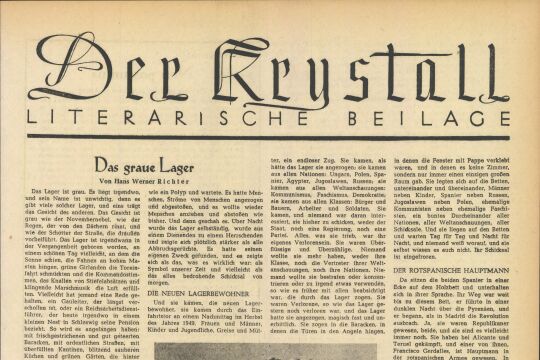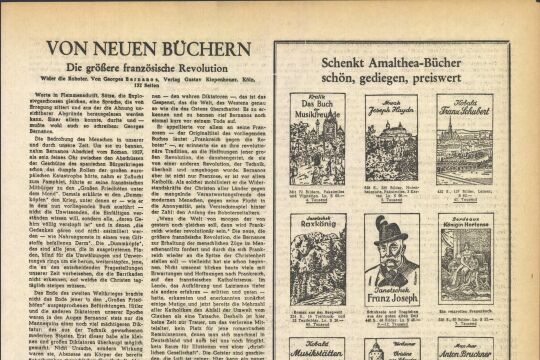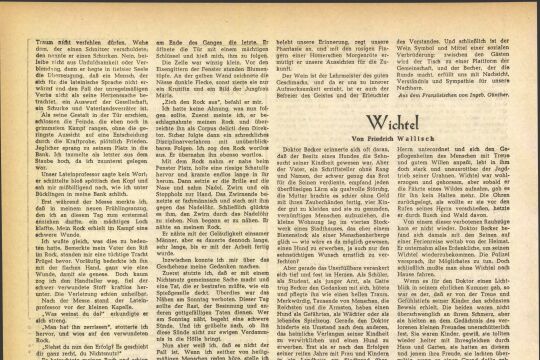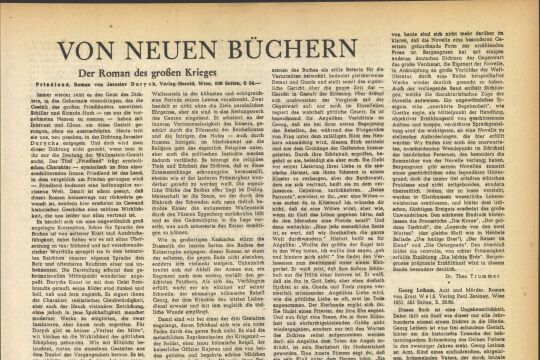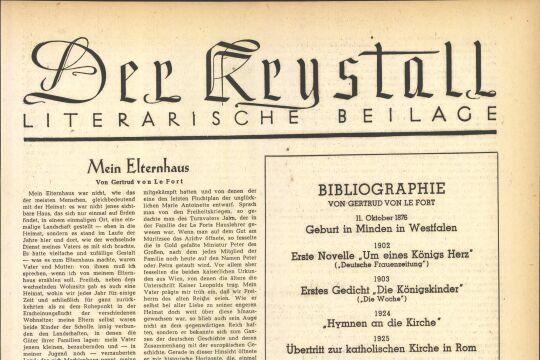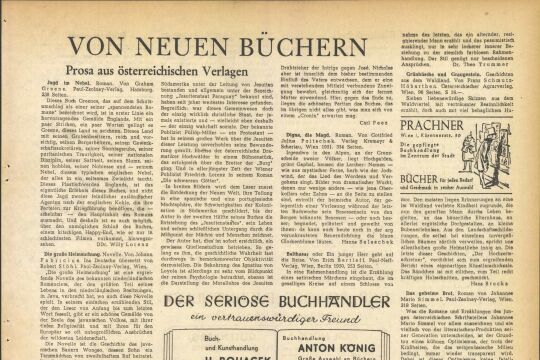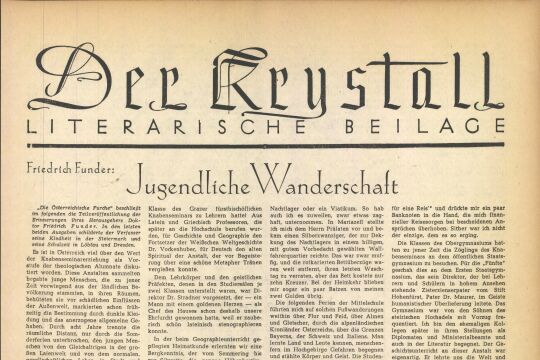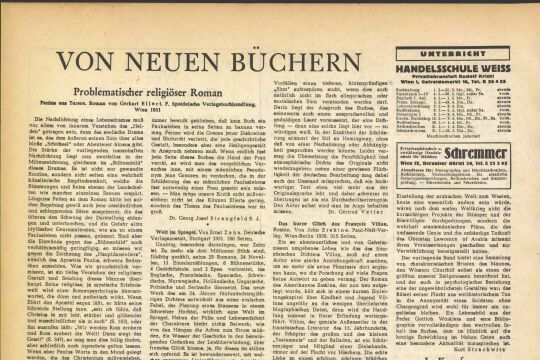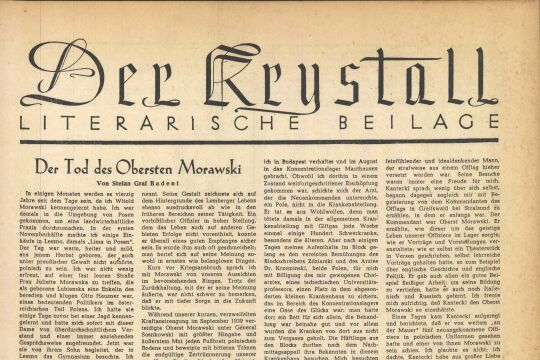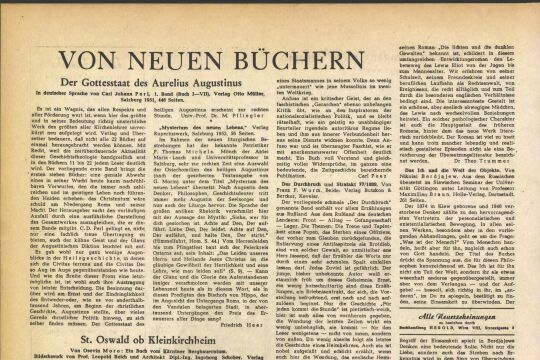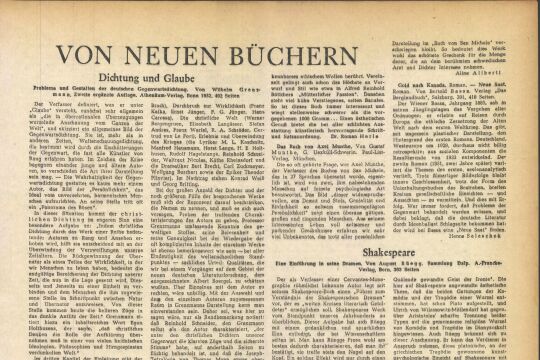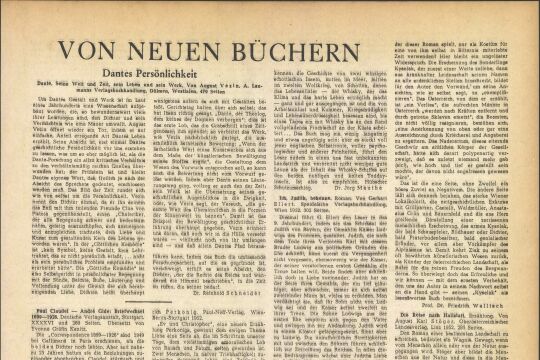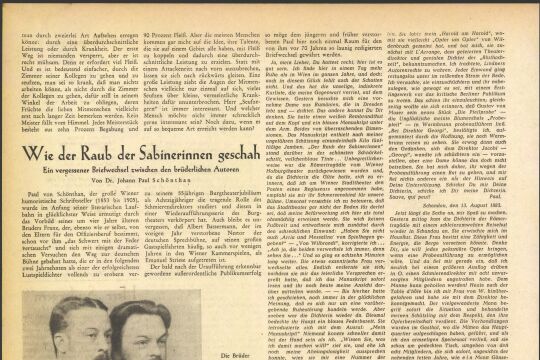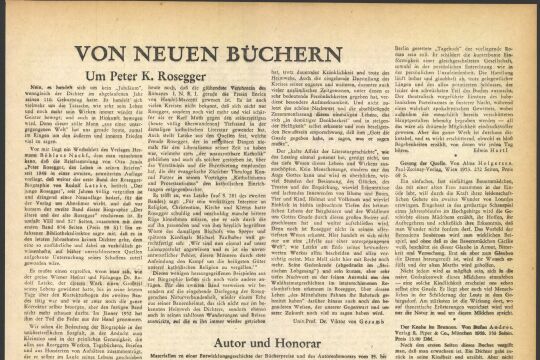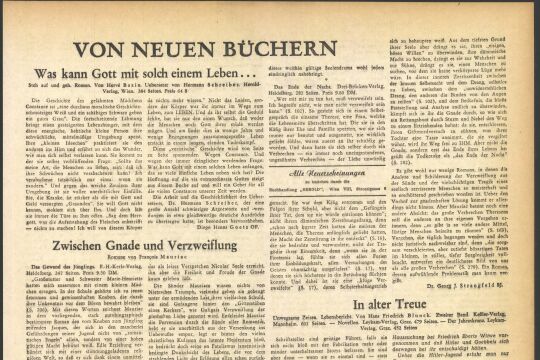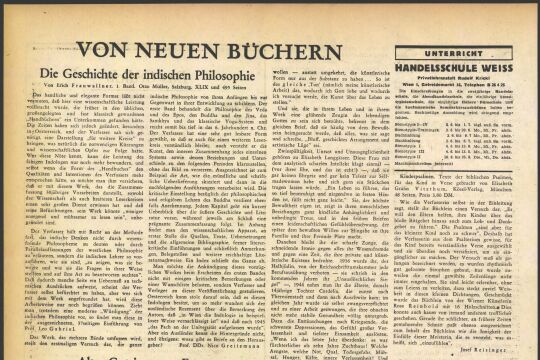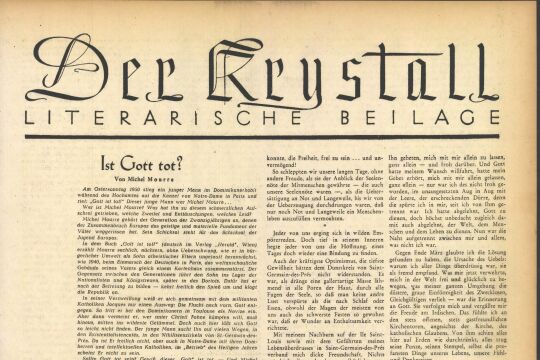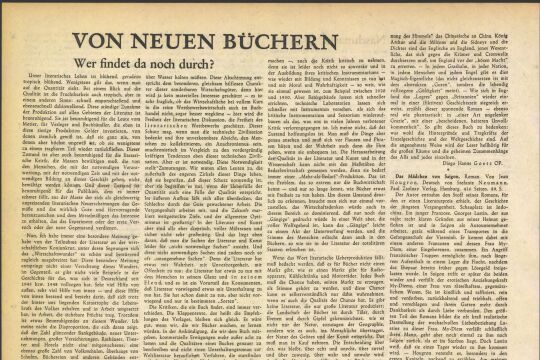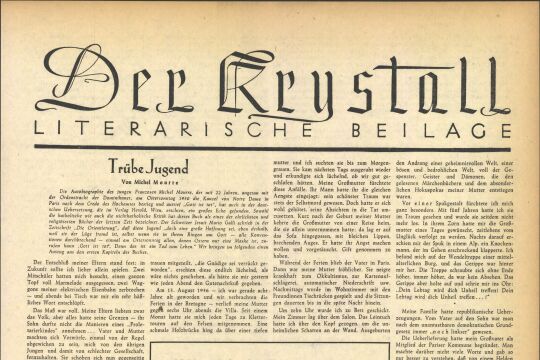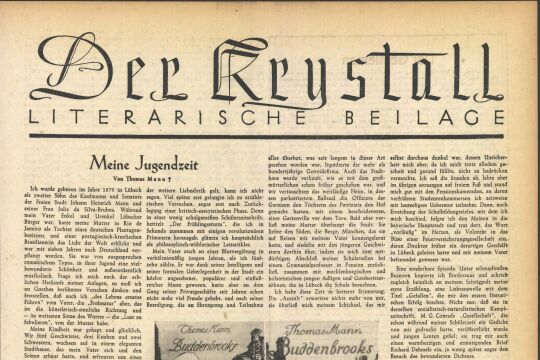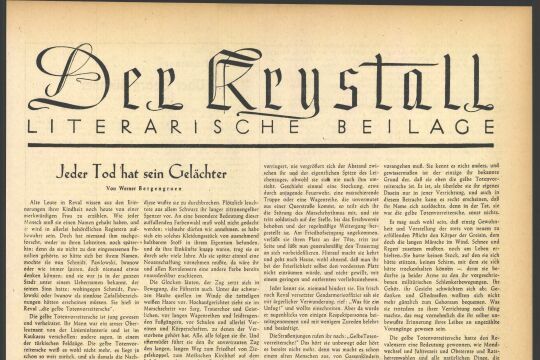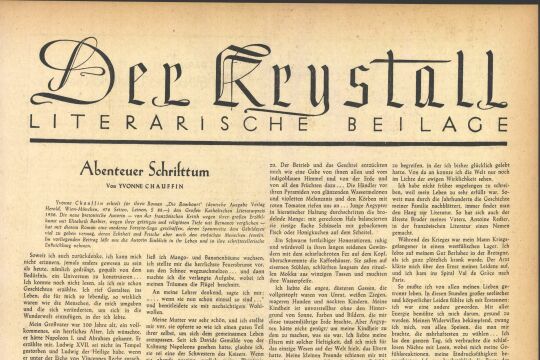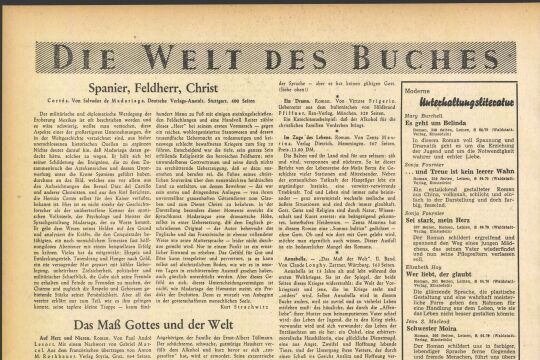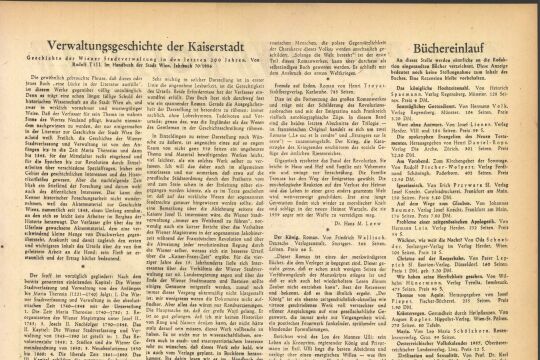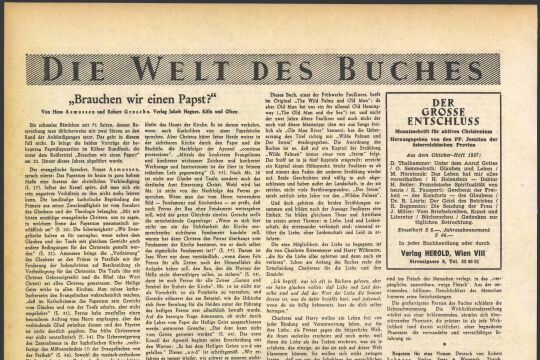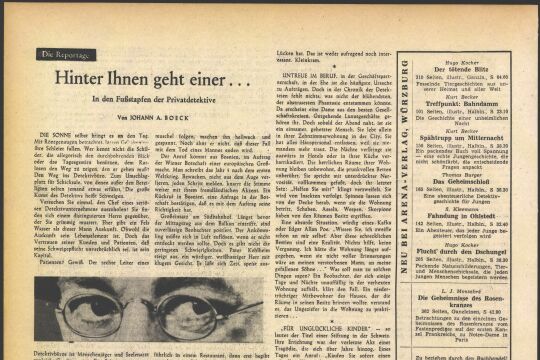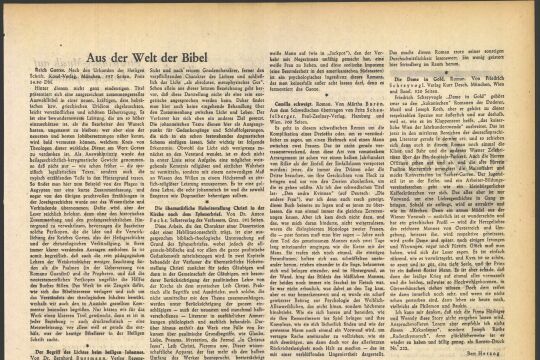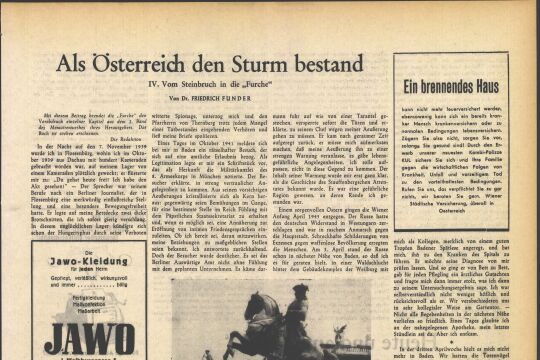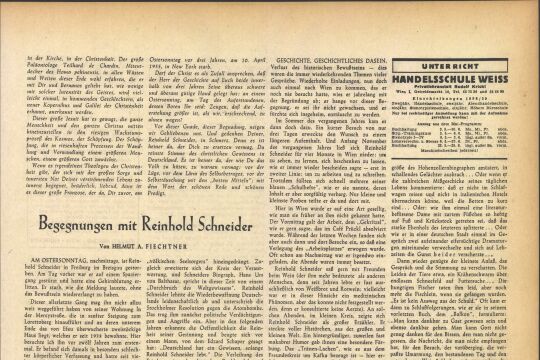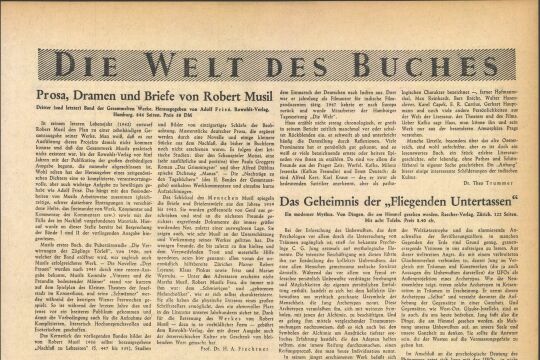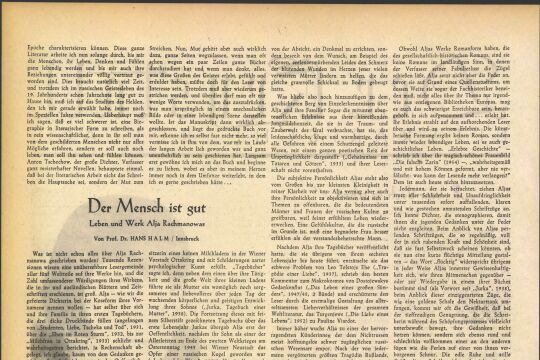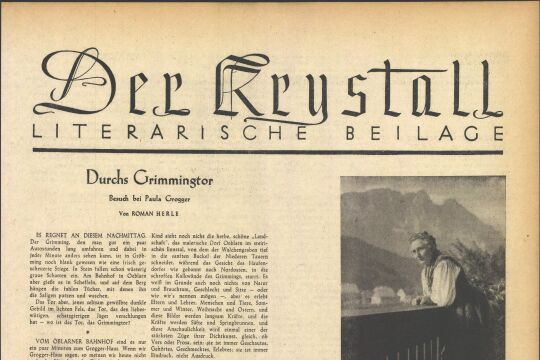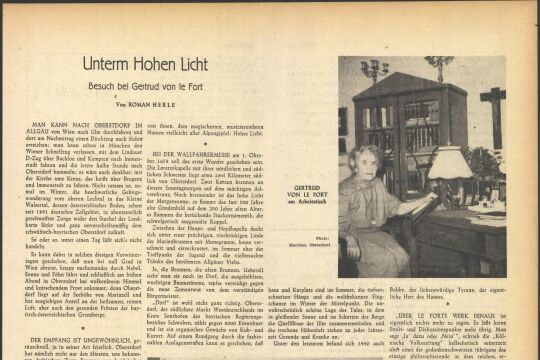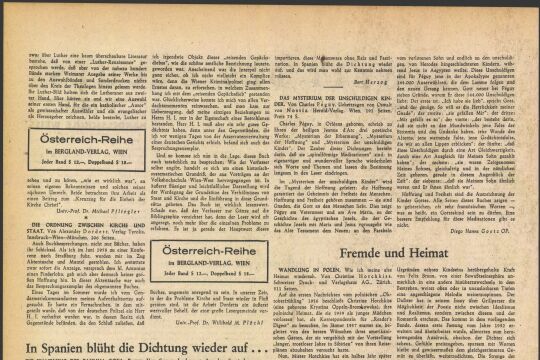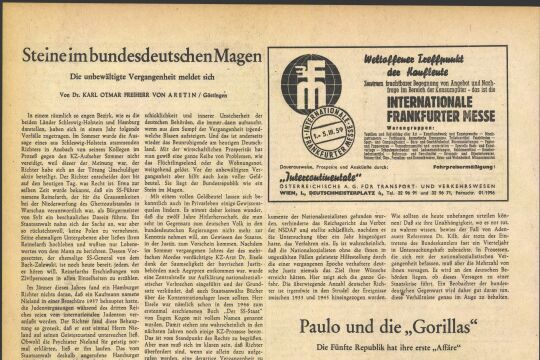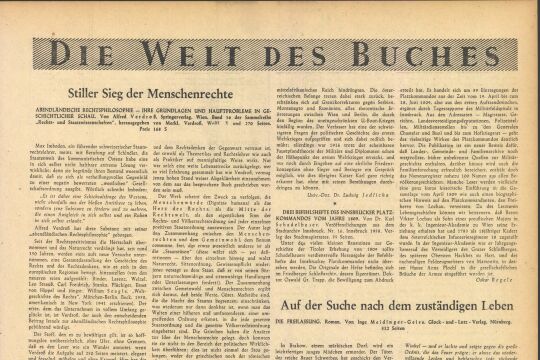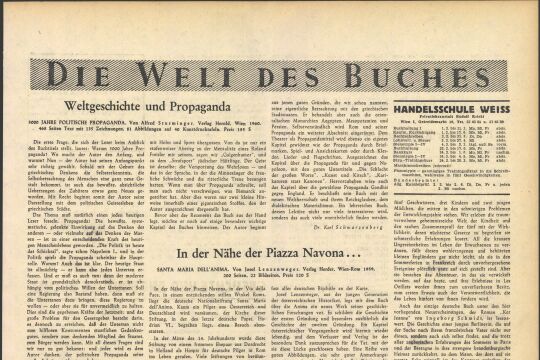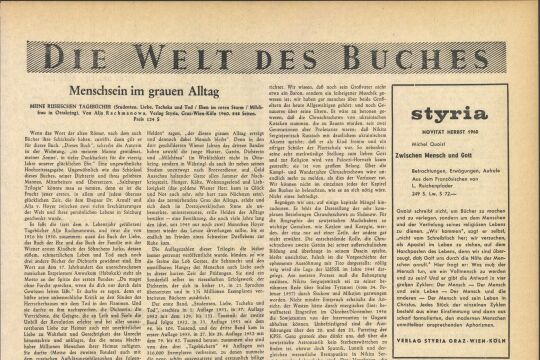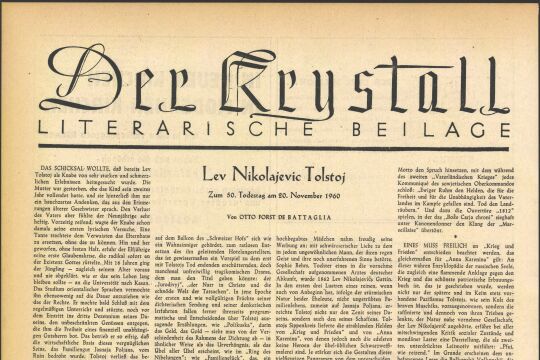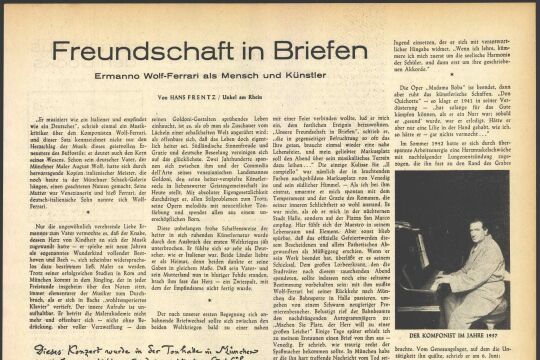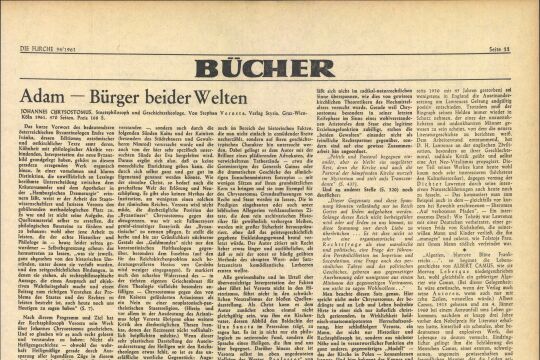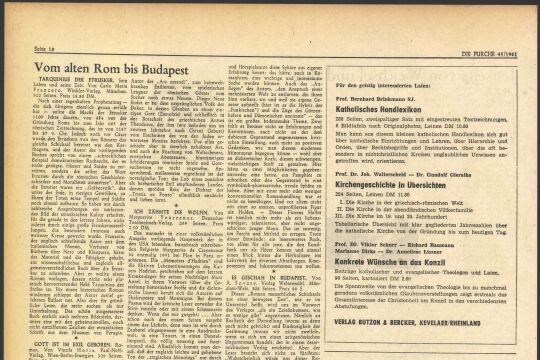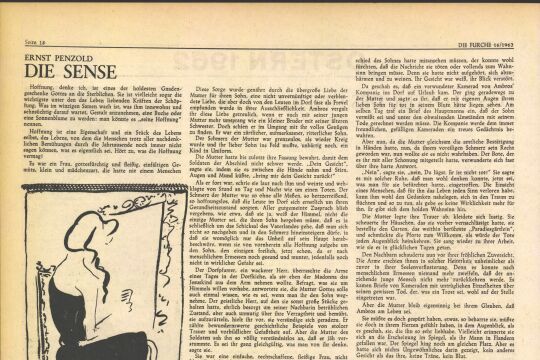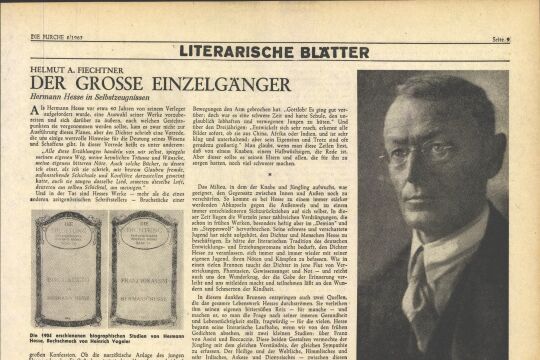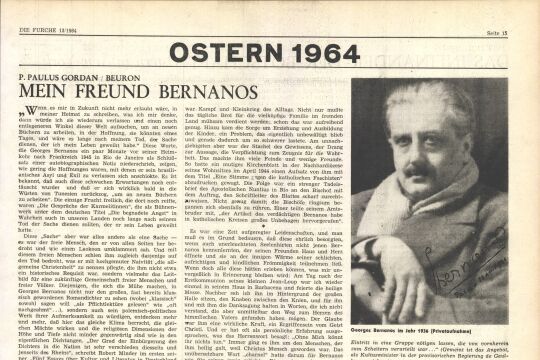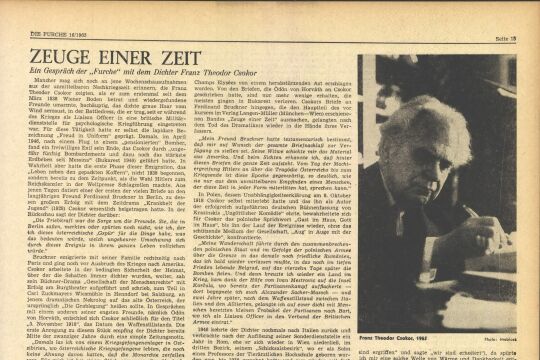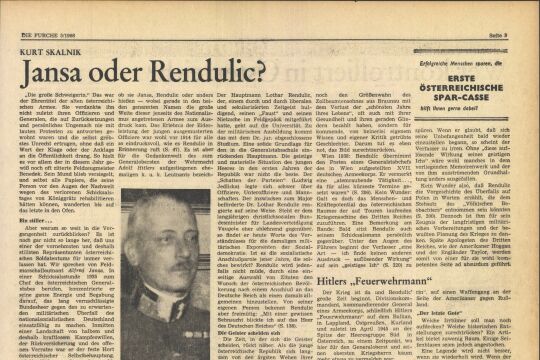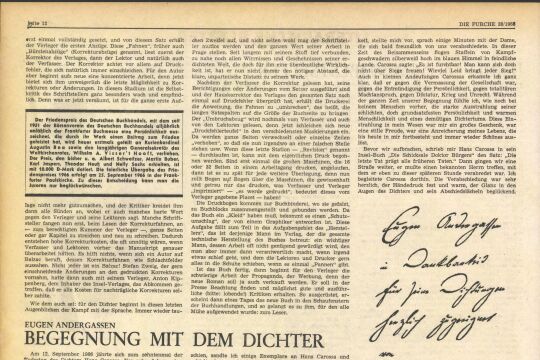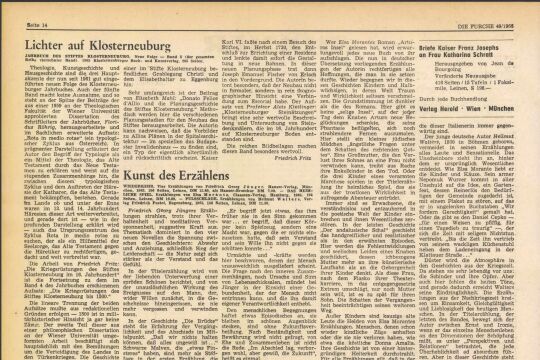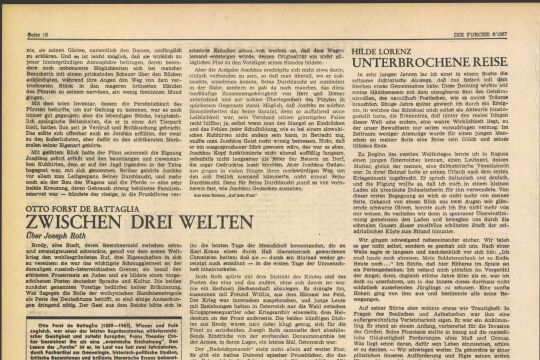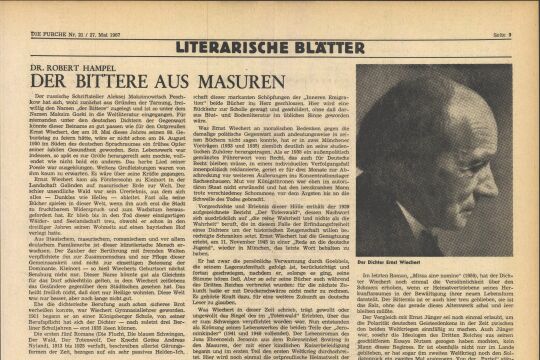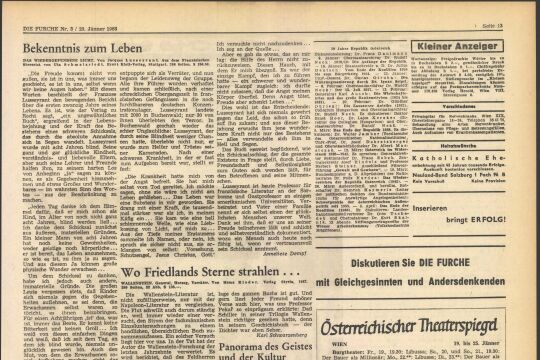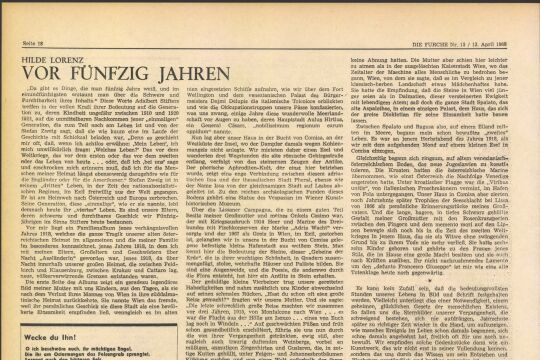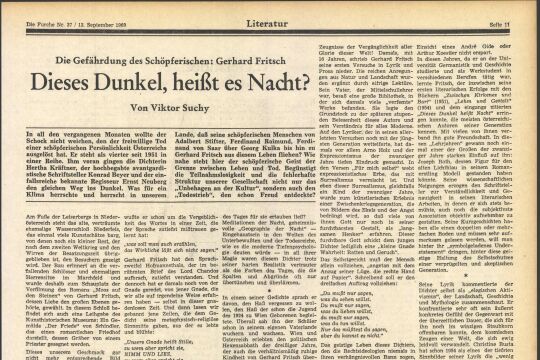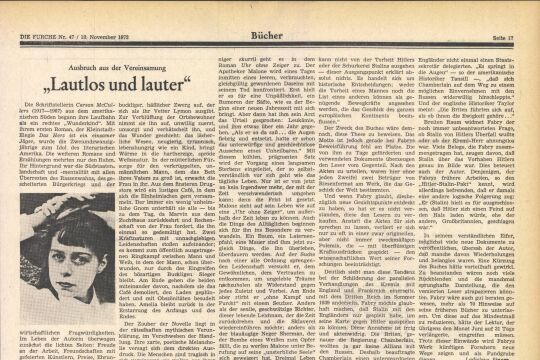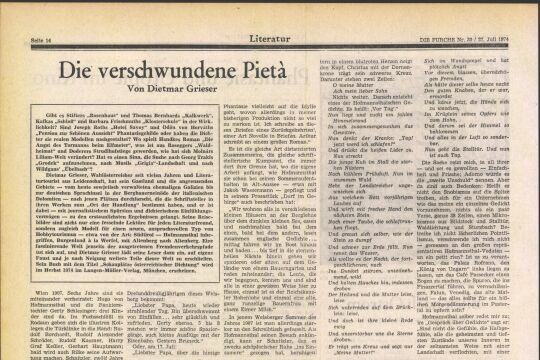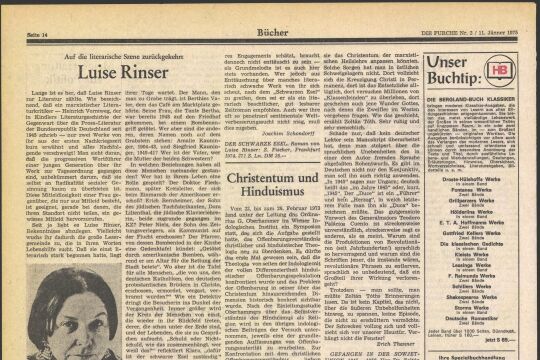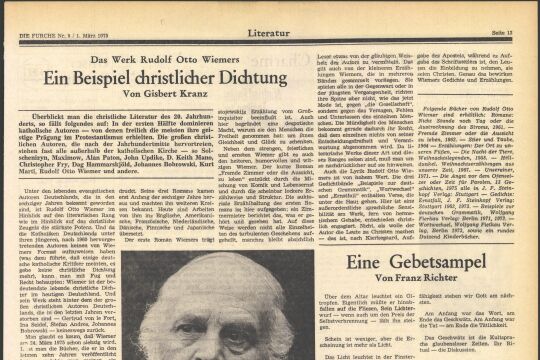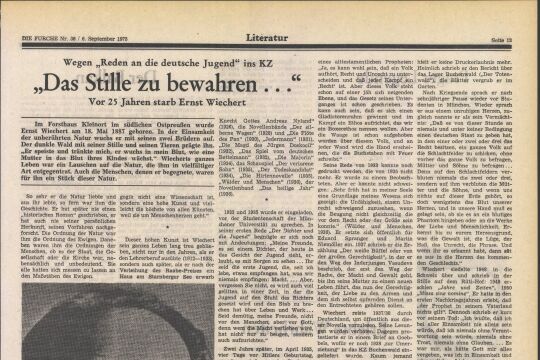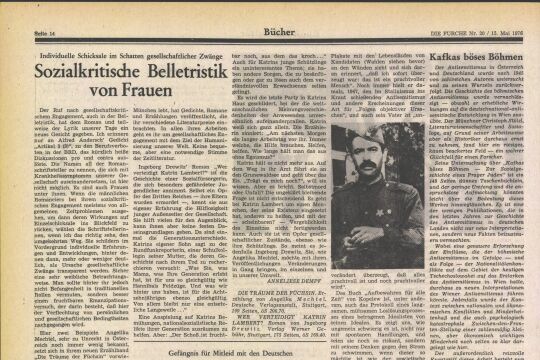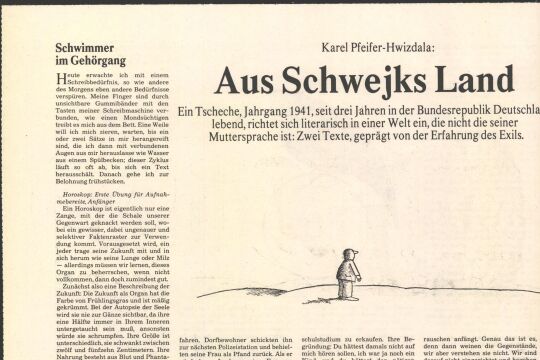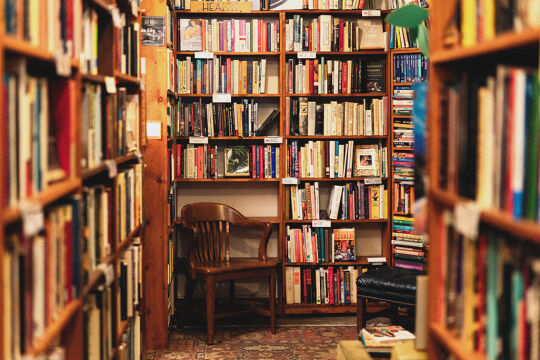Sommer, keine Idylle
Erster Weltkrieg, ein Sommer in Südfrankreich. André de Richauds Roman „Der Schmerz“ ist eine Entdeckung.
Erster Weltkrieg, ein Sommer in Südfrankreich. André de Richauds Roman „Der Schmerz“ ist eine Entdeckung.
Was für ein großartiger erster Satz: „Das Kriegsleben verlief weiterhin ruhig und alles in allem frei von Störungen für das Dorf.“ Als wäre ein Dorf in Kriegszeiten, selbst wenn weit entfernt von der Front, frei von Störungen. Freilich: Die Blüten duften in diesem Sommer wie immer, das südfranzösische Licht verzaubert, die Gefühle ruhen nicht. Doch 1914 wurden die Männer eingezogen, manche von ihnen sind inzwischen tot, im Dorf leben die Witwen und Wartenden, die Kinder lesen die Kriegsberichte in den Zeitungen und manchmal sieht man von Ferne das Leuchten der Munitionsfabrik.
Thérèse Delombre hat ihren Mann im Krieg verloren. Nach allem, was man über den Hauptmann andeutungsweise erfährt, dürfte er kein Ausbund an Sympathie gewesen sein, dennoch vermisst sie ihn. Ihre Liebe richtet sie nun auf bedrängende Weise an den einzigen Sohn. Das Kind als Ehemannersatz – das ist nur eine Spur, die André de Richaud in seinem Roman „Der Schmerz“ legte, den er 23-jährig schrieb und mit dem er 1930 einen Skandal auslöste. Dieser war nicht nur der Art und Weise der Darstellung der Beziehung einer Mutter zu ihrem Sohn geschuldet, sondern überhaupt der Beschreibung weiblicher Sexualität, weiblicher Bedürfnisse und sexueller Fantasien. Thérèse Delombres Bedürfnisse werden schließlich – was für ein Tabu im Zwischenkriegsfrankreich! – von einem jungen deutschen Kriegsgefangenen gestillt, der sich in diesem Dorf relativ frei bewegen darf.
Die Art, wie Richaud die Mutter-Sohn-Beziehung und diese Affäre schildert, wie die Anbahnung beginnt, wie das Kind sich zu dem Geliebten der Mutter verhält, bis zum bitteren Ende und zur Beschimpfung und Ausgrenzung der Mutter durch die Dorfgemeinschaft, während parallel der Sommer in expressionistischen Bildern gemalt wird und die Leserin den Duft der Blüten beinahe riechen kann, sucht seinesgleichen. Dieser Sommer kann kein idyllischer sein. Das Zusammenkommen von Mann und Frau wird bespitzelt von feindlichen Familien mit Millionen Angehörigen, es gibt kein Privatleben im Krieg, alles ist Partei.
Richaud erzählt in seinem „Buch der Nacht“ von den Bedürfnissen eines Kindes und einer Frau. Dem Krieg als Alltag der Frauen und Kinder. Der Kampf setzt sich im Verhalten des Dorfes fort. Und im Inneren der Seelen der Figuren. Albert Camus hat dieses Buch stark beeindruckt, er las darin Dinge, „die ich kannte“.
Manchmal kommt der Krieg auch ganz deutlich ins Dorf und wird anschaulich und angreifbar. In Gestalt der Kriegsgefangenen. Oder als Flüchtlinge ankommen, und jeder sich einen auswählen soll, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Thérèse entscheidet sich für ein Mädchen, das daraufhin schreiend von seiner Mutter getrennt wird. „Der kleine Platz wurde, durch die Anwesenheit des Mädchens verzaubert, zu einem schlafenden Schlachtfeld“, beschreibt Richaud die Szene danach und man wünscht weniger empathischen Menschen diese Lektüre. „Sie hatte brennende Mauerstücke einstürzen, Möbel aus zersprengten Häusern fliegen sehen; sie hatte Menschen und Tiere brüllen hören, deren Leben sich in langen, schwarzen Spritzern auf das versengte Gras ergoss. Wie konnte sie da nicht sämtliche Zauber des Kriegs mitbringen?“
Richaud reichte sein Manuskript bei der Jury des „Prix du premier roman“ der Revue hebdomadaire ein. Der Text fiel auf, er ragte hervor, aber aufgrund der Debatten, die er auslöste, setzte die Jury die Preisvergabe aus. Ein Jahr später, 1931, wurde der Roman von Bernard Grasset veröffentlicht. Der 1907 geborene Autor konnte sich mit seinen weiteren Werken allerdings nicht durchsetzen, er verarmte, ließ sich 51-jährig in ein Altenheim einweisen und starb kurz nach seiner Wiederentdeckung 1968 an Tuberkulose. Mit der Übersetzung von Sophie Nieder wurde „Der Schmerz“ zum ersten Mal ins Deutsche übertragen. Eine Entdeckung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!