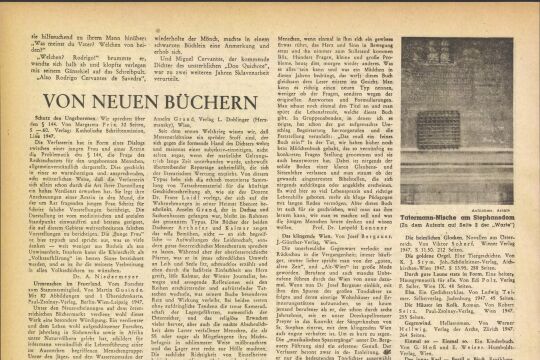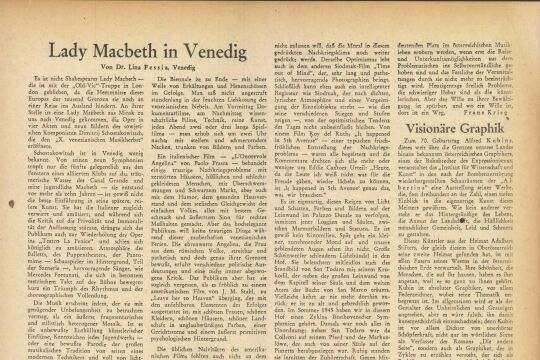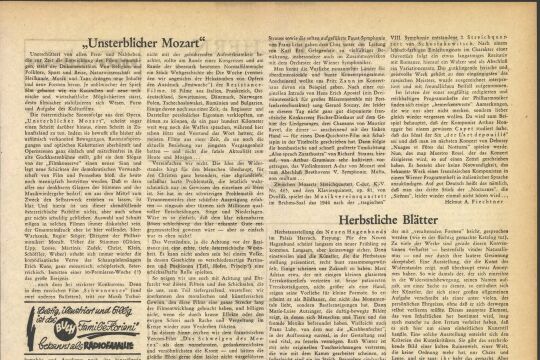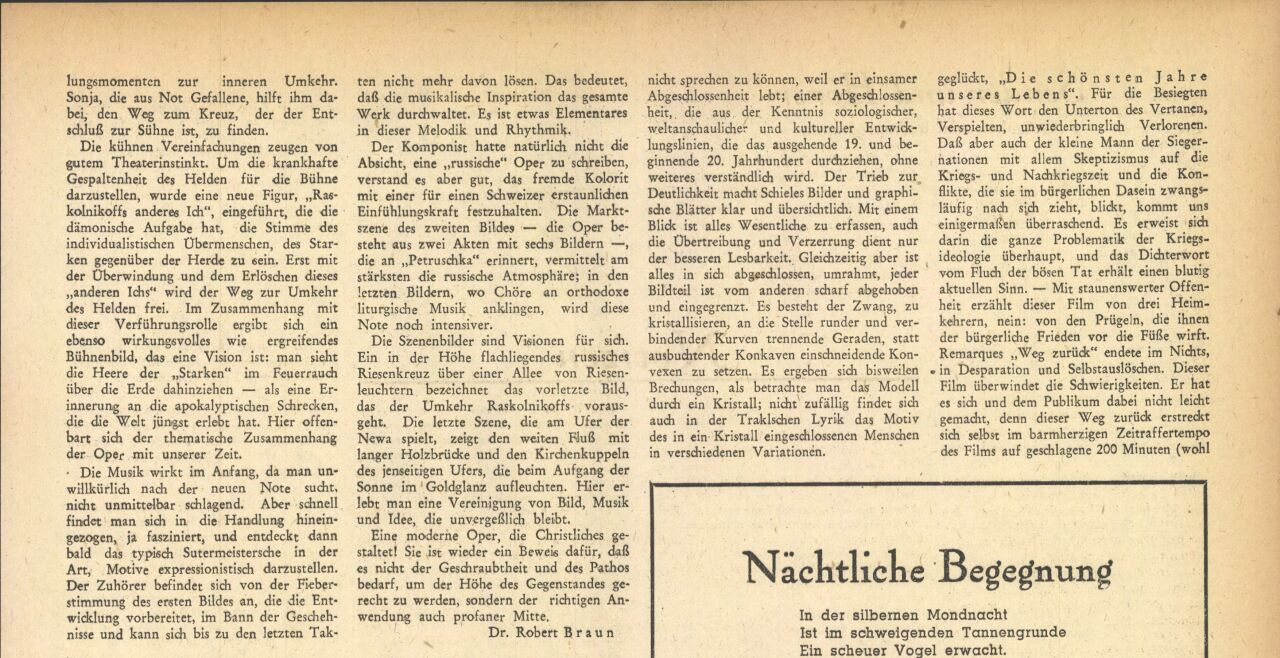
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Symphonie im Bild
Dieser ungewöhnlichen Premiere — klassische Musik, dargeboten von den Wiener Philharmonikern, in Salzburg und Wien als Kurzfilme aufgenommen — hat man mit einigem Bangen entgegengesehen. Dem unbestrittenen Vertrauen in die Leistung des Klangkörpers stand das grundsätzliche Bedenken gegen das Experiment der „photographierten Musik" entgegen. Um so angenehmer die Überraschung darüber, daß der Versuch im ganzen und in vielen Einzelheiten gelungen ist.
Ein bedachtes Crescendo und Decrescendo bestimmte den interessanten Premierenvormittag. „Eine kleine Nachtmusik“ machte den Anfang, irgendwie befangen, nicht präzise synchron, zu sehr am Porträt des Dirigenten klebend. Effektvoller die „Tann- häuser“-Ouvertüre, reizend eine Weih nachtsidylle mit den Sängerknaben. Dann die beiden Höhepunkte, Beethovens „Fünfte", 1. Satz, und Schuberts „h-moll“, 1. Satz, und als schwebender, leider um eine Nuance zu solide gefaßter Ausklang der „Kaiserwalzer“.
Über alles Lob erhaben Geste, Ton und Vortrag der Philharmoniker, Tonaufnahme und -Wiedergabe. Regie und Kamera — hier kaum zu trennen, denn darauf kam es ja letzten Endes an! — zeigen Delikatesse und Sparsamkeit in den Tricks der filmischen Auflockerung und beschränken sich auf Kamerawanderung über die Dirigentengeste ein paar schöne Einblendungen der Hände in Großaufnahme!, Instrumentengruppen und Solisten, auf eigenwillige Prospekte und einiges ganz weniges, nicht immer zwingendes Requisit. Diese künstlerische Disziplin kommt der musikalischen Konzentration sehr zustatten, hätte aber doch beim Straußwalzer die Ausnahme einer weniger exakten, mehr liebenswürdigen optischen Komposition das Orchester sitzt wohlgesittet da wie ein Sängerbund beim Photographen! wohl vertragen. An Dirigentenpersönlichkeiten mag Wien noch über dekorativere und temperamentvollere als die gezeigten verfügen, doch können kommende Filme das Versäumte noch nachholen.
Im ganzen sind Regisseur Leopold Hainisch mit diesen Miniaturkonzerten kleine Meisterwerke gelungen, die ebenso eine wertvolle Bereicherung des heimischen Programms wie eine repräsentative Gabe fürs Ausland darstellen.
So wie wir selber nach dem ungewollten Vabanquespiel mit Leben und Tod langsam wieder die Andacht zum Kleinen lernen, ist auch der Film unserer Tage dem Pathos abgeneigt. In diesem neuen Realismus ist Hollywood wieder einmal ein Meisterstück geglückt, „Die schönsten Jahre unseres Lebens“. Für die Besiegten hat dieses Wort den Unterton des Vertanen, Verspielten, unwiederbringlich Verlorenen. Daß aber auch der kleine Mann der Siegernationen mit allem Skeptizismus auf die Kriegs- und Nachkriegszeit und die Konflikte, die sie im bürgerlichen Dasein zwangsläufig nach s;ch zieht, blickt, kommt uns einigermaßen überraschend. Es erweist sich darin die ganze Problematik der Kriegsideologie überhaupt, und das Dichterwort vom Fluch der bösen Tat erhält einen blutig aktuellen Sinn. — Mit staunenswerter Offenheit erzählt dieser Film von drei Heimkehrern, nein: von den Prügeln, die ihnen der bürgerliche Frieden vor die Füße wirft. Remarques „Weg zurück" endete im Nichts, in Desparation und Selbstauslöschen. Dieser Film überwindet die Schwierigkeiten. Er hat es sich und dem Publikum dabei nicht leicht gemacht, denn dieser Weg zurück erstreckt sich selbst im barmherzigen Zeitraffertempo des Films auf geschlagene 200 Minuten wohl eine der längsten Spielzeiten, die die Filmgeschichte kennt, doch lohnt sich wohl eine jede einzelne Minute, denn dieser Film mit seinen hohen menschlichen Werten und seinen tausend kostbaren Bagatellen gehört zu dem Schönsten und Wertvollsten, was der problematische Strahlenfänger Film in seinen fünfzig Jahren von der menschlichen Seele abbilden konnte.
Der klassisch einfachen, großen Melodie dieses Films sekundiert in diesen Tagen die „K1 e i n e M e 1o d i e aus Wien“. Auch dieser österreichische Film ist bei aller gelassenen Heiterkeit ein Nachkriegskind, auch er ein versteckter Kritiker und Mahner; denn in der volkstümlichen Figur der Haushälterin Zwettl, die mit einer Herzensroheit ohnegleichen inmitten aller Dreizimmerherrlichkeit eines zivilen Scheinfriedens der zwangsweise eingewiesenen Kriegerswitwe mit ihren drei „Bankerten“ das Leben zur Hölle macht, und in dem Hauptmieter Griebichler, der sich durch die Einweisung der neuen Untermieter in die tragische Rolle des „Obdachlosen“ hineinsäuft, wird eine ganze verbitterte Armee ewig Wohnungssuchender nicht etwa mit Schadenfreude und Genugtuung, eher mit kaltem Grauen eine Abart, eine Spielart des goldenen Wiener Herzens wiedererkennen, die kein Trugbild, kein Traumbild des Films ist, sondern eine Tatsache, über die gemeiniglich schamhaft geschwiegen wird. Aber auch dieser Film saubere Spielleitung E. W. Emos, witzige Kameraführung Fritz Woditzkas, kernige Volkstypen Annie Rosars und Paul Hörbigers findet einen Weg ins Freie: erlösende Wiener Fröhlichkeit. Ein schönes und filmisch vertretbares Happyend, wenn auch im Grunde keine sehr fundierte Lösung der Wiener Wohnungssorgen.
Ein ähnlich starkes Thema aus der Zeit — der Mensch im Kampf gegen Büro und Paragraph — versucht das deutsche Lustspiel Ostzone „Die Abenteuer des Herrn Fridolin B.“ stacheliger, boshafter zu entwickeln. Doch scheitert es — ganz abgesehen von der unglaublich leichtfertigen Auffassung in Dingen der Ehe — an der Verschrobenheit des Stilexperiments. Es ist alles zu gewollt, zu verkrampft, zu professoral. Die Satire ist nicht die Stärke des deutschen Lustspiels. Wäre Nestroy an der Spree geboren, so wäre die Welt um einen bissigen Studienrat reicher, aber um einen Aristophanes ärmer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!