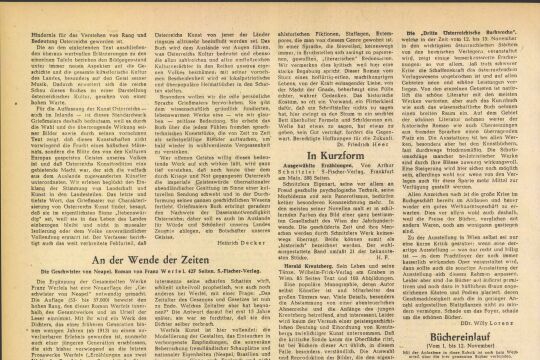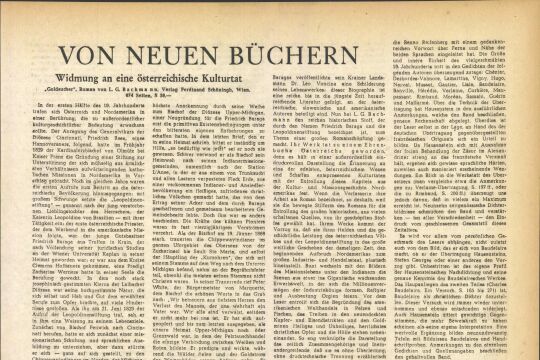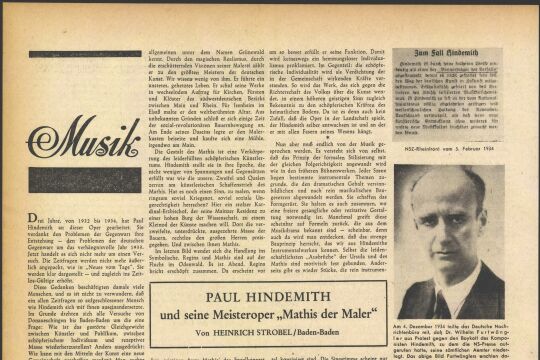Tommy Orange: "Dort dort"
Die Geschichte hat sie verschwiegen, ihre Kultur wurde vernichtet, als Klischees wurden sie vermarktet: Tommy Orange erzählt in seinem Roman vom Leben urbaner Indianer der Gegenwart.
Die Geschichte hat sie verschwiegen, ihre Kultur wurde vernichtet, als Klischees wurden sie vermarktet: Tommy Orange erzählt in seinem Roman vom Leben urbaner Indianer der Gegenwart.
Als Filmfiguren wie Winnetou waren sie ja auch hierzulande bekannt. Allerdings wurden sie nicht von Indianern gespielt, sondern von Weißen. Die Indianer fehlten auch in der westlichen Geschichtsschreibung jenseits der Abenteuerfiktionen, jedenfalls bis in die 1960er-Jahre. Tatendurstige „Pionierfarmer“ drangen „wagemutig in die Weiten des Westens“ vor, besiedelten diesen und verhalfen dem Land „durch ihrer Hände Arbeit zu beispiellosem Wohlstand“. So lautete die Geschichte, die sich die USA von sich selbst erzählten, wie Aram Mattioli in seiner aufschlussreichen Geschichte der Indianer Nordamerikas festhält („Verlorene Welten“, Klett-Cotta 2017).

Liebe Leserin, lieber Leser
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Die Ureinwohner, die sogenannten Indianer, blieben in dieser Erzählung unsichtbar, als sei ein menschenleeres, kulturleeres Land besiedelt worden. Und sie wurden zum Verschwinden gebracht im Lauf der Jahrhunderte. Von bis zu zehn Millionen Indianern nördlich des Rio Grande im Jahr 1492, als Kolumbus meinte, Indien zu entdecken, schrumpfte ihre Zahl bis 1900 auf 237.000. Sie waren umgekommen durch Todesmärsche, Epidemien, Massaker (wie etwa jenes von Sand Creek), Kopfgeldjagden, Vernachlässigung in den Reservaten.
Mit der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 begann zudem eine enorme gesellschaftliche Umwandlung. Die neuen Eliten bestimmten nun, wie die Native Americans ihr Leben zu leben hatten, an den Rändern der neu entstehenden Gesellschaft. Die Natives, Hunderte unterschiedlicher Völker mit eigenen Kulturen, verloren ihre Lebensräume, ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, ihre kulturelle Selbstbestimmung, bis sie im späten 19. Jahrhundert in Reservaten ihrer Kultur so sehr entfremdet wurden, dass sie sich in der Gesellschaft auflösten, so Mattioli. Die Wissenschaft spricht hier von Ethnozid: „vorsätzliche, von Staats wegen betriebene Zerstörung indigener Kulturen“.
Assimilierung, Auslöschung
„Uns in Städte zu bringen sollte der letzte Schritt unserer Assimilierung sein, unserer Absorption, Auslöschung, die Vollendung einer fünfhundertjährigen Völkermordkampagne“, schreibt Tommy Orange im Prolog zu seinem Romandebüt „There There“, das nun auf Deutsch erschienen ist: „Dort dort“. Indian Relocation Act nannte sich das, „der wiederum Teil der Indian Termination Policy war, die genau das war und ist, wonach sie sich anhört. Sollen sie aussehen und sich verhalten wie wir. Sollen sie wir werden. Und auf diese Weise verschwinden.“
Doch es gibt sie, die urbanen Indianer, sie haben überlebt. Man nannte sie „Bürgersteigindianer. Verstädterte, oberflächliche, unauthentische, kulturlose Flüchtlinge.“ Sie haben sich die Stadt angeeignet, besitzen aber auch die Erinnerungen und Traditionen ihrer Vorfahren. Selbst wenn diese von den Eltern oder Großeltern verschwiegen wurden – ein Merkmal enormen Assimilationsdrucks durch eine Gesellschaft –, kramen die jüngeren, denen die Blicke der Weißen sagen: „Ihr seid anders als wir“, sie wieder hervor, in teils hilflosen Versuchen der Selbstvergewisserung. So bringen sie sich etwa indianische Tänze per YouTube-Videos bei.
Wer bin ich? Wer sind wir? Diese typisch menschlichen Fragen stellen sich hier auf besondere Weise. Was heißt es, „Indianer“ zu sein? Wer definiert das und wozu? Muss man sich verkleiden, um ein echter Indianer zu sein? Kann man noch von Medizinkisten schreiben und von der Kraft von Dachsfellen und Glückslöffeln, oder geht man damit schon der Klischeemaschine auf den Leim?
Man kann, zeigt Tommy Orange mit seinem Roman, in dem er unter anderem gerade die jüngere Generation wichtige Fragen diskutieren lässt: Da hat der eine Sehnsucht nach der Tradition, da stellt der andere die berechtigte Frage: Wofür brauchen wir das heute, sollen wir uns nicht eine neue Tradition erfinden? Und bedeutet nicht das Rekurrieren auf das genetische Erbe, das Blut, selbst einem Rassismus zu huldigen, der auch in der Blutanteilsregelung sichtbar wurde, mit der 1705 in Virginia die Indianer eingeteilt wurden in Vollblut, Halbblut usw.? Spricht nicht jener wahr, der sagt: „Dieser ganze Blut-Scheiß, da bin ich mir nicht sicher.“
Miteinander verbunden
All das verhandelt Tommy Orange in seinem Roman, der auf den ersten Blick wie eine Sammlung von abgeschlossenen Short Storys wirkt. In kurzen Texten werden unterschiedliche Leben erzählt, manchmal auch in Ich- und Du-Form. Starke Frauen erinnern ihre Kinder an die Geschichten, aus denen die Welt besteht, Großmütter und -tanten halten die Familien zusammen. Erst nach und nach merkt die Leserin, dass diese Figuren etwas verbindet, dass die einzelnen Leben miteinander verknüpft sind.
Folgerichtig läuft der Roman auf ein Finale hinaus: Beim großen Powwow versammeln sich Stämme, Generationen, Familien. „Wir haben die Powwows geschaffen, weil wir einen Ort zum Zusammensein brauchen. […] Wir kommen meilenweit. Wir kommen durch Jahre, Generationen, Leben, geschichtet in Gebeten und handgewebten Trachten, perlenbesetzt und zusammengenäht, federgeschmückt, geflochten, gesegnet und verflucht.“ Der Vergleich mit dem Original macht das Problem des Übersetzens sichtbar: „Weʼve been coming from miles. And weʼve been coming for years, generations, lifetimes, layered in prayer and handwoven regalia, beaded and sewn together, feathered, braided, blessed, and cursed.“
Es ist nicht schön, was man bei diesem Fest zu sehen bekommt. Was dort passiert, wird dann in einem Stil erzählt, der an Drehbücher erinnert. Es ist auch nicht schön, was man bis dahin von den unterschiedlichen Leben erfährt: Alkoholismus, Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, Drogen, fetales Alkoholsyndrom. „Einige von uns tragen die ganze Zeit dieses Gefühl in sich, etwas falsch gemacht zu haben. Als wären wir selbst irgendwie falsch. [...] Also verstecken wir uns.“ Aber immer wieder spürbar: der Wille zu leben, der Wunsch nach Kultur, nach einem Ort, wo man hingehört.
„There is no there there“, schrieb Gertrude Stein einst über die Stadt Oakland, in der 1982 der Autor geboren wurde und wo er seinen Roman ansiedelt. Den Ort ihrer Kindheit gab es für sie damals nicht mehr. Das passierte auch den Ureinwohnern, heißt es im Roman von Tommy Orange. „Aber für die Ureinwohner dieses Landes, des ganzen amerikanischen Doppelkontinents, ist das alles neu bebautes, vergrabenes Ahnenland, Glas und Beton und Draht und Stahl, unwiederbringliche, bedeckte Erinnerung. Es gibt dort kein Dort.“ In der Übersetzung geht leider die Steinʼsche Sprachmelodie und einiges an Poesie verloren. „There There“ verweist zudem nicht nur auf einen Song von Radiohead – „Just ʼcause you feel it doesnʼt mean itʼs there“ –, sondern auch auf die tröstenden Worte „there there“ im Sinn von „schon gut, ganz ruhig“. „There there“: Dieser Ton hallt nach der Lektüre noch lange nach.

Dort dort
Roman von Tommy Orange
Aus dem Engl. von Hannes Meyer
Hanser 2019
283 S.,geb., € 22,70

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!