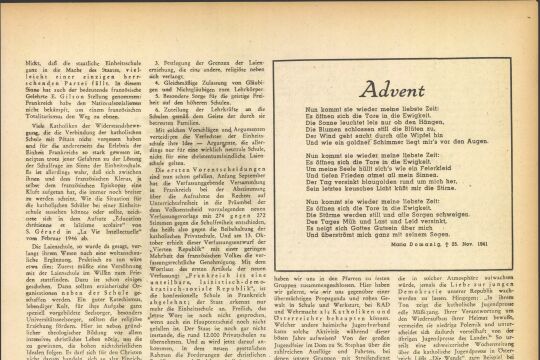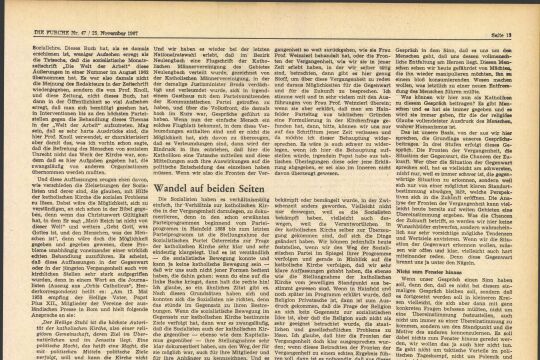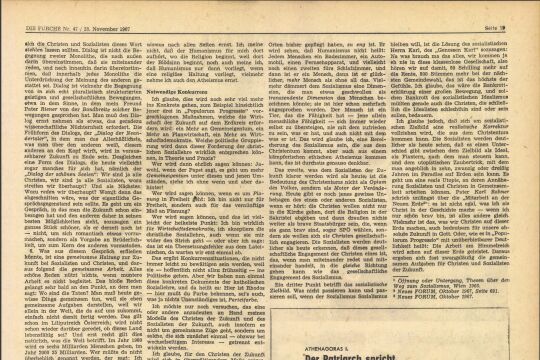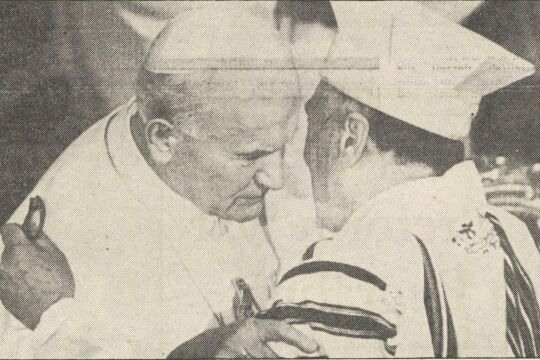Aleida Assmann: "Denkmäler erzählen Sieger-Geschichte"
Aleida Assmann gilt als eine der bedeutendsten Expertinnen für Erinnerungskultur. Ein Gespräch über Denkmalstürze, Heiligenbilder, Stolpersteine und den Streit um das Vergleichen von Geschichte.
Aleida Assmann gilt als eine der bedeutendsten Expertinnen für Erinnerungskultur. Ein Gespräch über Denkmalstürze, Heiligenbilder, Stolpersteine und den Streit um das Vergleichen von Geschichte.
Seit Wochen wird die Weltöffentlichkeit von umstürzenden Statuen aufgeschreckt. Für die Kulturwissenschafterin Aleida Assmann ist das nicht neu: Seit den 1990er Jahren beschäftigt sie sich mit den Dynamiken kulturellen Gedächtnisses. Was sagt sie zu den aktuellen Ereignissen? Und zum Vorwurf, durch ihre Forderung nach transnationaler Erinnerung würde die Singularität des Holocaust relativiert?
DIE FURCHE: Frau Professor Assmann, weltweit werden gerade Denkmäler demontiert: Der Sklavenhändler Edward Colston wurde ins Meer gekippt, aber auch Statuen von Kant und Churchill wurden beschmiert. In Berlin hat man unlängst der „Hockenden Negerin“ des NS-Bildhauers Arminius Hasemann den Kopf abgeschlagen. Wie erleben Sie diesen globalen Denkmalsturm?
Aleida Assmann: Natürlich mit allergrößtem Interesse. Dass Statuen vom Sockel gestürzt werden, ist zum einen ja ganz normal, wenn ein politischer Regimewechsel passiert. Wir wissen noch, als die USA im Irak eimarschierten und die Saddam-Hussein-Statue stürzten, diese Bilder waren Teil eines (Symbol-)Krieges. Auch 1990 und danach haben wir erlebt, dass allein in der Ukraine mehr als tausend Lenins vom Sockel gestoßen wurden. Neu ist jetzt, dass es einen Impuls gibt, der über nationale Grenzen geht und nicht durch einen politischen Machtwechsel ausgelöst wurde, sondern durch einen gesellschaftlichen Stimmungswandel. Plötzlich kommt etwas hoch, was schon länger in der Gesellschaft schwelte. Denkmäler sind jetzt das geeignete Medium, in dem sich diese Dynamik ausdrückt.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
DIE FURCHE: Aber wie kann man sich diesen Furor angesichts von Statuen überhaupt erklären? Was verkörpern sie?
Assmann: Denkmäler erzählen die Geschichte der Sieger. Und die Sieger halten einen Zustand der Gewalt fest. Die Frage ist, wer damit ausgeschlossen wird und wann sich die Verlierer Gehör verschaffen. Nehmen Sie als Beispiel den Spanischen Bürgerkrieg: Franco hat das gesamte Land danach mit seinen Denkmälern übersät, es ist voll davon. Die Gegenseite hat kein einziges Denkmal. Deren Geschichte ist in Massengräbern verscharrt, es sind anonyme Tote, die jetzt wieder von ihren Familien exhumiert und bestattet werden. Die Geschichte spielt immer eine Rolle – und die Frage ist, ob man zur Geschichte, wie sie offiziell vermittelt wird, noch steht oder nicht.
DIE FURCHE: Donald Trump nennt die Demonstranten „Terroristen“. Aber auch viele Intellektuelle orten bei den Aktivisten totalitäres Denken oder gar Barbarei.
Assmann: Es bringt uns keinen Schritt weiter, wenn wir die Eskalation durch Begriffe wie „Barbarei“ weiter schüren. Wie gesagt wird in Denkmälern die gewaltförmige Geschichte der Sieger betoniert. Die Gewalt gegen Statuen steht auf einer anderen Ebene: Es handelt sich hier um keine Gewalt gegen Menschen, sondern um die Gewalt derer, die sich gegen die an ihnen ausgeübte Gewalt wehren und dafür ein symbolisches Zeichen setzen. Es ist also eine Gewalt der zweiten Ordnung. Richtig ist, dass Denkmäler sich mit der Zeit neutralisieren, irgendwann nimmt man sie kaum noch wahr, aber sie enthalten eine Energie, die man auch wieder erneuern kann. Plötzlich sind sie wieder umkämpft, das hängt mit einer Geschichte der Ungleichheit zusammen – und in dieser aktuellen Form des Kampfes formieren sich die Fronten neu.
Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber dass man die Deutung der Geschichte gemeinsam ändert, ist ganz normal.
DIE FURCHE: Oft wird aktuell von „Bildersturm“ gesprochen. Ist dieser Begriff hier angebracht?
Assmann: Der Bildersturm ist eine Geschichte, die ein Jahrhundert früher stattgefunden hat, nämlich nicht im 18., sondern im 17. Jahrhundert. Damals wurden alle Symbole oder Heiligenbilder, die die Puritaner nicht mehr aushalten konnten, aus den Kirchen beseitigt. Der „Bildersturm“ war also Teil eines Religionskrieges: Keine Stellvertreter Gottes waren erlaubt, es ging um den direkten Zugang zu Gott. Wir haben nun keinen religiösen Krieg, sondern einen Krieg um die Deutung der Geschichte, genauer: der Nation, die im 19. Jahrhundert, nach Aufklärung und Säkularisierung, zum Träger des Heiligen wurde. Das Heilige wurde auf die Nation übertragen, und die Statuen sind so etwas wie der Heiligenkult der Nation, der Orientierung gibt und die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb sind sie auch so aufgeladen.
DIE FURCHE: Aber was wird erreicht, wenn diese aufgeladenen Steine einfach beseitigt werden?
Assmann: Es wird tatsächlich nicht viel erreicht, weil ja damit die Geschichte entsorgt wird. Und wenn man die Spuren der Geschichte löscht, kann man sie natürlich auch nicht mehr anders erzählen. Da schneidet man sich ins eigene Fleisch. Dabei ginge es ja gerade um eine neue Deutung der Geschichte, um die Frage, ob man die Geschichte auch anders erzählen kann. Statt sie zu entfernen, könnte man die Statuen auch mit Beschriftungen versehen oder sie woanders hinstellen: Sehr viele Lenins sind inzwischen in Statuenparks untergebracht worden, wo sie ihren friedlichen Ruhestand erleben. Man kann sie auch ins Museum bringen, wie in Berlin in der Zitadelle Spandau, wo das 19. Jahrhundert mit diesen Statuen zu besichtigen ist, dann sind sie Folklore.
Aber das Entscheidende bleibt tatsächlich: Wie erzählt man die Geschichte neu? Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber dass man die Deutung der Geschichte gemeinsam ändert, ist ganz normal. Wir haben unsere Geschichte in Deutschland x-mal neu anpassen müssen, das ist auch keine Geschichtsfälschung. Wir ändern nicht die Ereignisse, sondern die Bewertung und passen sie dabei an die Standards dessen an, was wir für gut und wahr halten.
Statuen sind so etwas wie der Heiligenkult der Nation, der die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb sind sie so aufgeladen.
DIE FURCHE: Apropos Deutschland: Schon vor der „Black Lives Matter“-Bewegung wurde in Berlin diskutiert, ob die faschistischen Statuen im Olympiapark zu entfernen seien. Aber auch das Olympiastadium selbst ist NS- Architektur. Wie soll man damit umgehen?
Assmann: Wir haben diese NS-Spuren überall, auch in Braunau am Inn, wo man diskutiert, ob man Hitlers Geburtshaus abreißen oder umwidmen soll. Eine Geschichte, die man hinter sich hat, bleibt in ihren Spuren überall noch präsent. Von der Theorie der Erinnerung her sage ich grundsätzlich: Es ist besser, hier keinen Schlussstrich zu ziehen, sondern vielmehr einen Trennungsstrich. Das heißt: Wir erinnern uns daran und stellen es aus, um zu zeigen, was uns von dieser Zeit trennt. Es ist der demokratische Weg der Ausstellung und nicht der Beseitigung der Spur. Hier haben unterschiedliche Städte aber unterschiedliche Zugänge: München setzt auf Weltoffenheit und darauf, die tiefen Spuren, die Hitler hier gegraben hat, nicht allzu sichtbar zu machen.
In Berlin ist es umgekehrt, hier werden diese Spuren massiv ausgestellt – bis hin zu den Stolpersteinen. Ein anderes Beispiel ist Nürnberg und sein Parteitagsgelände. Hier wird nichts schamhaft verschwiegen, sondern um diese Spuren herum werden Diskussionen angeregt. Denn im Vergessen kann man ja nicht Abstand nehmen, im Vergessen perpetuieren sich die Gedanken und können bis in die nächste und übernächste Generation weitergegeben werden. Deswegen ist es wichtig, dass man Orte hat, die uns als Steine des Anstoßes einen Ansporn bieten, diese Geschichten wieder und weiter zu erzählen.
.jpg)
Aleida Assmann
Die 1947 in Bielefeld geborene Anglistin und Ägyptologin forscht zu kulturellem Gedächtnis. Mit ihrem Mann Jan Assmann erhielt sie 2018 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Die 1947 in Bielefeld geborene Anglistin und Ägyptologin forscht zu kulturellem Gedächtnis. Mit ihrem Mann Jan Assmann erhielt sie 2018 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
DIE FURCHE: Sie plädieren für transnationales Erinnern. Zur Frage, inwiefern man Geschichte vergleichen könne, ist zuletzt in Deutschland eine hitzige Debatte entbrannt, ausgelöst durch den kamerunischen Historiker Achille Mbembe, der Parallelen zwischen dem Apartheidsystem, Israels Politik und der Shoa gezogen hat. Nun wurde er als Eröffnungsredner der Ruhr-Triennale ausgeladen. Der ehemalige „Welt“-Herausgeber Thomas Schmid hat auch Ihnen jüngst vorgeworfen, mit Ihrem Ansatz die Shoa zu verharmlosen und deren Singularität zu relativieren.
Assmann: Zunächst: Über die Singularität des Holocaust kann man sich in Deutschland überhaupt nicht mehr mit einem Federstrich hinwegsetzen, sie ist institutionell irreversibel etabliert – und es gibt sie in Deutschland auch in besonderer Weise, durch die Verantwortung des Tätervolks, auf das wir ja gefolgt sind. Wogegen ich mich aber wehre, ist eine Fixierung auf die Singularität, die dazu führt, dass in Deutschland keine andere Erinnerung mehr eine Chance hat, überhaupt Anerkennung zu finden (vgl. dazu auch die Antwort Assmanns auf die Kritik).
Zweitens wird in der Debatte unterstellt, wenn man vergleiche, habe man schon relativiert und den Holocaust geleugnet. Doch das ist absurd: Historiker vergleichen ständig, das ist trivial. Es kann auch nicht sein, dass Deutschland wieder auf einen Sonderweg geschickt wird und man den Menschen sagt: Ihr habt nichts mehr mit der Welt zu tun, ihr dürft auch nicht nachsehen, ob es etwa in Israel demokratiepolitische Probleme gibt – und das im Moment einer Annexionspolitik, die einen gravierenden Völkerrechtsbruch darstellt und eine friedliche Zukunft dieses Landes unmöglich macht. Oder dass wir auch nicht die Kolonialgeschichte beleuchten dürften, die ja in Europa die drängende nächste Etappe ist, wenn es ums Erinnern geht. Dass hier Maulkörbe und Scheuklappen verteilt werden, dagegen muss sich eine wachsame Zivilgesellschaft wehren.
Erinnern ist ja auch kein Nullsummenspiel. Darum geht es etwa im Konzept der „Multidirectional Memory“ von Michael Rothberg: Wenn ich mich auf den anderen beziehe, heißt das ja nicht, dass ich dem anderen etwas wegnehme, sondern dass ich mit den am Holocaust gewonnenen Kategorien selber weiterarbeiten kann. Das sind Formen eines lebendigen Umgangs mit Geschichte. Sonst würde sie kaltgestellt wie in einem Museum.
Wenn man Geschichte vergleicht, heißt es, man relativiere und leugne den Holocaust. Absurd.
DIE FURCHE: Tatsache ist aber, dass es innerhalb der „Black Lives Matter“-Bewegung auch antisemitische Töne gibt. Wie sehr besorgt Sie das?
Assmann: Wir haben im Moment generell eine Entwicklung, die den Unmut der Menschen in Wut verwandelt und die Wut in Hass und diesen Hass in Gewalt. Da gibt es im Moment eine brandgefährliche Dynamik. Wenn wir das nicht sehr ernst nehmen, kann das die Demokratie leicht zerstören. Auch in Deutschland haben wir viel Grund zur Sorge, es gab immerhin zwei grauenhafte Attentate: Das eine war in Halle zu Jom Kippur, als ein Attentäter das Modell Christchurch kopierte und alle erschossen hätte, wenn er durch die Tür gekommen wäre. Und kurz davor war Hanau, wo aus rassistischen Motiven 15 Menschen umgebracht worden sind. Das sind Anschläge auf Minderheiten und damit auf die Demokratie.
DIE FURCHE: Wo müsste man insbesondere bei den Jungen ansetzen, damit in der aktuellen Migrationsgesellschaft die Erinnerung an die Geschichte nicht noch mehr trennt, sondern verbindet?
Assmann: Ich bin gerade in einem großen Projekt involviert, das „Gemeinsinn“ heißt und mit der Corona-Krise gestartet ist. Gemeinsinn kann man nur entwickeln, wenn man die Fähigkeit hat, sich in andere hineinzuversetzen und zu verstehen, wie der andere tickt. Das kann man lernen: Statt immer nur darauf zu achten, was einen trennt, sollten wir mehr auf das achten, was wir gemeinsam haben. Wir untersuchen das auf drei Ebenen: Nation, Stadt und Schule. Gerade die Schule ist ja ein zentraler Ort, um Demokratie zu lernen.
Hier ginge es darum, Diversität einzuüben, die Perspektiven wechseln zu lernen und kooperativ miteinander zu arbeiten. Auch Jugendliche, deren Eltern anderswo geboren sind, können ihre Beziehung zu Auschwitz aufbauen – und denken dann vielleicht auch anders über den armenischen Genozid als ihre Eltern, die ihn weiter leugnen. Auch sie sind Teil der Nation und sollten Zugang zum nationalen Narrativ haben, das ja überall im öffentlichen Raum in Denkmälern und Stolpersteinen präsent ist. Ich glaube, eine Nation braucht ein gewisses Einverständnis über bestimmte Grundereignisse ihrer Geschichte: Genau das gibt es in den USA, wie wir jetzt sehen, offenbar nicht.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!