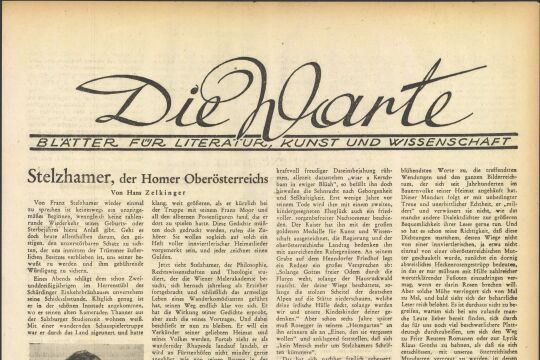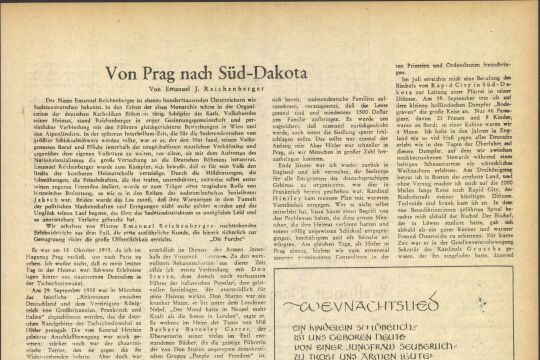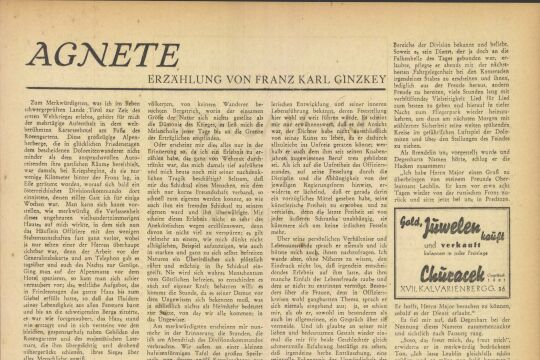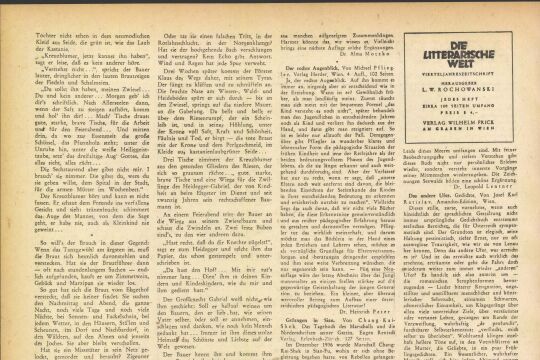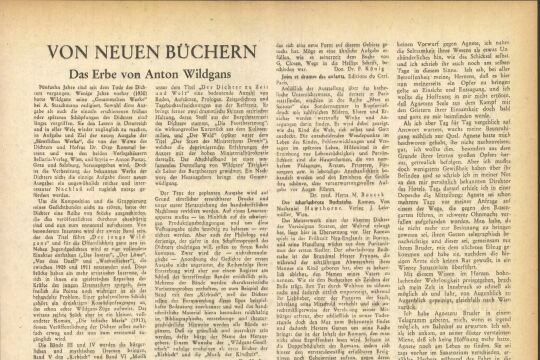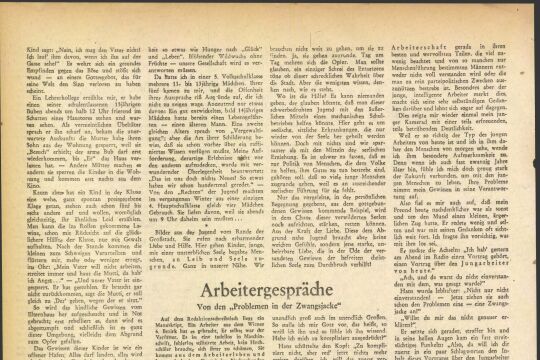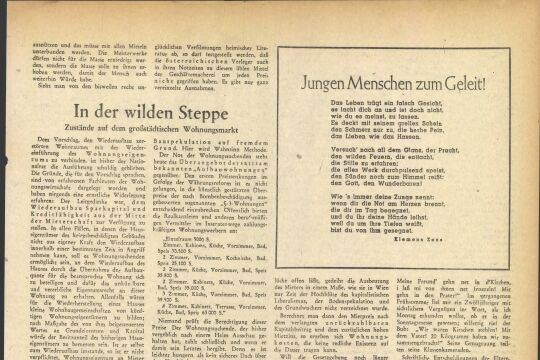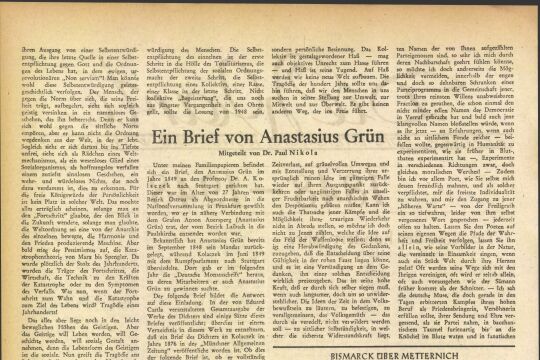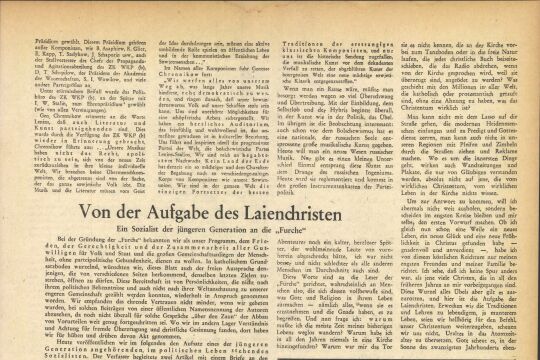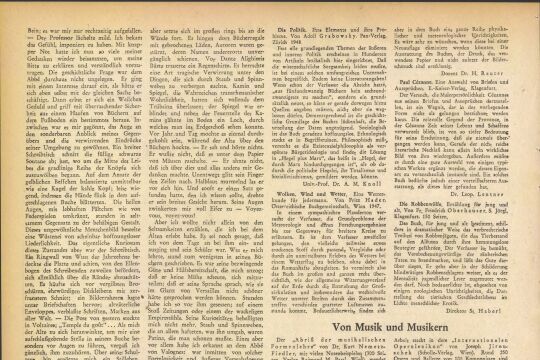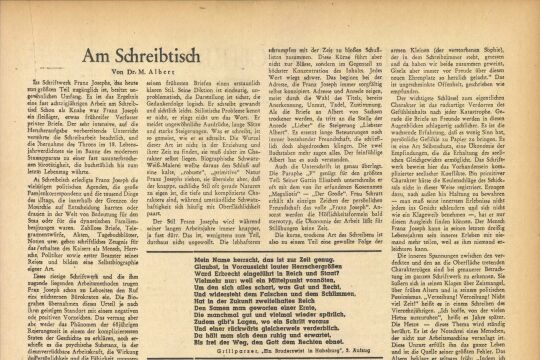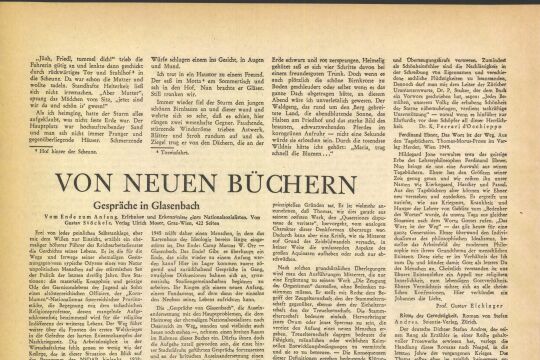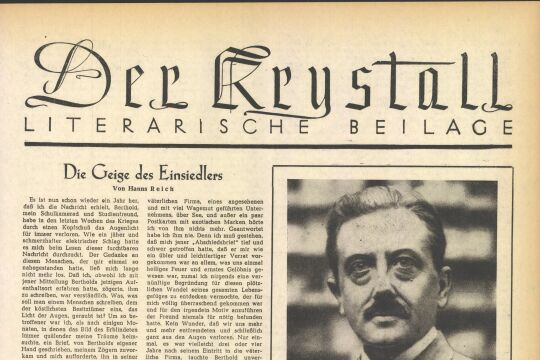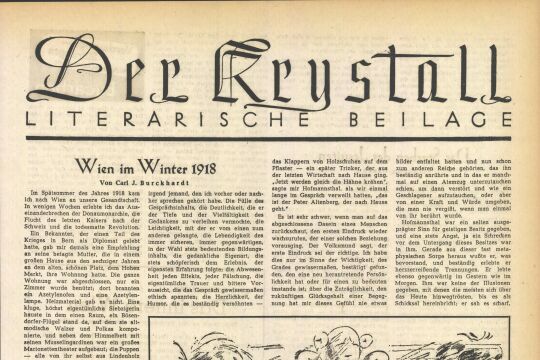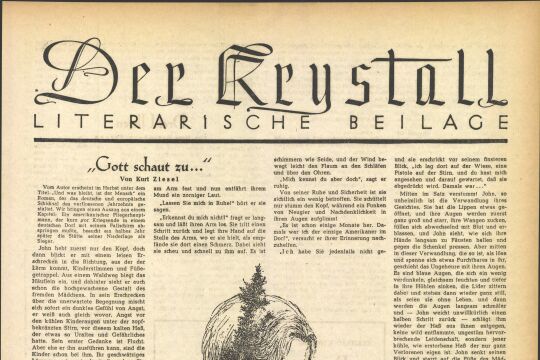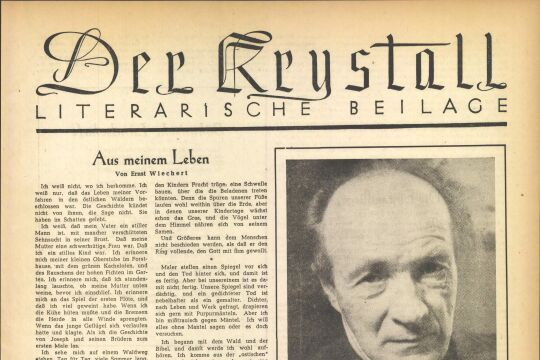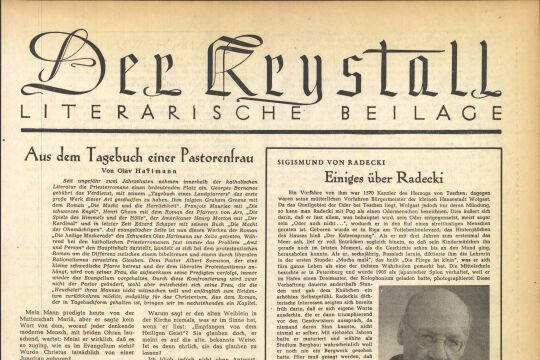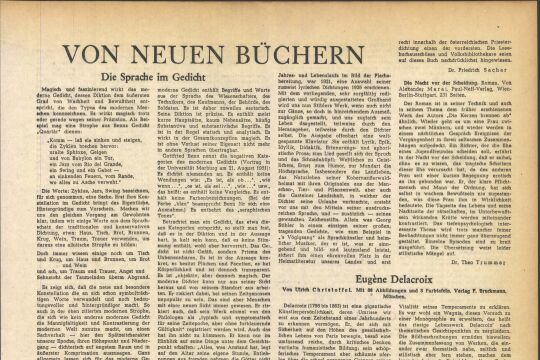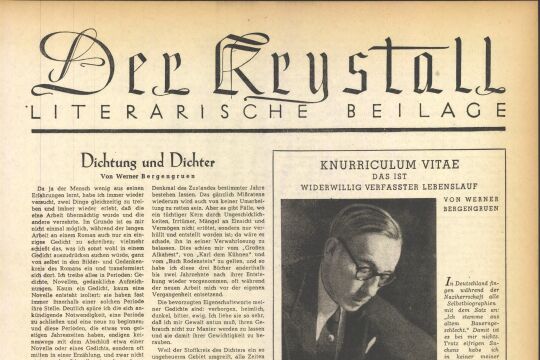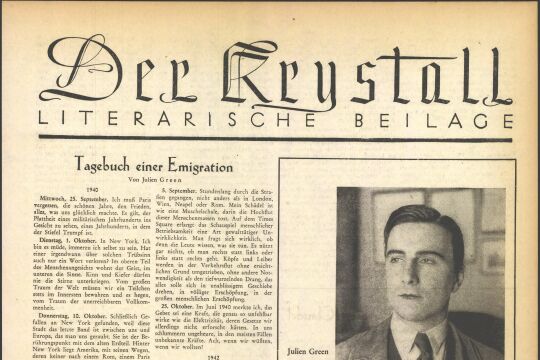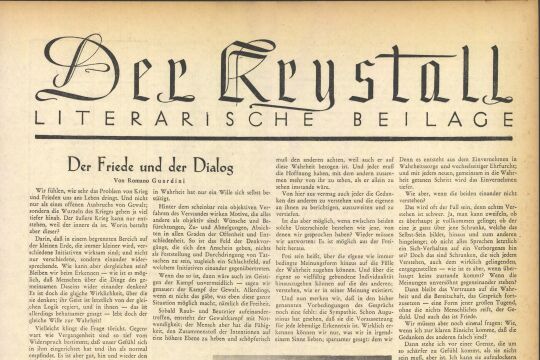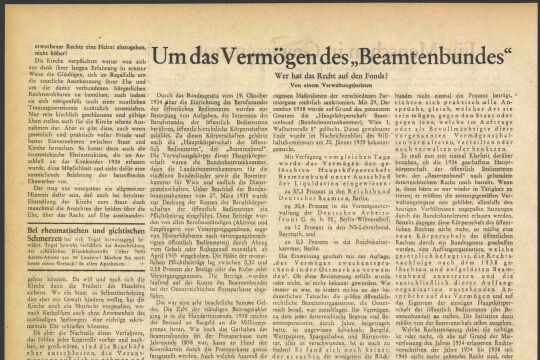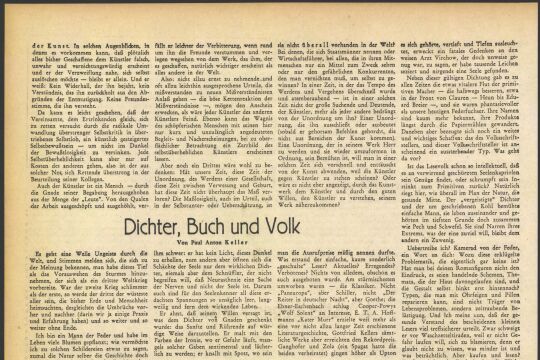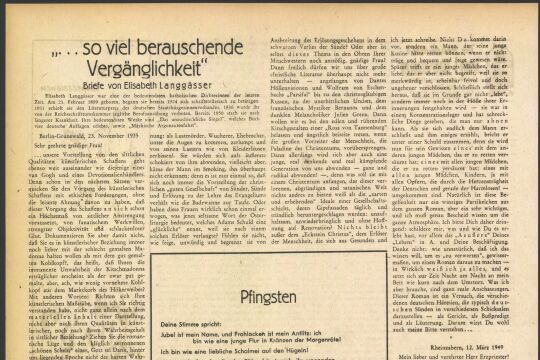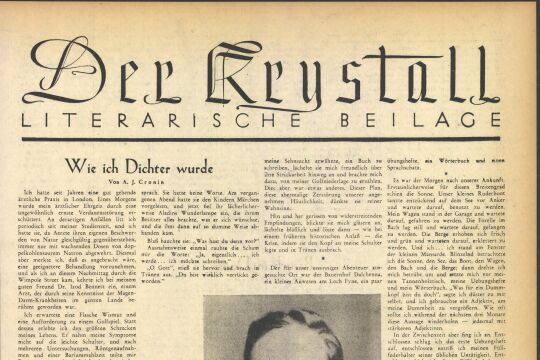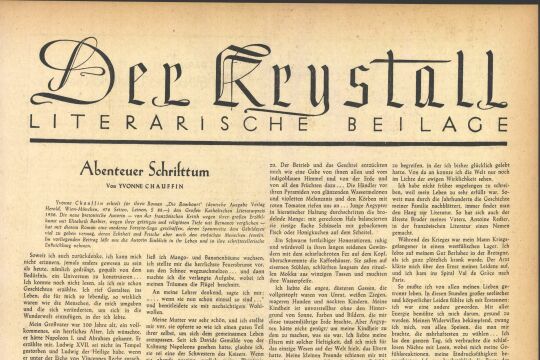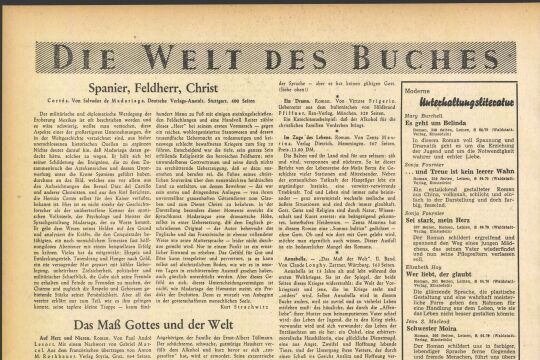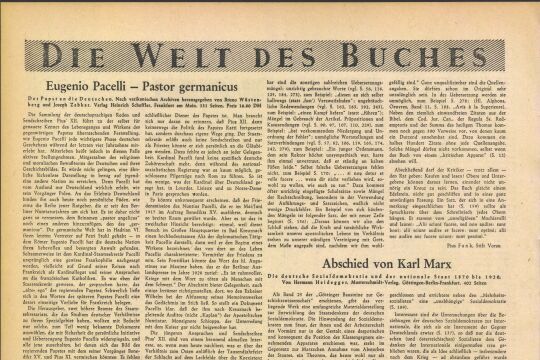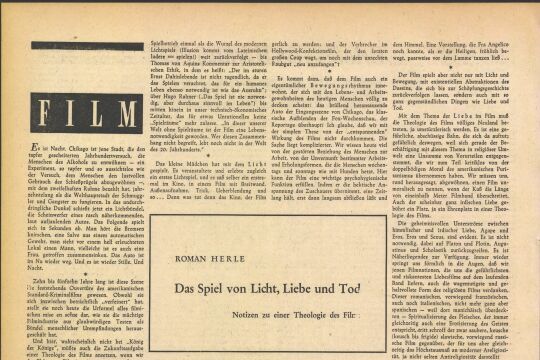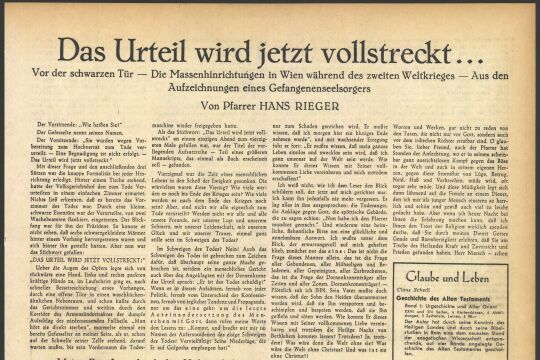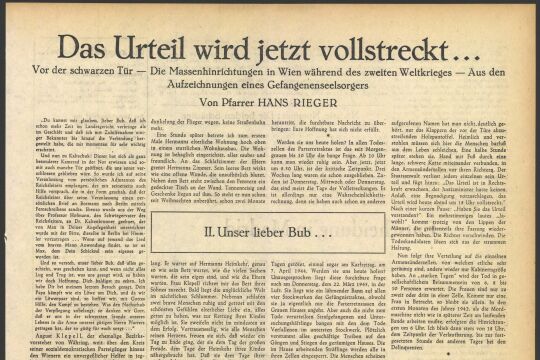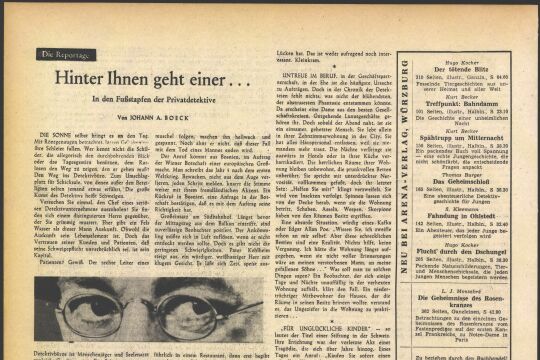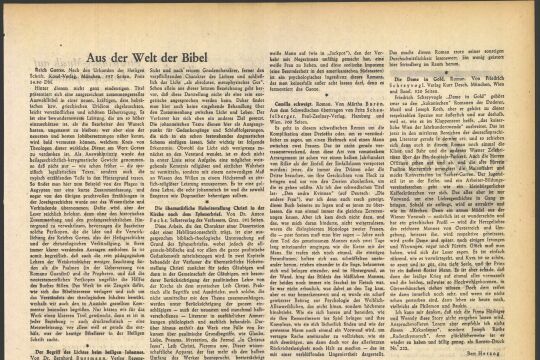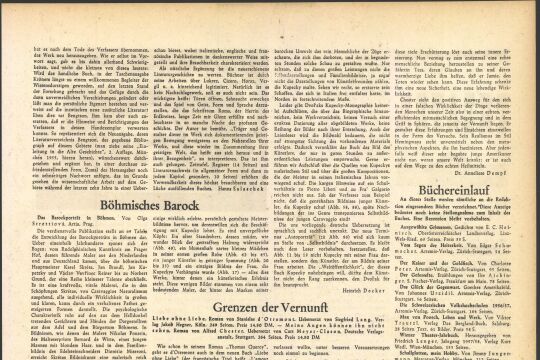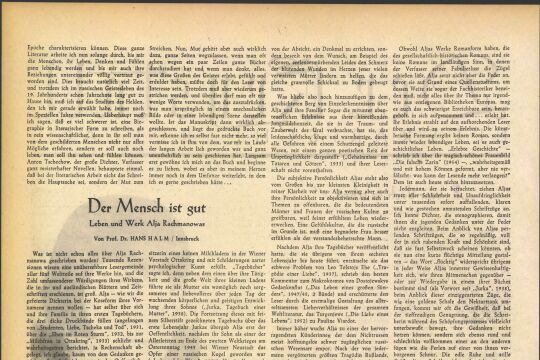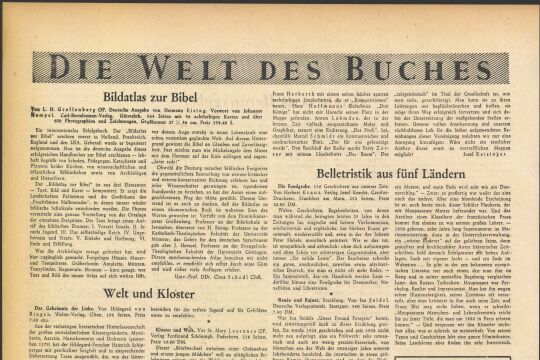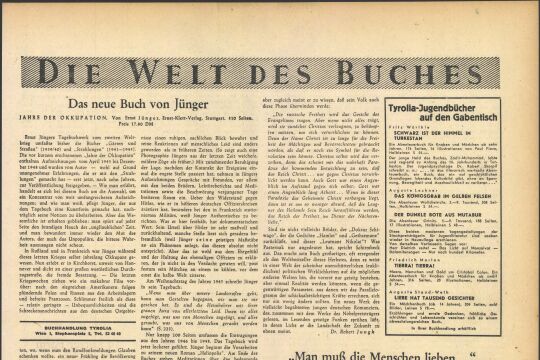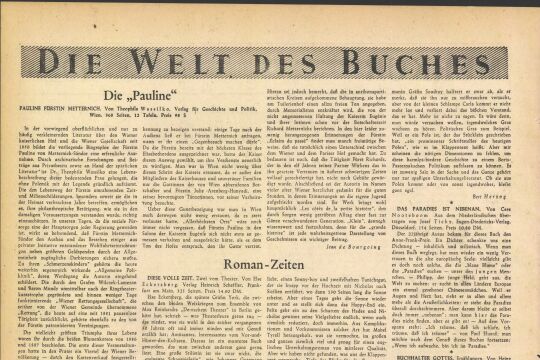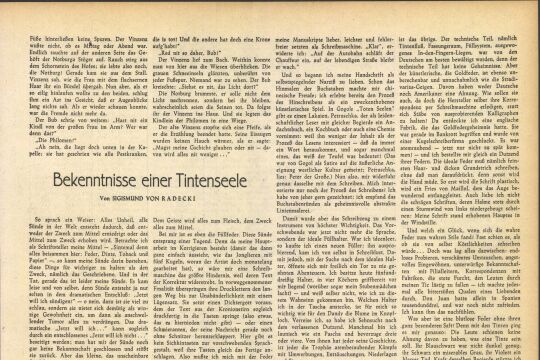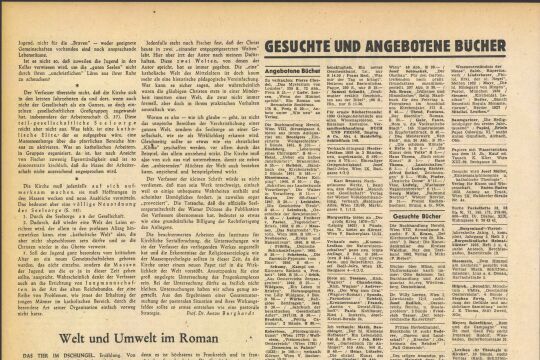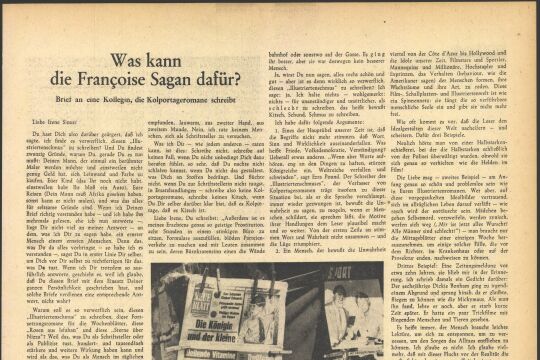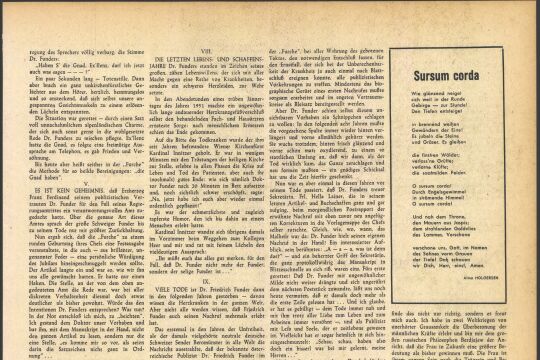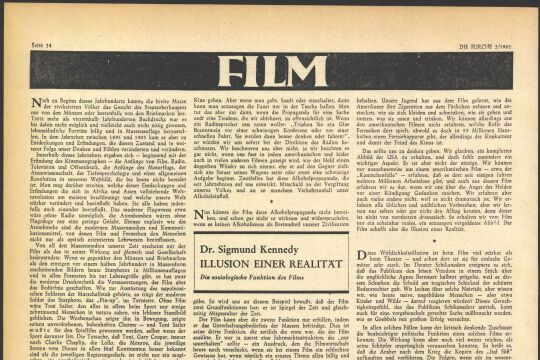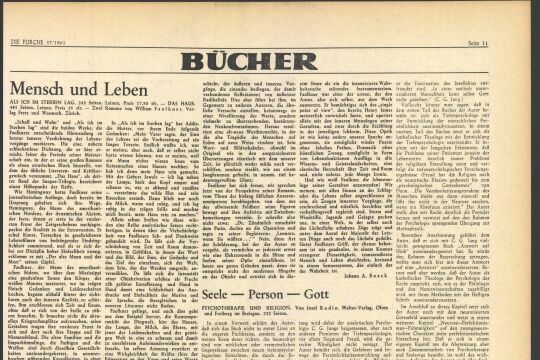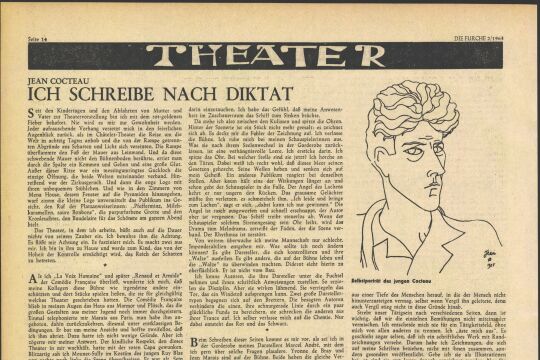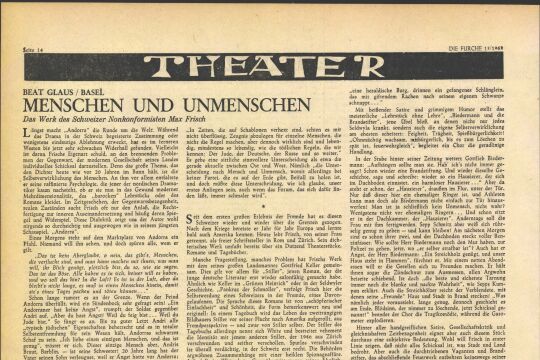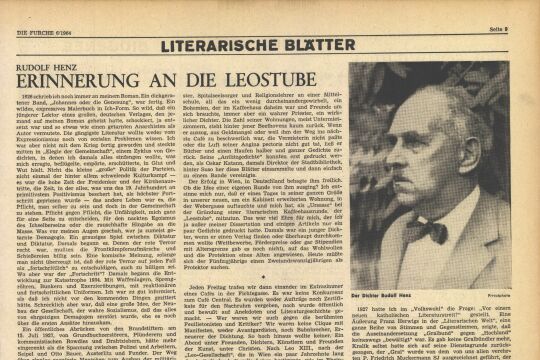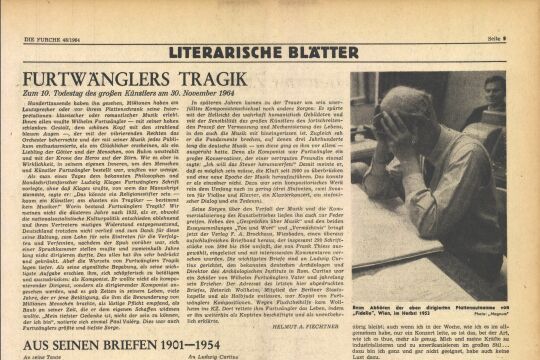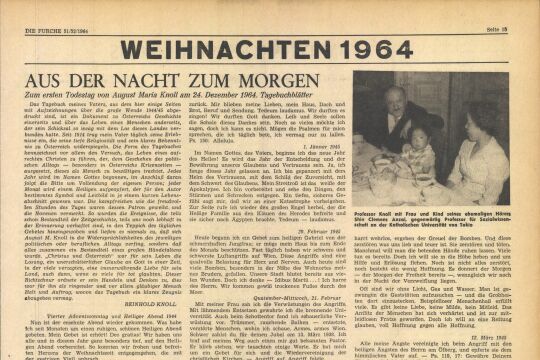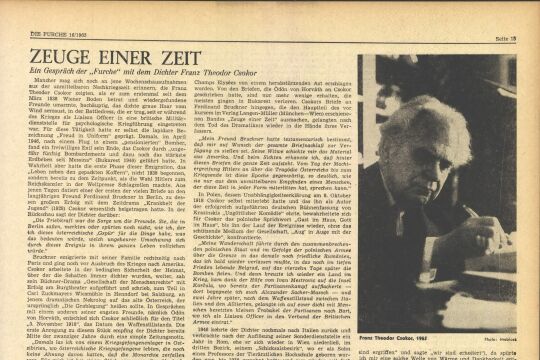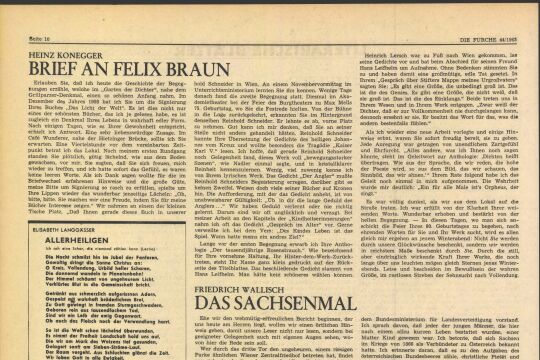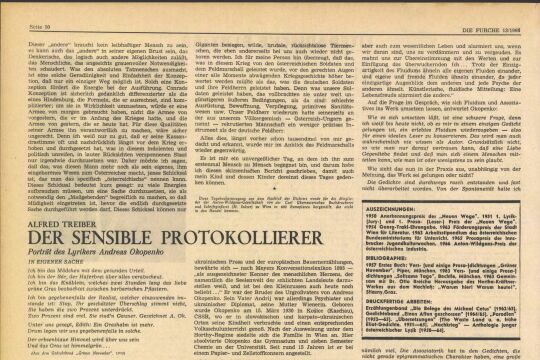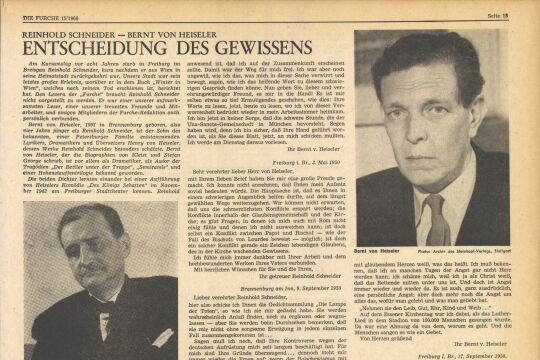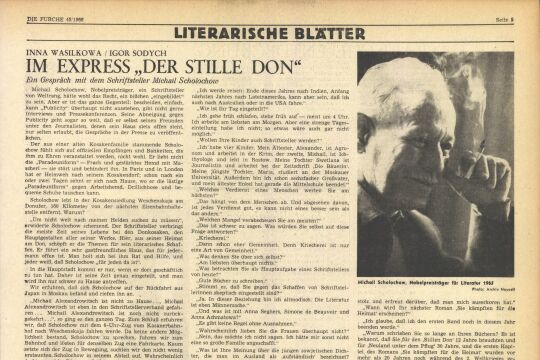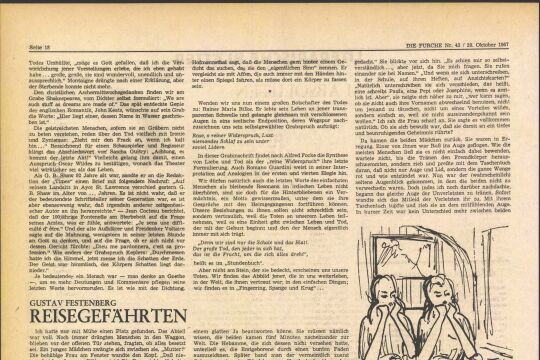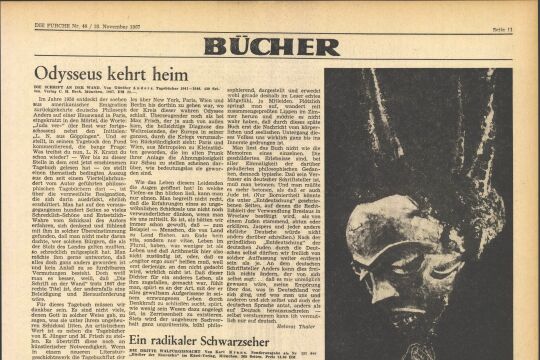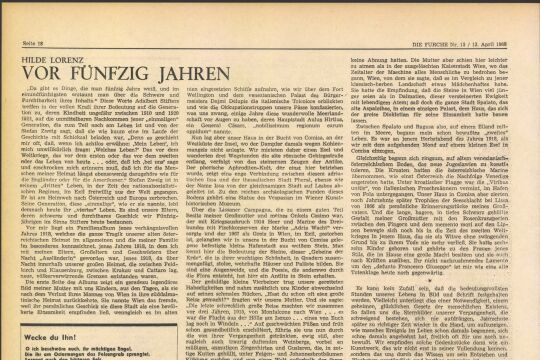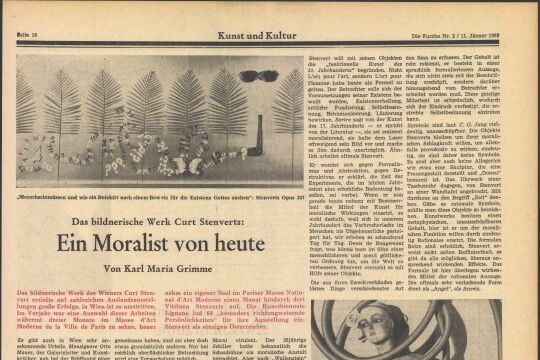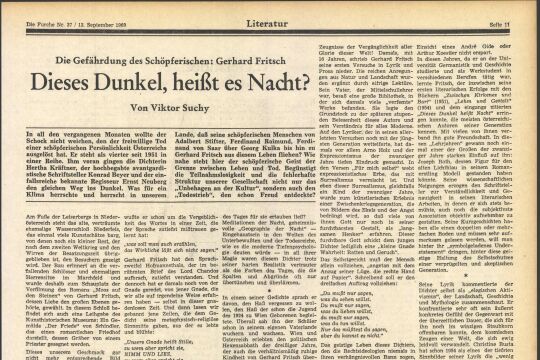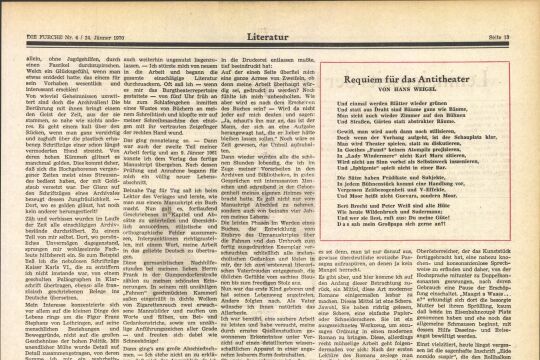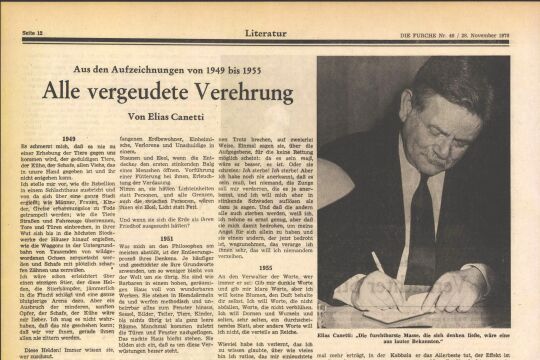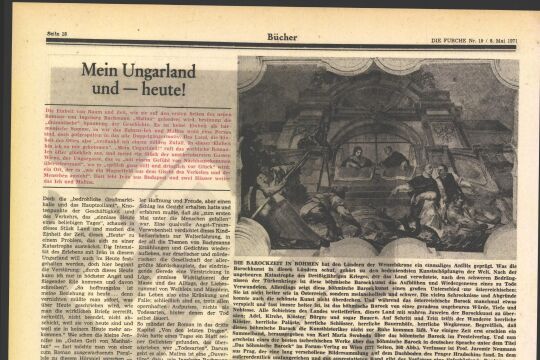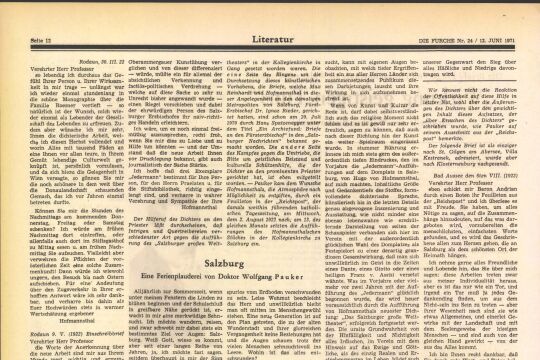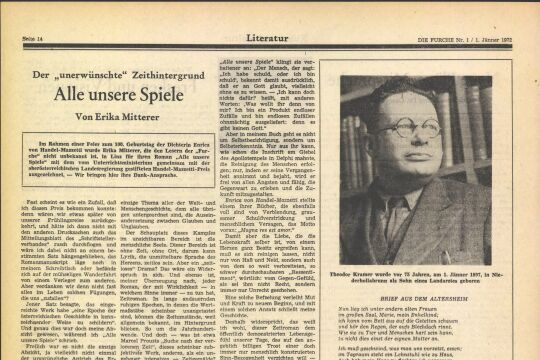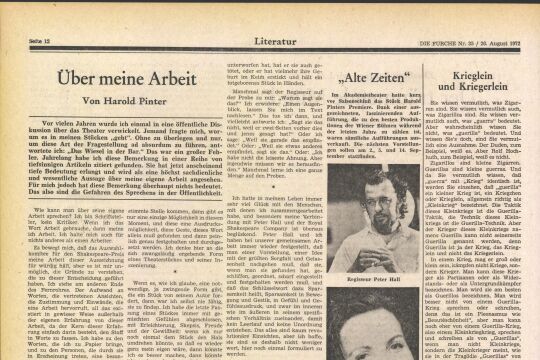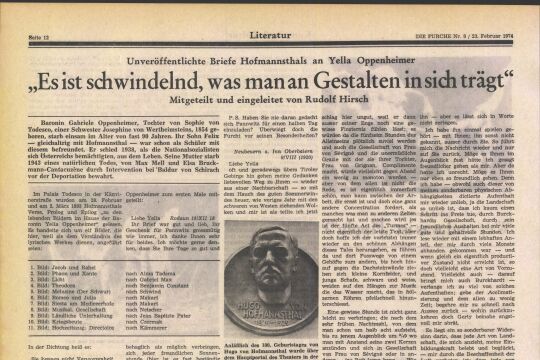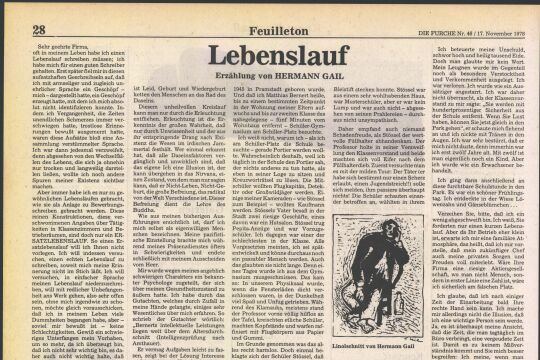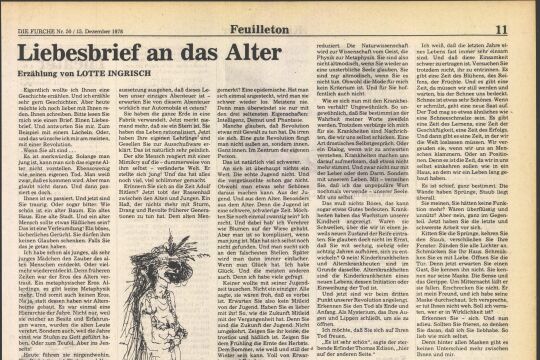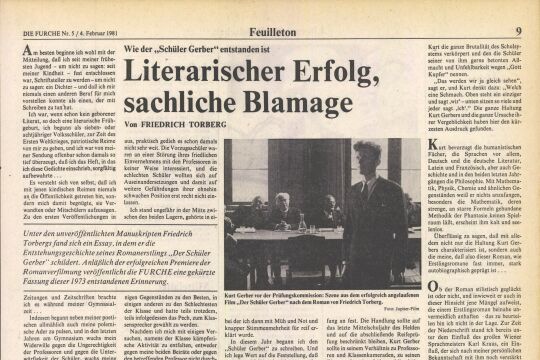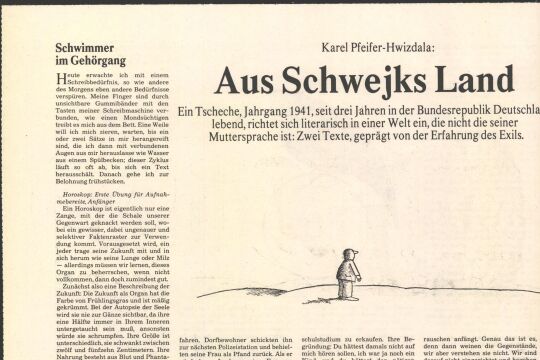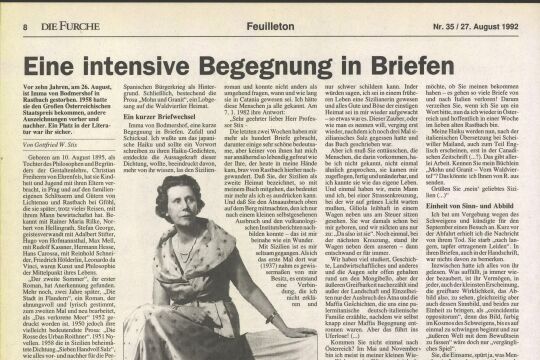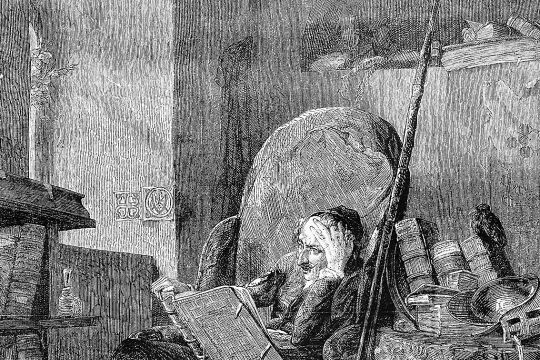Wie weiterleben? „Die Dauer der Liebe“ von Sabine Gruber
Sabine Gruber thematisiert in ihrem jüngsten Roman die Erfahrung des Verlusts und erkundet Wege und Möglichkeiten der Trauer, der Erinnerung, des Weiterlebens und der Literatur.
Sabine Gruber thematisiert in ihrem jüngsten Roman die Erfahrung des Verlusts und erkundet Wege und Möglichkeiten der Trauer, der Erinnerung, des Weiterlebens und der Literatur.
Es ist das, worauf man sich nicht vorbereiten kann: Ein ganz normaler Morgen, der Himmel ist spätsommerblau – und ein Polizist steht vor der Tür und berichtet vom Tod des Lebensgefährten. Für den Polizisten ist es ein Dienstgang, für Renata ist es ein Untergang: des gemeinsamen Lebens und der Träume, die man als „Wir“ von der Zukunft hatte.
Das Leben als Paar hat im Lauf der Jahre konkrete Gestalt angenommen: Es steckt zum Beispiel in der Wohnung oder im Wagramer Landhäuschen, in den vielen Erinnerungsstücken, die man von Reisen mitgenommen und einander geschenkt hat, und in den Bildern, die Konrad, der Lebensgefährte, angefertigt hat und die an den Wänden des gemeinsamen Zuhauses hängen. Die Schriftstellerin Sabine Gruber erzählt in ihrem jüngsten Roman „Die Dauer der Liebe“ von einer Frau, die mit einem plötzlichen Verlust zurechtkommen muss, und hakt sich unter anderem bei diesen Äußerlichkeiten ein, um auch ganz dinghaft zu beschreiben, was einem im Verlauf der Trauer Stück für Stück abhandenkommt.
Dinge verschwinden
Das Abhandenkommen der Dinge ist hier auch ganz buchstäblich zu verstehen. Denn Konrads Familie holt sich, was nun ihr gehört. Es hat für sie zwar keine Bedeutung, weil sich keine Geschichte damit verbindet, aber es kann vielleicht zu Geld gemacht werden. Rechtlich hat Renata keine Chance, sie ist keine Witwe, sie waren nicht verheiratet, und die Testamente, die beide geschrieben haben, sind ungültig. Die vielen gemeinsamen Lebensjahre: Sie bedeuten juristisch nichts, wenn das entsprechende Papier fehlt. Die Familie des Partners hat also jedes Recht, sich zu bedienen. Es hilft nichts, dass Renata weiß – oder zu wissen glaubt –, was Konrad wollte, und dass sie auch weiß – oder zu wissen glaubt –, wo er begraben sein wollte.
Zum Abschiednehmen gehört nicht nur, dass Dinge verschwinden, sondern auch, dass Bilder ins Wanken geraten. War Konrad wirklich der, an den sich Renata erinnert? Was ist das für ein Schlüssel, den sie auf einmal findet, was ist das für eine Frau, mit der er in Italien in Verbindung war? Und welcher Art war diese Verbindung? „Konrad geht mir verloren“, sagt Renata zu einer Freundin, die Leserinnen aus anderen Romanen der Schriftstellerin kennen. „Ich kriege ihn kaum noch zu fassen.“ – „Die Toten fordern unsere Phantasie heraus“, antwortet diese. „Man muß sie in die Fremde überführen.“ – „Doch wo ist dieses Fremdland, fragt sich Renata.“
Ja, wo ist dieses Fremdland? Ist es möglicherweise die Literatur? Hilft das Überführen der toten geliebten Menschen in die Fiktion?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!