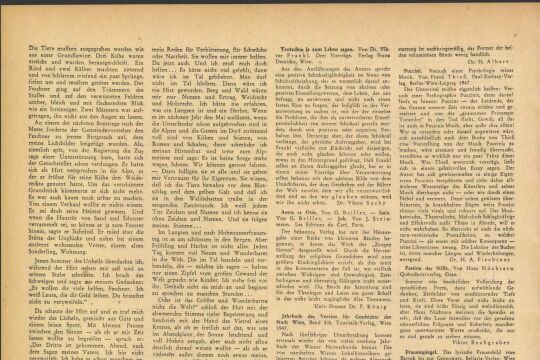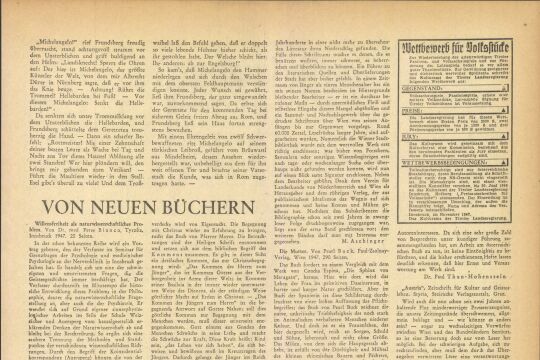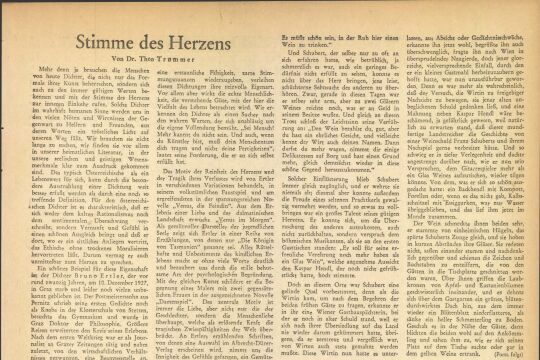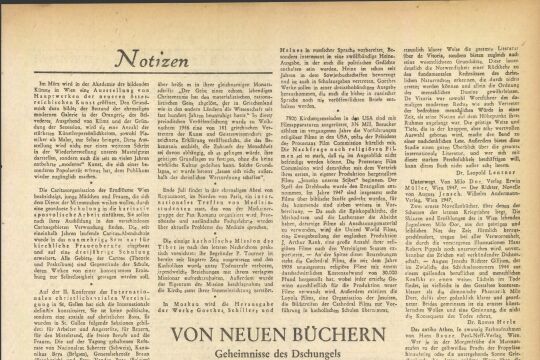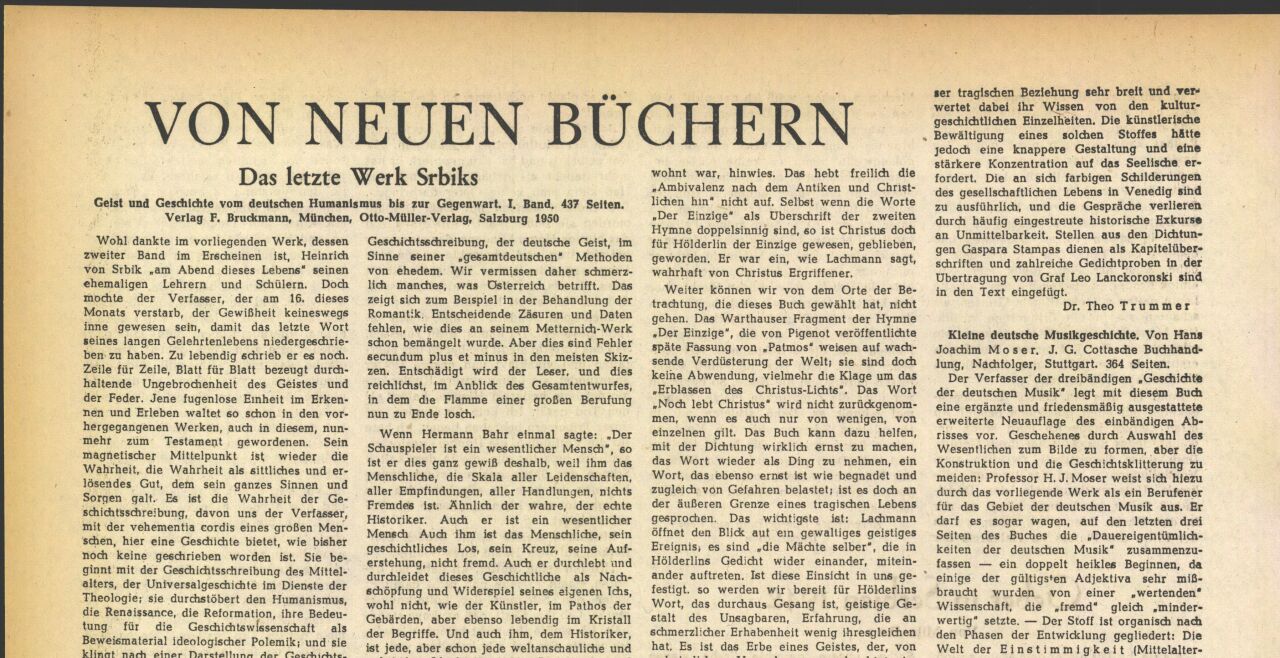
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Erbe eines Geistes
Die Erörterung der Christus-Hymnen Hölderlins muß sidi dem schwersten Problem seiner Aussage stellen. Eduard Lachmann sucht die Hymnen durch Wortinterpretation zu erschließen; er will nicht Partei nehmen, geht abei von der Voraussetzung aus, .daß die Christus-Hymnen keine weniger genaue, keine weniger ehrfürchtige Auslegung verdienen als Hölderlins übriges Weik“; gerade den Vorwurf „einer naiv wörtlichen, am festen Buchstaben sich haltenden Auslegung“ möchte er sich verdienen. So hofft er, sich vor allem an die Jugend wendend, über die Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, die das Ringen um die Dichtung zu lähmen drohen; er will „eine Brücke über Schluchten bauen; immer — und das ist wesentlich — dessen bewußt, daß dem dichterischen Wort Doppelsinnigkeit, ja Un-ergründbarkeit eigen sind. Das Ziel noch so gewissenhafter Auslegung ist also die Dichtung selbst in ihrer Fülle und Gegensätzlichkeit. Man wird vielleicht 6agen müssen, daß mit der Wortinterpretation sich eine Interpretation des Klanges, des Rhythmus, der Wortstellung und Bilderfolge, der Gedichtgestalt verbinden muß: unerhört schwere Aufgaben, die wohl keine Aussicht haben auf eine unangefochtene, unanfechtbare Lösung.
Lachmann ist dem schönen Buche Guardinis besonders verpflichtet, ohne ihm überall — wie etwa in der Auslegung des Geschichtsbildes — zu folgen; er steht im Gegensatz zu Pigenot, dem er — wie sich das von selbst versteht — gleichwohl viel verdankt; Przy-waras wichtiges, unseres Erachtens noch nicht ausgeschöpftes Buch ist ihm erst nach der Drucklegung seiner Arbeit bekannt geworden; es erscheint ihm wie eine Bestätigung, wenn es auch im Anschluß an das Fragment der Vatikanhymne ein Geschichtsbild ahnen läßt, das noch weit über den Bereich der Christus-Hymnen hinausgreift. Lachmann versucht, sich am Orte Hölderlins zu behaupten; die Auslegung also freizuhalten von Umwertungen, von Vorstellungen und Werten, die erst nach Hölderlin geschehen; der Name Dionysos hat für ihn einen anderen Klang, als er für uns hat. Wie viele Einzelheiten auch angreifbar bleiben werden, so scheint uns Lachmann doch festen Boden erreicht zu haben. Vor allem hat er recht darin, daß die Christus-Hymnen — sofern man 6ie nicht durch die von Przywara in die Mitte seiner Betrachtung gestellten Fragmente ergänzt, ein „nicht beendeter Prozeß“ geblieben 6ind. Diese Feststellung wird freilich dahin umge-
wandelt, „daß ein Progreß des Dichters zur christlichen Wahrheit, ein Regreß der christlichen Wahrheit zum Dichter hin' stattgefunden habe. Und es ist kein Zweifel: So hätte ich Reichtum Ein Bild zu bilden und ähnlich Zu schaun, wie er gewesen, der Christ. Wenige deutsche Dichter hätten es wagen können, Hölderlin dieses Wort nachzusprechen; der Geist Christi war Hölderlin, wie Lachmann sagt, „einverleibt“; Christus war „seinem Herzen der Nächste“, wie ja auch Hellingratb auf die „unvergleichbare Stellung“, in der Hölderlin Christus zu sehen gewohnt war, hinwies. Das hebt freilich die „Ambivalenz nach dem Antiken und Christlichen hin“ nicht auf. Selbst wenn die Worte „Der Einzige“ als Uberschrift der zweiten Hymne doppelsinnig sind, so ist Christus doch für Hölderlin der Einzige gewesen, geblieben, geworden. Er war ein, wie Lachmann sagt, wahrhaft von Christus Ergriffener.
Weiter können wir von dem Orte der Betrachtung, die dieses Buch gewählt hat, nicht gehen. Das Warthauser Fragment der Hymne „Der Einzige“, die von Pigenot veröffentlichte späte Fassung von „Patmos“ weisen auf wachsende Verdüsterung der Welt; sie sind doch keine Abwendung, vielmehr die Klage um das „Erblassen des Christus-Lichts“. Das Wort „Noch lebt Christus“ wird nicht zurückgenommen, wenn es auch nur von wenigen, von einzelnen gilt. Das Buch kann dazu helfen, mit der Dichtung wirklich ernst zu machen, das Wort wieder als Ding zu nehmen, ein Wort, das ebenso ernst ist wie begnadet und zugleich von Gefahren belastet; ist es doch an der äußeren Grenze eines tragischen Lebens gesprochen. Das wichtigste ist: Lachmann öffnet den Blick aut ein gewalliges geistiges Ereignis; es sind „die Mächte selber“, die in Hölderlins Gedicht wider einander, miteinander auftreten. Ist diese Einsicht in uns gefestigt, so werden wir bereit für Hölderlins Wort, das durchaus Gesang ist, geistige Gestalt des Unsagbaren, Erfahrung, die an schmerzlicher Erhabenheit wenig ihresgleichen hat. Es ist das Erbe eines Geistes, der, von unheimlichen Versuchungen umleuchtet, im strengsten Sinne erfahren hat, was er verkündete: daß „rein zu sein ein Geschick“ ist.
Gaspara Stampa. Roman. Von Margarete von R o h r e r. Scherpe-Verlag, Krefeld 1950. 423 Seiten.
Die Heldin dieses „Romans einer Leidenschaft aus dem Venedig der Hochrenaissance“ ist die italienische Dichterin Gaspara Stampa. Rilke beschwört ihre Gestalt in der ersten Duineser Elegie und spricht vom „gesteigerten Beispiel dieser Liebenden“. In Padua 1554 geboren, kam Gaspara frühzeitig nach Venedig, wurde hier eine wegen ihrer Schönheit und ihrer künstlerischen Gabe gefeierte „poetessa“ und stand in Verbindung mit berühmten Männer der Zeit, mit Tizian, Bembo und Aretino. Ihrer leidenschaftlichen, maßlosen Liebe zu dem Grafen Collaltino di Collalto, einem glänzenden, aber unsteten und leichtlebigen Kavalier, gab sie Ausdruck in einer Anzahl von Sonetten, die ihre Seligkeit und ihr Leid spiegeln. Sie vermochte aber den Mann nicht zu halten, er verließ sie, und ihr Leben endete in Entsagung. Gaspara Stampa gehört zu jenen berühmten Frauen, die ihrer Liebe ein literarisches Denkmal setzten, wie Luise Labe und Mariana Alco-forado. M. Rohrer erzählt die Geschichte dieler tragischen Beziehung ehr breit und rer* wertet dabei ihr Wissen von den kulturgeschichtlichen Einzelheiten. Die künstlerische Bewältigung eines solchen Stoffes hätte jedoch eine knappere Gestaltung und eine stärkere Konzentration auf das Seelische erfordert. Die an sich farbigen Schilderungen des gesellschaftlichen Lebens in Venedig sind zu ausführlich, und die Gespräche verlieren durch häufig eingestreute historische Exkurse an Unmittelbarkeit. Stellen aus den Dichtungen Gaspara Stampas dienen als Kapitelüberschriften und zahlreiche Gedichtproben in der Übertragung von Graf Leo Lanckoronski sind in den Text eingefügt.
Kleine deutsche Musikgeschichte. Von Hans Joachim Moser. J. G. Cottasche Buchhandlung, Nachfolger, Stuttgart. 364 Seiten.
Der Verfasser der dreibändigen „Geschichte der deutschen Musik“ legt mit diesem Buch eine ergänzte und friedensmäßig ausgestattete erweiterte Neuauflage des einbändigen Abrisses vor. Geschehenes durch Auswahl des Wesentlichen zum Bilde zu formen, aber die Konstruktion und die Geschichtsklitterung zu meiden: Professor H.J.Moser weist sich hiezu durch das vorliegende Werk als ein Berufener für das Gebiet der deutschen Musik aus. Er darf es sogar wagen, auf den letzten drei Seiten des Buches die „Dauereigentümlichkeiten der deutschen Musik“ zusammenzufassen — ein doppelt heikles Beginnen, da einige der gültigs'en Adjektiva sehr mißbraucht wurden von einer „wertenden“ Wissenschaft, die „fremd“ gleich „minderwertig“ setzte. — Der Stoff ist organisch nach den Phasen der Entwicklung gegliedert: Die Welt der Einstimmigkeit (Mittelalterliche Monodie, 750—1350, und das Volkslied,
1350—1950) und die Welt der Mehrstimmigkeit (Cantus firmus, 1350—1550, Zeitalter der Fuge, 1550—1750), Zeitalter der Sonate oder Romantik, mit den Unterabteilungen: neue Homophonie, 1750—1850, und neue Polyphonie, 1850—1950). Die zeitgenössischen Werke sind nach Gattungen geordnet, also nach einem sehr naheliegenden, aber noch kaum angewendeten, überaus aufschlußreichen Ordnungsprinzip. An der Schwelle zur Gegenwart, die mutig in die Betrachtung einbezogen wird, ist der Autor gestolpert: da harte Urteil über Gustav Mahler (S. 294—295) scheint weniger von der Erkenntnis des Historikers als durch den persönlichen Geschmack des Autors inspiriert. — Die Bilanz der deutschen Gegenwartsmusik ist positiv. Der Verfasser meint, „daß trotz aller Zeitstürme, wie sie Deutschland so nie zuvor durchgemacht hatte, die musikalische Produktion in überraschendem (innerem wie äußerem) Ausmaß weitergegangen ist und — trotz der bedenklichen physischen Abschnürung vom Ausland — selbst in den Jahren der Gewalt eine nicht zu verkennende geistige Weiterentwicklung bei uns stattgefunden hat: die kommunizierenden Röhren der musikalischen Weltentwicklung ließen sich trotz allem nicht gänzlich unterbinden, und wenn sich auch die Schwergewichte des wirtschaftlichen Musikumsatzes verlagerten, so blieb unsere besiegte Heimat ein Musikland selbst bei zerstörten Opernhäusern und Konzertsälen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!