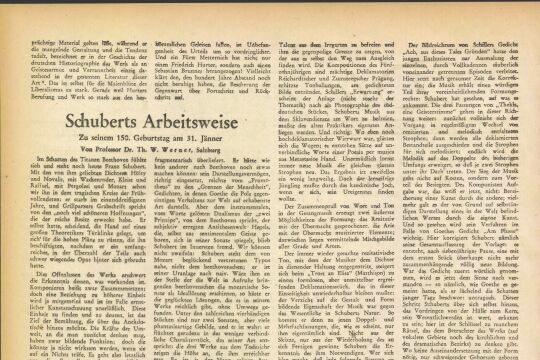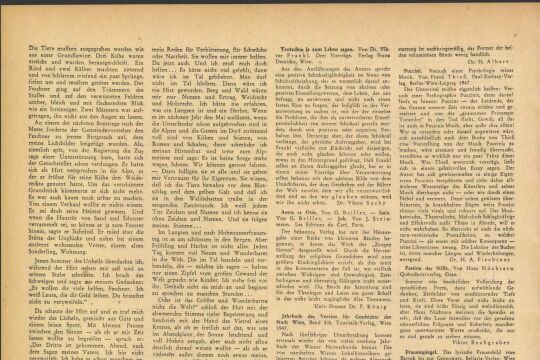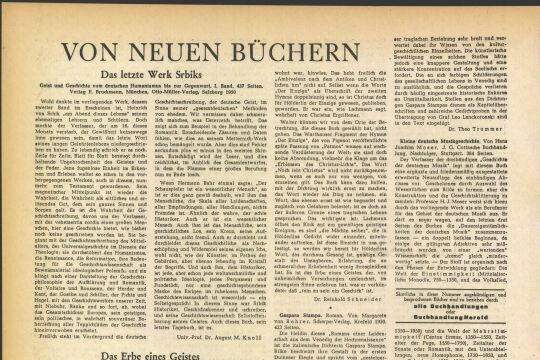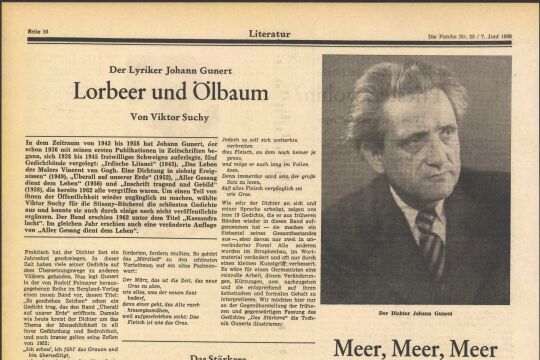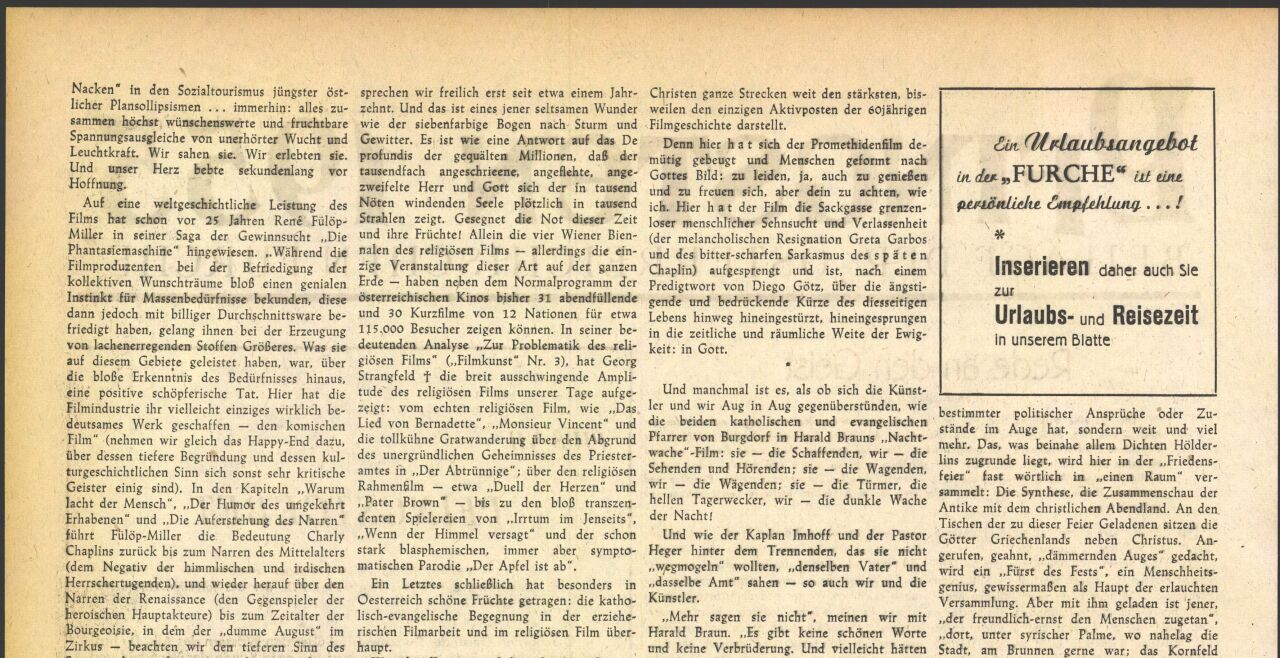
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Friedensfeier
Die Entdeckung eines unbekannten und also für uns neuen Werkes von Friedrich Hölderlin ist ein Ereignis, das die Oeffentlichkeit natürlich längst nicht in dem Maß aufgeregt hat wie etwa der Besuch eines exotischen Kaisers oder eine sportliche Weltmeisterschaft. Aber immerhin, in den Kreisen derer, die sich noch um Dichtung, und um das Gedicht im speziellen, kümmern, hat es Aufsehen erregt: In London wurde im Kunsthandel die vollkommen erhalten gebliebene Handschrift eines großen, 156 Verse umfassenden Gedichts von Hölderlin entdeckt, das den beziehungsreichen Titel „Die Friedensfeier“ trägt. Bisher kannte man nur fragmentarische Entwürfe zu diesem Gedicht, der Londoner Manuskriptfund stellt die für den — niemals gefundenen — Verleger sorgfältig hergestellte Reinschrift und in der Entstehungsgeschichte die endgültige, die vollendete Gestalt dar. In der „Bibliotheca Bodmeriana“ ist dieses Gedicht in vorbildlich schönem Druck veröffentlicht worden, herausgegeben und ausführlich erläutert von Professor Friedrich Beißner, dem Herausgeber der großen Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe.
Als äußeren Anlaß zu der Konzeption dieses hymnisch-prophetischen Gedichts hat die Hölderlin-Philologie den Abschluß des Friedens von Luneville im Februar 1801 feststellen können.
Er beendete den Krieg zwischen Napoleon und Oesterreich, der als der zweite Koalitionskrieg in die Geschichte eingegangen ist. Für die rückschauende historische Betrachtung stellt der Friedensschluß von Luneville nicht mehr als eine Episode unter vielen jener bewegten Jahre der napoleonischen Aera dar. In der Schau des Dichters, der sein Gedicht mit den Tönen höchster hymnischer Erhebung und prophetisch-“Wsionärer Kräfte erfüllt, erhält diese Episode säkulare Bedeutung. Das ist ein Beweis mehr für die Tatsache, daß bei dem großen Kunstwerk der „Anlaß“, das „Wirkliche“ nichts bedeuten: „das Bleibende“ stiftet allein der Dichter.
Den Inhalt des Gedichts „Die Friedensfeier“ in dürrer Nacherzählung wiederzugeben ist schwierig, wenn nicht unmöglich, obwohl, was sich in diesen Strophen begibt, ganz einfach dem Titel entspricht: „Die Friedensfeier.“ Zuerst werden Ort und Stätte umschrieben, in denen diese Feier sich ereignen soll: der „seliggewohnte Saal“, „gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche, wohlangeordnet, eine prächtige Reihe ...“ Wer versammelt sich nun an solch erhabenem Ort, vom Dichter eingeladen, zur Friedensfeier? Wenn man, aus dem Fortgang des Gedichts, diese Frage beantworten will, wird klar, daß Hölderlin nicht irgendeinen Friedensvertrag zur Ordnung und Eingrenzung bestimmter politischer Ansprüche oder Zustände im Auge hat, sondern weit und viel mehr. Das, was beinahe allem Dichten Hölderlins zugrunde liegt, wird hier in der „Friedensfeier“ fast wörtlich in „einen Raum“ versammelt: Die Synthese, die Zusammenschau der Antike mit dem christlichen Abendland. An den Tischen der zu dieser Feier Geladenen sitzen die Götter Griechenlands neben Christus. Angerufen, geahnt, „dämmernden Auges“ gedacht, wird ein „Fürst des Fests“, ein Menschheitsgenius, gewissermaßen als Haupt der erlauchten Versammlung. Aber mit ihm geladen ist jener, „der freundlich-ernst den Menschen zugetan“, „dort, unter syrischer Palme, wo nahelag die Stadt, am Brunnen gerne war; das Kornfeld rauschte rings Christus, den „mitten im
Wort“, „furchtbarentscheidend ein tödlich Verhängnis“ ereilte. Ankunft und Anbeginn eines neuen, besseren Zeitalters erhofft Hölderlin mit diesem Frieden, gefeiert und ausgezeichnet durch die persönliche Wiederkunft, die Epi-phanie Gottes, der Götter:
.....und eher legt
Sich schlafen unser Geschlecht nicht, Bis ihr Verheißenen all, All ihr Unsterblichen, uns Von euerem Himmel zu sagen, Da seid in unserem Hause.“
Die Versöhnung Gottes mit den Menschen, des Jenseits mit dem Diesseits, das persönliche Da-Sein Gottes unter den Menschen, die bruchlose Ueberlieferung von der Antike bis zur Gegenwart, all das ist nach Hölderlin nötig, wenn „Friede“ sein soll und Anlaß, diesen Frieden zu „feiern“. Aus Briefen Hölderlins wissen wir, daß er jenen Friedensschluß von Luneville freudig begrüßt hat. Jenen anderen, jenen wirklichen Frieden, den das Gedicht besingt, sieht der Dichter freilich hur mit den Augen der Sehnsucht. Was sich da zur „Friedensfeier“ versammelt im geschmückten Saal, die Götter und Genien, die mit den Irdischen das festliche Gasfmahl halten, sind.Vision, Wunschbild, mit allen Fasern des Herzens in glühender Inbrunst vom Dichter aus fernsten Himmeln zusammengerufen, es ist Prophetie, was diese Verse in wuchtig schreitendem Pathos künden — und es ist ergreifend, daß wir Heutigen, die in einer wahrhaft friedlosen Welt leben, dieses Friedensbild neu geschenkt bekommen, das Welt-Bild, in dem „der stille Gott der Zeit“ aus seiner Werkstatt getreten ist, „und nur der Liebe Gesetz, das schönausgleichende, gilt von hier an bis zum Himmel“.
Die ganze Größe, Wucht und Schönheit dieses uns neu geschenkten Hölderlin-Gedichts wird sich freilich nur dem offenbaren, der auf die Form achtet. Inhalt und Form liegen hier in eins; dieses wahrhaft klassische Kunstwerk erhält seinen Wert allein durch die Vollendung der Form. Näherer Betrachtung erschließt sich, wie dieses Gedicht gebaut, wie es „komponiert“ ist — der Vergleich mit der Musik drängt sich aus mehr als einem Grunde auf. Sicher nicht ohne Absicht gliedert sich „Die Friedensfeier“ in zwölf Strophen, die heilige Zahl. Und jeweils drei Strophen gehören inhaltlich wie im „Ton“ der Aussage, in der Tonart, zusammen-, so daß sich ein Aufbau von vier Triaden, Teilen, Stufen oder „Sätzen“ ergibt. Friedrich Beißner weist in seinem Kommentar mit Recht darauf hin, daß die erste und die letzte Trias in der gleichen Tonart, der „naiven“ erklingen, sie sind schil-derrder, ruhig beschreibender Natur; der Schilderung des Festsaals am Anfang entspricht abschließend das Bild der den Frieden genießenden Menschen:
„Und vor der Tür des Hauses Sitzt Mutter und Kind, Und schaut den Frieden ...“ Und zwischen diesen Ecksätzen erheben sich die zweite und die dritte Trias, im „idealischen“ und im „heroischen“ Ton deutlich hörbar voneinander abgehoben: Die erhabene, mit feurigen Zungen gepriesene, zu schwindelnder Geisteshöhe sich aufschwingende, innig herbeigesehnte Vision der Götter-Epiphanie. Ja, es ist Wort-Musik, was hier ertönt, dichterische Sprache im Dienst eines innerlich waltenden musikalisehen Baugesetzes, ein wohlgeordneter Kosmos, in dem der geringste Teil dem Plan eines Ganzen sich fügt. Liegt es nicht nahe, hier an eine Wort-Komposition, eine Symphonie in vier Sätzen zu denken, das gleiche Thema viermal abgewandelt, in vierfacher Gestalt in die tönende Form gerufen? Alle Lyrik ist der Musik verwandt, sonst hieße sie nicht Lyrik; selten einmal aber wird das immanente Formgesetz so unmittelbar manifest wie in den vier Sätzen Wortmusik, mit denen Hölderlin den ewigen Frieden, das Wunschbild eines neuen Zeitalters, feiert. „Die Friedensfeier“ ist wahrhaft, wie die ersten beiden Verszeilen intonierend aussagen: „Der himmlischen, still wiederklingenden, Der ruhigwandelnden Töne voll.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!