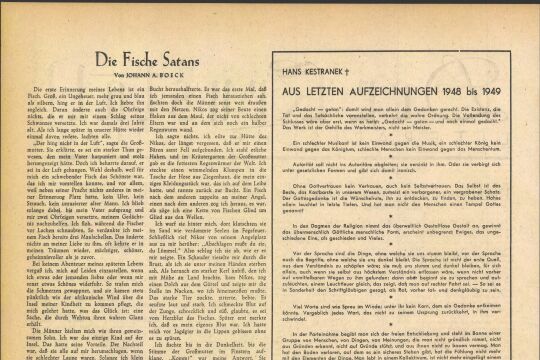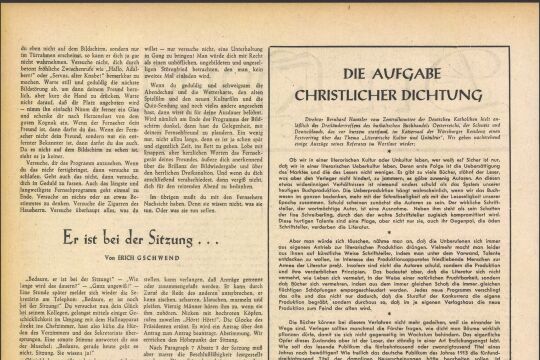Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
SCHREIBENDE UND LESER
Kinder lesen, was sie erfreut, junge Menschen, was sie begeistert, Erwachsene, was ihnen frommt, Hochbejahrte das, was sie eben noch mitbetrifft. Dies scheinen mir vier Grundarten des Lesens, die einander allerdings in Wirklichkeit fast immer überschneiden. Denn was einen erfreut, liest man wohl auch später noch gerne, was einen begeistert hat, daran prüft man sich von Zeit zu Zeit immer wieder, und was einen angeht, liest man meistens auch schon, bevor man ins Abrahamsalter eingetreten ist. Die gleichzeitigen Antriebe zum Lesen sind, ganz abgesehen von Berufsinteressen und Lebenssphären, sehr vielfältig und sehr verschieden. Jeder Schriftsteller, der sich an Leser wendet, sollte immer auch diese Vielfalt des „Cui bono?“ bedenken. Schaffen und schreiben kann man gewiß auch für sich selbst ganz allein, aber veröffentlichen kann man doch nur für andere Menschen.
Ein Autor, der dies nicht erwägt, darf nicht enttäuscht sein, wenn er mit seinem Werk kein Publikum erreichte. Vielleicht war sein Buch nicht darnach angetan, jemanden zu erfreuen oder auch gründlich zu erschrecken, vielleicht begeisterte es niemanden, betraf niemanden als eben den Verfasser, deutete niemandem das Dasein, wurde mit niemandem befreundet, ließ niemanden seinen Kummer vergessen (und jeder, absolut jeder, hat doch irgendeinen), versetzte niemanden in Bestürzung über sich selbst (und jeder, absolut jeder, bedarf dieser Bestürzung, um weiterzuleben). Es sei — obschon widerwillig — zugegeben, daß ein Buch auch in Ermangelung aller dieser Dynamik noch immer nicht schlecht sein muß, nur eben sehr privat. Oder vielleicht war es nicht in der richtigen Tonlage abgefaßt. Die Tonlage kann dem Sinn einer Aussage ebensoviel Kraft verleihen wie allenfalls benehmen. Es kommt darauf an, welche spezifische Tonlage ein Autor dem literarischen Stil seines Zeitalters erteilt, wie tief nach innen und wie weit in die Welt seine Metaphorik reicht. Homer, die griechischen Tragiker, Shakespeare, Cervantes haben eine ewige Metaphorik und eine Tonlage, die jeder vernimmt.
Ich stelle mich nicht über meine Leser, denn ich bilde mir nicht ein, ich könnte sie zu etwas zwingen, was sie nicht freiwillig zu tun oder zu denken bereit sind. Freilich: ich richte mich nicht nach ihnen; ich glaube, daß sie solches gar nicht erwarten, ja, daß sie dies langweilen würde. Leser wollen ja irgend etwas gemeinsam mit dem Dichter erleben, sie wollen, daß er sie führe durch Höllen, durch Paradiese, meinetwegen durch Pur-gatorden, aber nicht, indem er ihnen immerzu einzubauen sucht: „Seht her, ich verstehe, was ihr nicht versteht“, anstatt ihnen behutsam anzudeuten: „Seht her, was für Chancen ihr habt! Hallo, hier ist das Dasein!“ So spricht er ihre Sprache, und er braucht ihnen gar nicht erst aufzudrängen, daß alles in dieser Sprache sich zugleich in Simplicissimis und Abstractissimis vollzieht und daß die äußeren Schauflächen jedes Wortes und Satzes Geheimnisse verhehlen. Vielleicht glückt es dem Leser, zum Geheimnis zu gelangen und sich ihm zu vermählen. Vielleicht auch nicht. Aber auch dann müßte er dem Buch etwas für sich abgewinnen können. Jedermann hat seine eigene Art von Glück im Lesen.
Ein vollkommenes Buch ist eines, darin man von überall aus alles sieht, was das Buch ausmacht, wenn man nur irgend Augen hat, zu sehen. Aber auch wer bloß dem Besonderen anhängt und nur auf die Einzelheit ausgeht, sollte nicht enttäuscht werden. Den Leser, wenn er gleichsam seinen Vertrag mit dem Schriftsteller abgeschlossen und sich zum Lesen bereitet hat, ziemen allerdings gewisse Pflichten, und vorerst die, den Verfasser nicht dafür verantwortlich zu halten, daß er, der Leser, nicht zu lesen versteht, kein Glück beim Lesen hat.
Es will mir scheinen, daß ein Schriftsteller das Vertrauen de Lesers dann gewinnt, wenn dieser fühlt, daß er keinen bloß erfundenen, ersonnenen, erkonstruierten und erspintisierten Phänomenen ausgesetzt ist, sondern daß er die gedichtete Wahrheit kennenlernt. Irgendwie geformt ist die Wahrheit wohl auch schon im nüchternsten Tatsachenbericht. Aber der dichterischen Vision der Wahrheit gebührt mit Recht mehr Vertrauen als den noch so gut belegten Stipulationen eines Historikers. Denn in der historischen Konservierung zeigt sich die Wahrheit bestenfalls gut einbalsamiert, in der dichterischen Vision lebt sie weiter und atmet. Die wahre Weltgeschichte wird von den Dichtern geschrieben. Was gilt uns der historische Don Carlos, Egmont, Cäsar oder auch Odysseus, wenn sich erweisen ließe, daß seine Wirklichkeit ganz anders war als die homerische? Diese allein würde weiter gelten. Weder dem völlig Erfundenen noch dem völlig Erweislichen neigt sich der Leser. Beide stehen ihm unter Verdacht. Daß aber die Wirklichkeit zum Mythos werden kann, der die eigentliche Wahrheit verkündet, das erhofft er sich, das tröstet ihn, das kann ihn allenfalls mit den Gegebenheiten versöhnen.
Es ist richtig, daß das Publikum auch in der Literatur zeitweilig ebenso irregeleitet wird wie auf allen anderen Lebensgebieten. Dennoch ist das Publikum auf die Dauer der wahre Schutz und verläßliche Anwalt des Echten und Guten. Wer weiß noch etwas von den vor zwanzig oder zehn oder noch vor fünf Jahren hmaufgelobten, in triumphierenden Umlauf gebrachten, sogar mit höchsten Preisen geehrten Büchern, außer von den wenigen, die das Publikum, der wahre Freund, durch seine Treue schützte, sie am Leben erhielt und ihnen zur Unsterblichkeit eine noch viel höhere Gnade zuerkannte, nämlich die, nicht zu altern? Keine Kritik kann sie je ins Grab senken, und selbst wenn diel gelänge, so eignet ihnen die Kraft der Auferstehung, und sie finden ihren jüngsten Tag, an dem ein junges Publikum sie wieder emporruft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!