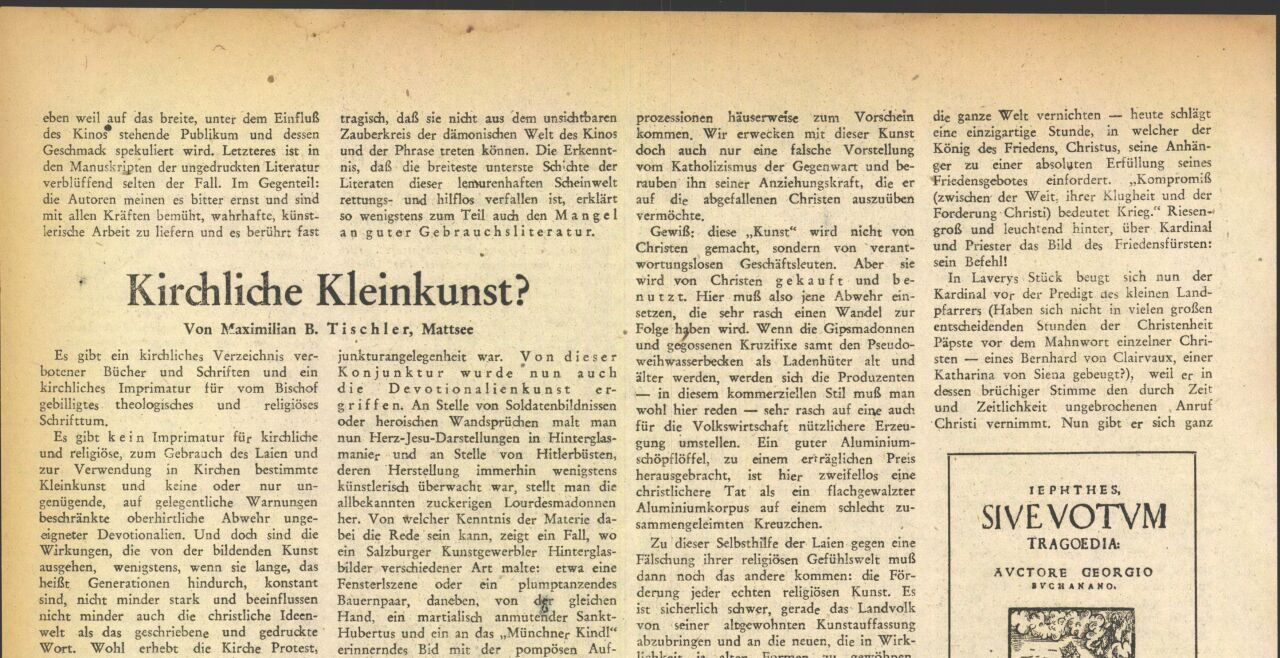
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Bühnen: Probleme und Problematisches
Als Osterpremiere brachten die Stephansspieler „M onsignores große Stund e“, einen Einakter Emmet Laverys, mit dessen „Erster Legion“ diese Bühne vor die Wiener öffentlidikeit trat.
Ein erregendes Stück, zumal wenn man bedenkt, daß es bereits vor dem letzten Krieg geschrieben wurde und daß der Verfasser selbst Priester ist...
Kriegsschatten überlagern die Welt. Alle „Vernünftigen“, Klugen sind der' Ansicht, daß der kommende Krieg nicht zu vermeiden ist. Und da steht nun, in den Stanzen des Vatikans, ein kleiner amerikanischer Dorfpfarrer, der anderer Meinung ist. Anderer Meinung als selbst die großen, welt- und zeiterfahrenen kurialen Diplomaten. Selbst der Kardinal-Staatssekretär glaubt an das „Unvermeidliche“. Der Vatikan steht vor entsdieidungssihweren Beschlüssen. Soll er in einem öffentlichen Rundschreiben, in einer für alle Katholiken verbindlichen, für alle Andersdenkenden höchst beachtenswerten Enzyklika den 398,277.000 Katholiken — 18,8 Prozent der Bevölkerung der Erde — die Teilnahme am Krieg verbieten oder nur in einem allgemein nnd unverbindlich gehaltenen Mahn wort für den Frieden elntreten?
Vor einem Bild des Friedensfümen
Christus, des österlidi&n Rex pacificus, kommt es nun zu einem seltsamen Gespräch zwisdien dem amerikanischen Monsignore und einem unbekannten Kardinal. Ein Gespräch, dessen äußere Akzente nur in seltenen Momenten sich verschärfen, dessen Teilnehmer die Verhaltenheit fried- samer Gesprächspartner wahren, ein Gespräch, das nur zwanzig Minuten dauert — das eingangs und am Ende überspielt wird vom banal-bunten Maskenbild eines römischen Alltags — und das doch weit, weit mehr ist als ein Gespräch. Es ist eine Gewissenserforsdiung der Christenheit über ihre zweitausendjährige Stellungnahme zum Krieg. Keine akademische Diskussion, wie einst im scholastisdien Paris und Neapel des 13. Jahrhunderts, im Salamanca des 16. und im Rom des 17. Jahrhunderts — sondern eine Konfrontation der brennendsten Wunde dieser Welt mit der Wirklichkeit des Gekreuzigten. Der Kardinal vertritt zuerst die Stimme tausendjähriger Erfahrung der Kirche in und mit dieser Welt: Kriege hat es immer gegeben, wird es immer geben — darf die Kirche ihren Gläubigen die Teilnahme am Krieg verbieten und sie dergestalt in furchtbare politische, nationale und innermei.'dil'che Konflikte stürzen? Emphatisch entgegnet Monsignore: Der kommende Krieg wird die Kultur, wird die ganze Welt vernichten — heute schlägt eine einzigartige Stunde, in welcher der König des Friedens, Christus, seine Anhänger zu einer absoluten Erfüllung seines Friedensgebotes einfordert. „Kompromiß (zwischen der Welt, ihrer Klugheit und der Forderung Christi) bedeutet Krieg.“ Riesengroß und leuchtend hinter, über Kardinal und Priester das Bild des Friedensfürsten: sein Befehl!
In Laverys Stück beugt sich nun der Kardinal vor der Predigt des kleinen Landpfarrers (Haben sich nicht in vielen großen entscheidenden Stunden der Christenheit Päpste vor dem Mahnwort einzelner Christen — eines Bernhard von Clairvaux, einer Katharina von Siena gebeugt?), weil er in dessen brüchiger Stimme den durch Zeit und Zeitlichkeit ungebrochenen Anruf Christi vernimmt. Nun gibt er sich ganz zu erkennen, es Ist der erste Diener Christi, der Servus servorum Dei — Diener aller Diener Christi: der Kardinal ist der Papst selbst. Die Enzyklika wird also der Christenheit und der Welt verkünden: Frieden, nur Frieden wünscht, befiehlt, fordert der Herr des Friedens durch den Mund seines irdischen Stellvertreters.
In einer packenden, mitreißenden Aufführung (als Gast Hintz Fabricius als Papst) gelingt es den Stephansspielern, dieses Zeitstück — es darf als die katholische Antwort auf „Die russische Frage“ aufgefaßt werden — zu eindruckstiefer Darstellung zu bringen.
Geschickt gewählt das Vorspiel. „Eine Nacht im trojanischen Krieg“ von Georg Herbert. Die Sinnlosigkeit des Mordens, das Verbrecherische des Menschenschlach- tens — in lyrisdi getönten Symbolen. Jünglinge fallen in der Nacht — sie wissen nicht warum, sie sterben, dä sie eben noch von Kunst und Schönheit, Arbeit, Heimat, Güte, Leben träumten. Das Antlitz des Krieges hat sich in zweitausend Jahren nicht verändert: es trägt die gleichen Züge des
Brutal-Sinnwidrigen, des Bösen. Kein Reim, kein Sang, kein Ton, keine Rede hat es wirklich zu „verschönern“ vermocht, sosehr auch Politiker und Poeten, Wissenschaftler und Weisheitslehrer sich darum bemüht haben. Das Schwert des Krieges steckt im Herzen der Menschheit, es kann nur vom Heiler der Herzen herausgezogen werden. +
„Runder Tisch“ nennt sich die letzte Neuaufführung der Insel: es handelt sich hier nicht um eine Round-table-Friedens- konferenz, sondern um ein „Theaterstück“ von Walter Leonhard. Der Hausfrieden im Sdiloß des Grafen Heidersbach wird durch den Verlust eines Ringes getrübt. Frau Maria Holl, die Besitzerin dieses Ringes, möchte kein Aufsehen erregen. Weit gefehlt, Frau Maria! Wie käme das Stück zu seinen drei Akten, der Verfasser zur Ausbreitung seiner Lesefrüdite und Reminiszenzen, Graf Heidersbach — in dessen schlaflosen, zerlesenen Näditen sich schamhaft der Bildungshunger des Autors verbirgt — zur Möglichkeit, zugleich als Hausdetektiv und Raskolnikow im Taschenformat aufzutreten? Dieser edle Graf und Gerichtspräsident a. D. bekennt sich n'jmlich zu dem erlesenen — an gelesenen — Grundsatz, daß nur der Schuldige die ganze Fülle des Menschseins austrage — es gelüstet ihn deshalb, selbst einmal „schuldig“, also: Ringdieb, zu werden; aus der Tiefe dieses Schulderlebens steigt er, erfrischt, als wiedergebackener Richter, empor — er findet den Ring und- spricht Tischgesellschaft und Publikum von jeglicher Mitschuld frei... Ein Salonstück, weldies J. S. Bach und Montesquieus „Esprit des lois“ — ohne innere Berechtigung — als Stützen und Eideshelfer herbeiruft, solche jedoch in der gepflegten Darstellung des Insel-Ensembles findet. Ihm ist es zu danken, daß die malte Handlung, die flache Wortkunst überhöht wird durch einige feine Charakterstudien: moussierende Perlen, welche in einem falschen Schaumwein aufsteigen.
Das Bürgertheater bringt die Reprise eines Stückes, das vor zehn und mehr Jahren seine Erfolgszeit erlebt hat. Alexander Steinbrechers “Schneider im Schloß" entstammt jener Sphäre zwischen 1918 und 1930, in der es als „pikant“ galt, in Roman, Film und Operette den verdächtig gewordenen Nach glanz altadeliger Gesellschaft durch „frisches Blut“ außer- und unterständischer Herkunft aufzupolieren. Eine Komik, die ihren Stoff aus einer durchaus tragischen Situation bezog: eine neue „Gesellschaft“, noch wenig gefestigt in menschlicher, politischer und kultureller Beziehung, schielt nach den durch Republikschutzgesetz verbotenen Fruchten ancienner Feudalität.
Steinbrechers Lustspiel verdankt seinen Erfolg seiner unleugbaren Genügsamkeit: hier bekommt jeder das, was er wünscht. Der Graf seine Gräfin, der Vicomte seine Anzüge, die gute alt Gesellschaft etwas Unterhaltung:, „Leben“ und Geld. Ist es da nicht recht und billig, wenn auch der Herr Schneider — er ist immerhin Besitzer eines Pariser Modesalons — seine Comtesse bekommt? Die Geschickte kann also wieder beim „Bürgerkönig“ — 1830 — anfangen.
Ostern 1948 denkt das Publikum jedoch nidit an so schwere Probleme — es freut sich, daß es trotz aller Plackerei noch lebt; und quittiert lachend die kleinen Scherze des Herrn Müller. Was für ein dankbares Publikum besitzen doch — immer noch unsere Wiener Theater!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































