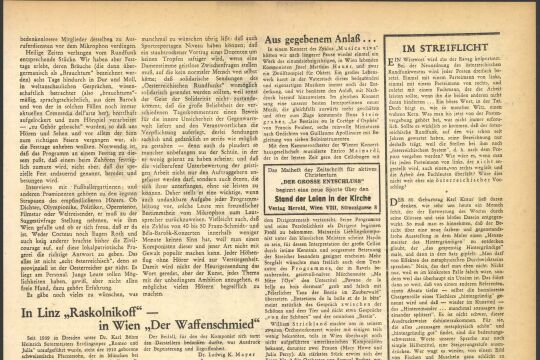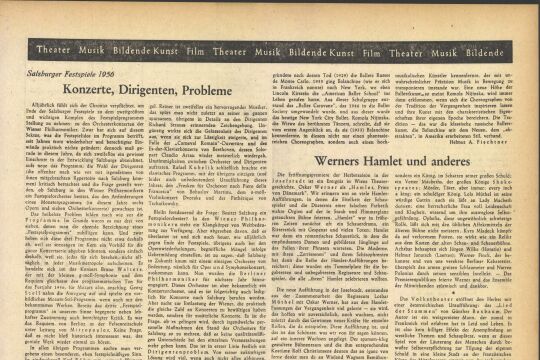Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ist „Hamlet” ein Opernstoff?
Wer davon überzeugt ist, daß man Shakespeare nicht vertonen soll und daß heute Literaturopern nicht mehr möglich sind, wird wahrscheinlich auch von Sandor Szokolay nicht umgestimmt werden, dessen lange schon angekündigter „Hamlet” jetzt in der Budapester Staatsoper uraufgeführt wurde. Es mag auch für den, der die Sprache nicht versteht, stellenweise wie eine Parodie aussehen, wenn sich aufgeregt singende Kostümträger nacheinander in Leichen verwandeln. Und doch: wer „nur” skeptisch ist, wird von der Begeisterung des Publikums angesteckt. Der 36jährige Komponist hat seine vulkanische, zuweilen in laute Kraftmeierei ausrutschende Periode bezwungen. Er läßt dem Text (der allerdings um die Hälfte gekürzt werden mußte) den Vortritt. Nie wird das gesungene, stellenweise auch gesprochene Wort von der Musik überflutet. Trotzdem ist das Bekenntnishafte des temperamentvollen Musikers hier mehr als in seinen anderen Werken zu spüren. Er mußte sich von dem lange quälenden Wunsch befreien, dieses Werk mit Musik zu verschmelzen. Für ihn ist Hamlet der unerbittliche Wahrheitssucher, der zwar lange zögert, sich passiv verhält, dann aber ganz konsequent, wenn auch mit taktischen Umwegen, auf sein Ziel losgeht: gegen die despotische Macht. Die volle Wahrheit aber muß man mit dem Leben bezahlen. So gesehen, wird „Hamlet” als Opernstoff vertretbar.
Szokolay hat nicht nur den Text (in der ungarischen Nachdichtung von Janos Arany) auswendig gelernt, um nicht an den Buchstaben zu kleben und in großen Linien komponieren zu können. Er hat sich auch mit den zeitgenössischen Kompositionstechniken so vertraut gemacht, daß er sie wieder „vergessen” und nach eigenem Empfinden schaffen konnte. Es ist etwas anderes, ob man — wie in der vor vier Jahren uraufgeführten „Bluthochzeit” — Leidenschaften zwischen Mann und Frau gestaltet oder die leidenschaftliche Suche nach der Wahrheit. Szokolay hat damals temperamentvoll „drauflos”kompo- niert, diesmal verknüpfte er sehr diszipliniert und logisch geordnet die Motive. Aber er wirkt nicht kühl und gedankenblaß. Eher unterlaufen ihm zuweilen Niveauunterschiede. Die Aufteilung des Geistes von Hamlets Vater in eine Figur, eine unwirklich ferne Singstimme und ein noch ferneres Chorecho überzeugt nicht sehr. Der Chor der Hofgesellschaft ist dramaturgisch fragwürdig. Es gibt auch, besonders am Schluß, einige zu „süße” Klänge. Dagegen ist die Eliminierung des Fortinbras zugunsten einer größeren Geschlossenheit vertretbar (Horatio singt die Schlußworte). Trotz mancher Einwände ist der Gesamteindruck durchaus positiv.
Die Budapester Staatsoper hat sich um die Aufführung große Mühe gemacht. Zwei Besetzungen, zwei Premieren (samt den zugehörigen Generalproben total ausverkauft!), voller Einsatz aller technischen und künstlerischen Möglichkeiten des Hauses. Den Kern bildete das Team, das schon die „Bluthochzeit” zum Erfolg geführt hatte. Wieder zeigte sich Andras Miko in der Personenführung geschickter als in der Entwicklung eines großen Inszenierungskonzepts. Wieder sang Erzsebet Hazy, aber so gern man sie sieht: ihre Stimme ist für die Ophelia zu hart. Viel überzeugender war Erzsebet Komlossy als Gertrud, Ferenc Szönyi mochte in der äußeren Erscheinung landläufigen Hamlet-Vorstellungen nicht entsprechen, als Persönlichkeit entwickelte er sich zu eindrucksvoller Größe und war auch stimmlich der Partie meist gewachsen. Dem mitreißenden Einsatz der Sänger und des Dirigenten G6za Oberfrank war ein guter Teil des ungewöhnlichen Erfolges zu danken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!