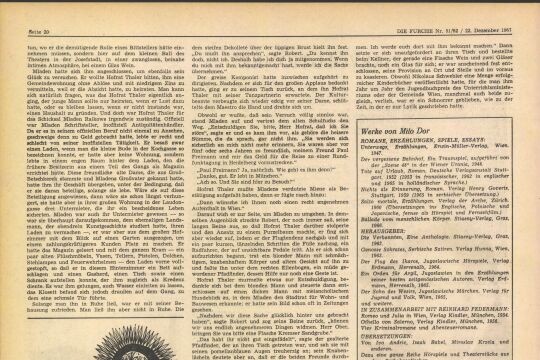Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Am 26. Oktober
An diesem 26. Oktober war es mir darum zu tun, offiziellen Anlässen zu entfliehen und der Selbstdarstellung von Zuständen, die wider alle Erfahrung gerne definitiv sein möchten und sich daher schleunigst zu mythologisieren trachten.
Am 26. Oktober war es mir darum zu tun, Spuren jenes anderen Österreich zu finden, von dem wir einst in den Kerkerzellen Hitlers gesprochen hatten und das damals in den Augen der Habsburganhänger sowohl wie der Kommunisten (etwas anderes traf man „drinnen“ höchst selten) mehr war als eine Wohlstandsgemeinschaft, mehr also als das, was schließlich restauriert wurde und sich mit den Federn zu schmük-ken begann, die wir dort hatten lassen müssen.
An diesem 26. Oktober entwarf
ich mir daher einen Schaltplan durch Hör- und Sehfunk, und der Weg, den ich im Dickicht der Programme fand, war dann auch der richtige. Bei Gustav Mahlers Neunter hob er an. Und schon bei den ersten Takten rissen alle Horizonte auf und es war in dieser zeitlosen Welt von einst unendlich mehr zu sagen, als nur die Parodie auf einen alpendonauländi-schen Gstrampften im Scherzo, das sich nach der Melodie des stei-rischen „Erst den Kopf z'samm, dann dn ...“ dreht. Gewiß, auch das war vorhanden, aber großartig eingebettet in „des böhm'schen
Volkes Weise“, in die tiefe rebellische Glut Ungarns, in grellweißes dalmatinisches Licht und in die schmerzerfüllte Weite, die hinter den Karpaten beginnt.
Die letzten Akkorde Mahlers noch im Ohr, fand ich mich, auf den Spuren der Herkunft, im Geiste entführt zu Catarina Cor-naros Heimkehr, diesem kurios erstaunlichen Makart-Monstrum, das den Kuppelsaal des Oberen Belvedere erfüllt, sehr zu meinem Gaudium, denn eines der Mädchen inmitten der liberalen Wiener Großbürger, die sich da aus höfisch-aristokratischem Anlaß ein riesiges Kostümfest leisten, ist meine leibliche Großmutter. Sie hatte den rötlichen Stich im blonden Haar, wie Makart ihn immer wieder malen wollte.
Heimgekehrt und immer noch schmunzelnd, kam ich gerade zurecht, um im Zweiten Fernsehprogramm „Moos auf den Steinen“ wiederzufinden, diesen Film, den man nicht oft genug sehen kann, weil hier, bei Gerhard Fritsch wie bei Gustav Mahler, eben alles stimmt, weil hier alles Vordergründige, Geschwätz und großstädtische Besserwisserei, nur die kleine, notwendige Dissonanz ist, deren der österreichische Hintergrund seiner Zeitlosigkeit wegen bedarf. Vor diesem großen Hintergrund provinzieller Spinner, von Ostflüchtling bis Baron und Gärtner, vor dieser Aüland-schaft, diesem Strom und der Grenze, vor barocken Ruinen von unzerstörbarer Vornehmheit und vor ungeheuren Erinnerungen, die in vergessenen, leeren Winkeln lauern, erweist sich, was schwach und so völlig preisgegeben aussieht, als stärker, weil zäher und daher unausrottbarer als das betriebsam Laute, füllt das Überdauernde die enormen Hohlräume der Gegenwart.
Betriebsam, aber gar nicht so
besonders laut war dann, was uns die Sportchronik zeigte: den Aufbruch der Wiener zu den Fitnessmärschen. Wie sie — wie wir — da antraten, mit Bergstöcken und Tennisschuhen, mit Kinderwagen und Möpsen, mit Stadträten und Rollschuhläufern, mit Hansi Or-solics und einem Neger, wie da die berufsmäßigen Zaungäste unzutreffende Bemerkungen machten, das alles war, mit dem nur hierzulande denkbaren Zusatz von Selbstironie, ihr — unser — naturgetreues Porträt, gültig und zeitlos, weil unmittelbar von Nestroy entworfen oder von Herz-manovsky oder vom Eipeldauer.
Wandertrieb ist es auch, was Schuberts Musik beseelt, die uns das Festkonzert im Zweiten Programm bot und Musik ist es, was immer noch alle Verbindungen in einem Lande aufrechterhält, dessen Analphabeten Englisch sprechen und dessen Gebildete ein Hochdeutsdh, das eigens für sie in Schönbrunn erfunden wurde. Bergers Prinz-Eugen-Variationen, zwar naiv illustriert, lenkten schließlich als Reiterweise hinüber zur Glorie der weißen Hengste. Und hier, bei dieser Aufzeichnung des Fernsehens vom Fest des Pferdes in der Wiener Stadthalle, schloß sich der Kreis des Festtags so, wie ich ihn zu meiner privaten Freude geplant hatte. Hier auch erübrigt sich jedes weitere Wort: für die weißen Hengste sprach der Vergleich. Bei den Spaniern war gewiß mehr der Eleganz und des Feuers, bei den Franzosen mehr Disziplin und Härte, bei der deutschen Olympiasiegerin mehr Perfektion. Bei den Lipizzanern aber war für immer die habsburgische Gelassenheit, die österreichische Konzi-lianz, die melancholische Milde einer unwiederholbaren, gottlob noch nicht vergessenen, Kultur.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!