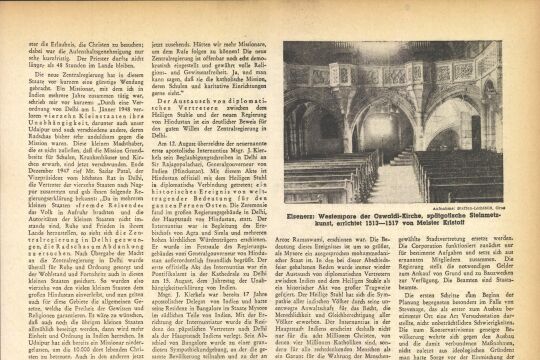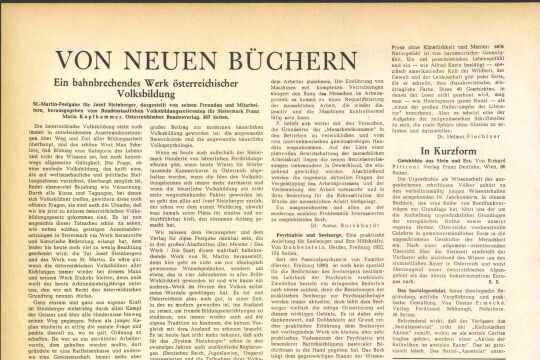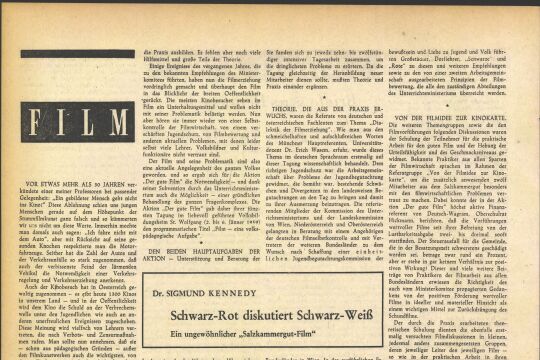Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auch eine Großstadt hat ihre „Stammesgrenzen“
Wenn eine alleinstehende alte Frau in Wien plötzlich erkrankt - kann sie dann zum Nachbarn gehen und ihn bitten, für sie einzukaufen, eventuell zu kochen und auch sonst auf sie zu schauen? In manchen Fällen wird das gehen, in vielen Fällen aber nicht. Gar nicht so selten liest man in der Zeitung von einsam verstorbenen Menschen, deren Tod überhaupt nicht bemerkt worden ist; erst nach Tagen, Wochen oder gar Monaten seien die Betreffenden gefunden worden - Sinnbild der Vereinsamung in der modernen Großstadt? Anzeichen für die „Unwirtlichkeit der Städte“, von der der Psychoanalytiker Alexander Mit-scherlich schreibt?
„Die klassische dörfliche, örtliche Nachbarschaft existiert in der Großstadt sicherlich nicht“, meint dazu der Wiener Soziologe Univ.-Prof. Erich Bodzenta. „Aber es ist auch nicht so, daß die Großstadt eine ,atomisierte Gesellschaft' wäre, wie oft behauptet wird.“
Mit dieser Feststellung nimmt Prof. Bodzenta einen Teil der Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojektes vorweg, das derzeit von Wissenschafterteams in sieben Ländern durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist es, herauszufinden, wie „Nachbarschaft“ in der Großstadt aussieht, welche Formen sie annimmt, wie sie strukturiert ist.
Die Motivation für das ganze Vorhaben, das auf die Initiative des amerikanischen Soziologen Prof. Paul Peachey (Washington) zurückgeht, ist die Uberzeugung, daß die Frage der nachbarschaftlichen Beziehungen zu einem der zentralen Themen des städtischen Lebens von heute geworden ist - zu einer Frage, von deren positiver Lösung das Uberleben der städtischen Lebensform abhängen kann.
Wichtiger „Blick aus dem Fenster“
In dem seit nunmehr vier Jahren laufenden Projekt gelangen den Soziologen in Polen, der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, der Schweiz, Österreich, Schweden und den USA bereits erste bedeutende Erfolge. So beschäftigte sich etwa das deutsche Team mit der - auch in Österreich immer wieder aktuellen -Frage: Wann fühlt sich der Großstädter in seiner Umgebung gestört?
Die Hauptantwort ist recht einfach, eigentlich verblüffend einfach: „Wenn der Blick aus dem Fenster beeinträchtigt wird.“ Neugeplante Ju-gendstrafänstalten etwa oder Anstalten für Geisteskranke stoßen vor allem dann auf den rabiaten Widerstand der Bevölkerung, wenn sie als „Stein des Anstoßes“ die „saubere Aussicht“ verstellen - die Toleranz hört beim Fenster auf.
Lieben Sie Ihren Bezirk?
„Wie sehr lieben Sie Ihren Bezirk?“ - Diese Frage, freilich nicht so unverhüllt und verpackt in Dutzende von Teilfragen, stellen Prof. Bodzenta, Univ.-Doz. Irmfried Speiser und Mag. Karl Thum an 400 ausgewählte Bewohner des 19. und des 20. Wiener Gemeindebezirkes. Die Aufklärung der Verbundenheit mit dem Heimatbezirk ist das zentrale Thema des österreichischen Beitrags zum Gesamtprojekt „Residential Areal Bond“ (was soviel wie „Bindung an den Wohnbezirk“ heißt).
Im Hintergrund steht auch hier der Wunsch, Bedingungen für das Entstehen nachbarlicher Beziehungen aufzuklären. Etwa nach dem Motto: Ist ein Meidlinger, Ottakringer oder Heüigenstädter, der sich mit seinem Heimatbezirk stark verbunden fühlt, ein hilfsbereiterer Nachbar als ein Wiener, dem der Bezirk eher gleichgültig ist?
Grundlegend für den Forschungsansatz ist die Frage, wie weit etwa der durchschnittliche Lebenskreis des Wieners in verschiedenen sozialen Schichten gezogen ist. Die „engere Heimat“, in der man sich besonders wohl fühlt, soll zunächst erforscht werden.
Zu dieser Fragestellung liegen bereits erste Ergebnisse vor. So zeigte sich etwa, daß die soziale Schicht für
die Größe des durchschnittlichen Aktionsradius in der Freizeit entscheidend ist. „Je höher die soziale Schicht, desto mehr erweitert sich der in der Freizeit genutzte Raum“, drückt es Mag. Thum aus.
Eine zweite, für Stadt- und Kultur-planer besonders wichtige Erkenntnis: Veranstaltungen auf Bezirksebene, seien sie kultureller, sportlicher oder weiterbüdender Natur, werden wenig geschätzt. Das Interesse für solche Veranstaltungen „vor der Haustür“ ist derzeit eher gering.
„Wie sehr sich das Interesse vieler Wiener auch in den Randbezirken nach wie vor auf das gewachsene Zentrum der Stadt konzentriert, zeigt ein Beispiel“, illustriert Doz. Speiser dieses Ergebnis. „In einer Satellitenstadt bekam ich von einer Hausfrau auf die Frage nach den besonderen Vorteilen ihres Standortes stereotyp zur Antwort: ,In einer halben Stunde kann ich bei der Oper sein'.“
Diese Ergebnisse sind ein Hinweis darauf, in welche Richtung die Untersuchungen in Wien gehen: Woran fühlen sich die Wiener mehr gebunden - an ihren Bezirk oder an die Stadt? Und1 ist das in allen Bezirken gleich? Welche genaue Rolle spielt die soziale Schicht, und wie sind die Bedingungen in verschiedenen (von den Soziologen genau typisierten) Wohnvierteln?
Um weitere Antworten auf alle diese Fragen zu bekommen, sind die Forscher neben der (gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung durchgeführten) direkten Befragung bei ausgewählten Haushalten einen für Wien in dieser Hinsicht neuen Weg gegangen: Die Wiener selbst sollen als Amateurforscher mithelfen, die Fragen nach der Bezirksverbundenheit und der großstädtischen Nachbarschaftsstruktur zu klären.
Einen halben Monat lang werden
die Mitglieder von 50 Familien (insgesamt etwa die Hälfte der 400 in der Befragung erfaßten Personen) eine Art Tagebuch führen. Jeder Weg und jede Besorgung außerhalb des Haushalts sollen vermerkt werden - mit Angabe der zurückgelegten Distanz und der aufgewendeten Zeit. Auf diese Weise wird man erfahren„wie-viel von Wien und von ihrem Bezirk die Wiener „nutzen“, wie groß also ihr Aktionsradius ist.
Wenn das gesamte internationale Projekt abgeschlossen sein wird, sollen damit, so hofft man, erstmals exakte Analysedaten eines der wichtigsten Bereiche städtischen Lebens vorliegen - die wahrscheinlich, soviel dürfte heute schon feststehen (zumindest ist Prof. Bodzenta davon überzeugt), auf eines hinauslaufen werden: Nachbarschaft läßt sich nicht planen, wohl aber unterstützen.
Der Weg dazu: Die Schaffung vieler kleiner Cities in den Städten - vieler
Zentren, mit denen sich die Städter identifizieren können. Am besten läßt sich das, soweit entsprechende Strukturen in einer Stadt vorhanden sind, im Rahmen der gewachsenen Bezirke verwirklichen. Also jener Stadtteile, die meist aus eingemeindeten und in die Stadt aufgesogenen Dörfern entstanden sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!