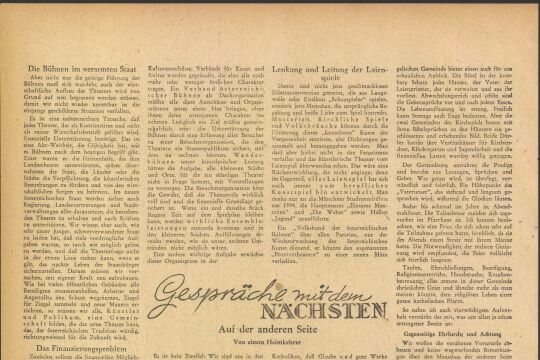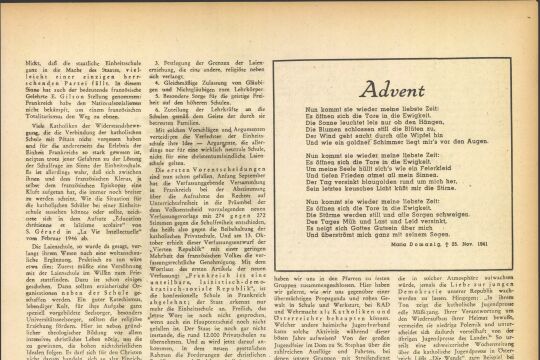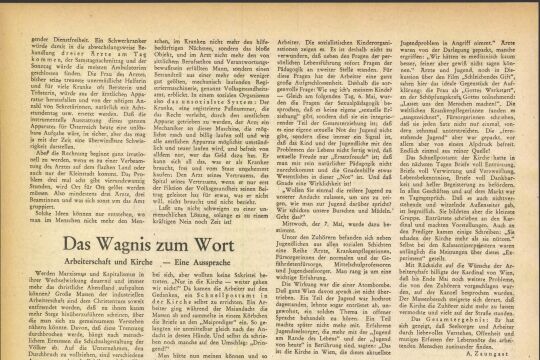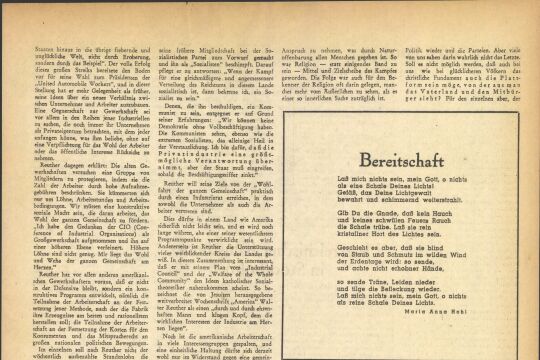Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Christsein in Wien
Bischofsvikar Josef Zeininger lädt ein zum Start: „Nach gründlicher Vorbereitung“ soll das „Symposion Großstadt“ an die Öffentlichkeit treten und mit Referaten, Arbeitskreisen und Diskussionen in der
Konzilsgedächtniskirche Wien-Lainz „seinen ersten Höhepunkt erreichen“.
Wieder einmal sollen „alle, die in der Arbeit für die Kirche von Wien engagiert sind, ... den Grund legen für ein missionarisches Christsein, für lebendige Gemeinden, für eine glaubwürdige Kirche in dieser Stadt“. Denn „ein Jahrzent großer Veränderungen liegt vor uns“.
Ein Jahrzehnt großer Veränderungen hegt hinter uns, seit 1969 in eben derselben Konzilsgedächtniskirche die letzte Wiener Diözesansyn-ode eröffnet worden ist. „Schlagt nach im Handbuch dieser Synode“, ist man versucht, den Teilnehmern am Symposion 1979 zuzurufen. Die Kirche wäre besser gerüstet für die achtziger Jahre, wenn sie ihre guten Vorsätze für die siebziger Jahre besser befolgt hätte.
Aber die Kirche - das wissen wir spätestens seit dem letzten Konzil - sind wir selbst, die Christen, die mehr oder minder engagierten. Zu viele haben sich offensichtlich zuwenig engagiert; der
Autor bekennt es vorweg für sich selbst.
Ein neuer Anlauf tut not, aber das Ziel ist unverändert: „Der Aufbau einer lebendigen Gemeinde von glaubenden und in Liebe tätigen Menschen.“ Auf dieses Ziel hin, fand 1969 die Synode, müsse die Erneuerung der Kirche von Wien gerichtet sein. Und nicht nur die Kirche von Wien!
Herrlich weit haben wir es darin gebracht. Zehn Jahre nach dem Leitsatz vom „missionarischen Charakter“ jeder christlichen Gemeinde ruft der Bischofsvikar erneut dazu auf, den Grund zu legen „für ein missionarisches Christsein“ und „für lebendige Gemeinden“. Denn offenbar sind zu viele unserer
Gemeinden jener inneren Bedrohung erlegen, vor der die Synode gewarnt hat: der Versuchung, sich abzuschließen, auf eingefahrenen Geleisen der Routine fortzuwursteln, den schrumpfenden Bestand zu hegen.
Die Jugend, hört man heute allgemein, sei wieder aufgeschlossen für Religion. Und resignierende Eltern suchen in der ganzen Großstadt eine einzige aufgeschlossene Gemeinde, eine Kirche, die anziehend auf ihre Kinder wirken könnte ...
Es gibt sie gewiß - aber allein die Tatsache, daß man sie suchen muß, daß es in der Regel nicht die eigene Gemeinde, nicht die Kirche um die Ecke ist, muß uns zu denken geben.
Den „Aufbau einer lebendigen Gemeinde von glaubenden und in Liebe tätigen Menschen“ habe ich in den letzten zehn Jahren ein einziges Mal erfahren: in Wonogiri auf der Insel Java, in der hintersten indonesischen Provinz. Liegt es daran, daß diese Christen sich in äußerer Bedrohung zu bewähren haben, in der Diaspora unter 97 Prozent Muslimen und Animisten?
Jedenfalls empfand ich intensive Sehnsucht nach dieser indonesischen Gemeinde, als ich nach meiner Rückkehr zum erstenmal wieder, verbissen schweigend, das Geleier der Haydn-Messe über mich ergehen ließ.
Warum habe ich nicht mit-
gesungen? „Die Kirche, das sind wir ...“ Ich singe nicht schön, aber laut. Sängen alle die Haydn-Messe laut mit, wäre das vom Ideal der Teilnahme am Eucharistischen Mal immer noch weit entfernt, aber doch ein erstes Lebenszeichen, ein neuer Anfang, ein Signal. Warum bin ich nicht zum Pfarrer gegangen: „Was macht der Liturgiekreis? Ich habe zwar eigentlich keine Zeit und das hegt mir eigentlich nicht -aber ich tu mit, denn so geht's nicht weiter...“
Ich bin nicht hingegangen, und wie ich mich kenne, werde ich nach dem Symposion auch nicht hingehen, weil ich „wirklich“ keine Zeit hab', weil es mir „wirklich“ nicht liegt. Auch der B wird nicht hingehen, der C schon gar nicht; vielleicht der D?
Engagierte Christen? Ich halte sie für solche, den B und den C und den D; und mich halten sie wohl auch für einen. Gewiß, jeder tut das Seine, wie man so sagt. Ich fürchte aber, das ist zu wenig, um den Grund zu legen „für ein missionarisches Christsein, für lebendige Gemeinden, für eine glaubwürdige Kirche“.
Und ich denke beschämt an Wonogiri zurück.
Presse-Echo
„Horrorschinken“
Insgesamt fand die TV-Serie „Holocaust“ in Österreichs Presse eine positive Aufnahme. „Kurier“, Arbeiter-Zeitung“ und „Kronen-Zeitung“ brachten Begleitserien. Die „Presse“ qualifizierte „Holocaust“ noch einmal als „nach Hollywoodmanier abgedrehten Horrorschinken“ und die „Kleine Zeitung“ brachte über die ganze Samstagseite 1 eine Karikatur mit einem fetten Kapitalisten, der dicke Dollarbündel aus einem Fernsehapparat herauskurbelt.
Linkskonkurrenz
Obwohl auch die Linke mit Geldsorgen im Pressebereich zu kämpfen hat (manche prophezeien ernsthaft eine Einstellung der >yAZ“ bald nach der Wahl), leistet man sich bis zum Mai jetzt wieder einiges. Zum Beispiel eine Neuauflage der einstigen Renommierzeitschrift „Heute“. Verantwortlich ist der Ex-„Kronen-Zeitung“-Redakteur Hans Mahr, dem das linke' „Extrablatt“ (das „Heute“-Konkurrenz wittert) vorwirft, daß er mit der (schiefgegangenen) „Extraausgabe“ einst „auf Parteikosten Wähler für dumm verkaufen wollte.“
Zusätzlich hat die SPÖ auch noch eine Farbillustrierte „Like“ auf den Markt gebracht, die monatlich erscheinen soll und für die vorsorglich nur ein Vierteljahresabonne-ment angeboten wird. Das „Extrablatt“ spottet, daß diese für Jungwähler bestimmte Postille im „Piefkejargon“ eine „treffsichere Coverstory“ für Heft 1 gewählt habe: „Alle reden von Marika Rökk. Wir auch.“
Möralhysterie?
Zunächst schien es, als wäre Österreichs Presse mit Unterrichtsminister und ORF-Generalintendant einig: Das sogenannte Gedicht eines überwiegend mit Fäkalvokabeln operierenden Poeten war für den Schulfunk wirklich ungeeignet! Dann fand sich aber doch eine Zeitschrift, die sich über die darob ausgebrochene angebliche „Moralhysterie“ lustig machte: das Nachrichtenmagazin „profil“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!