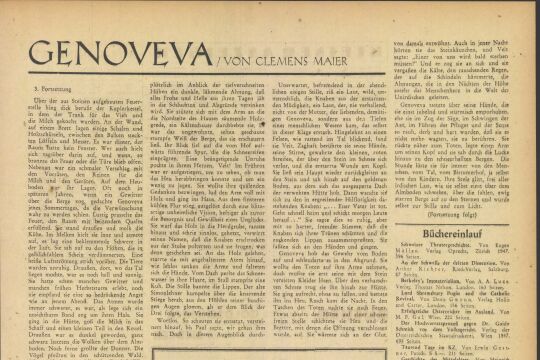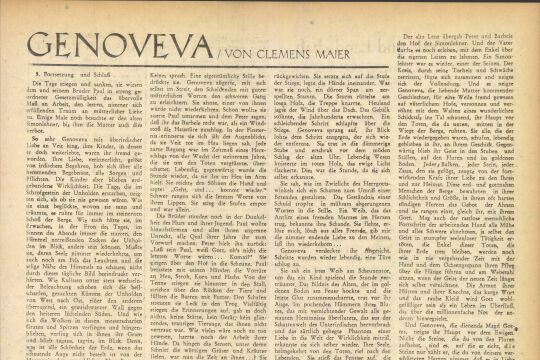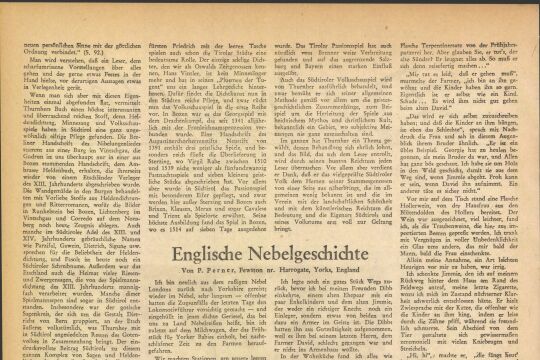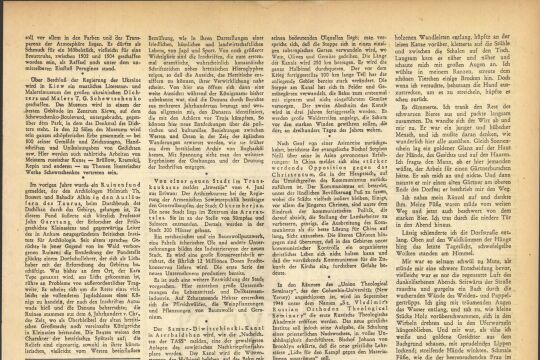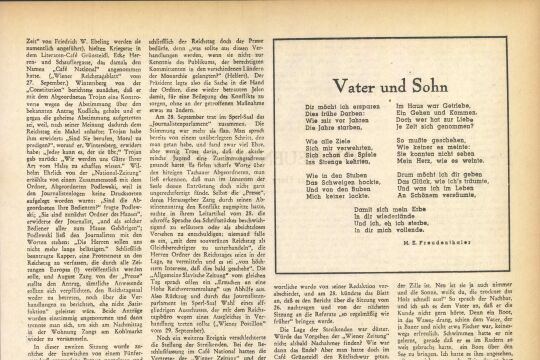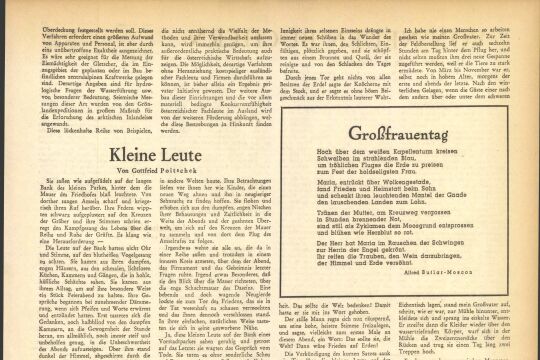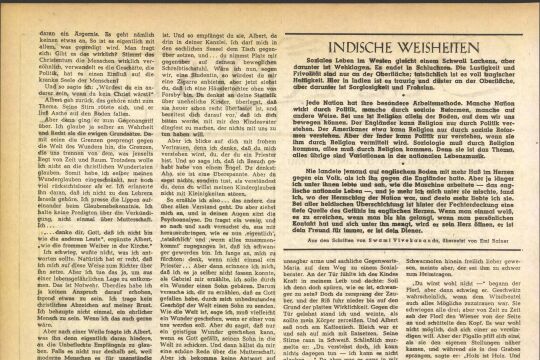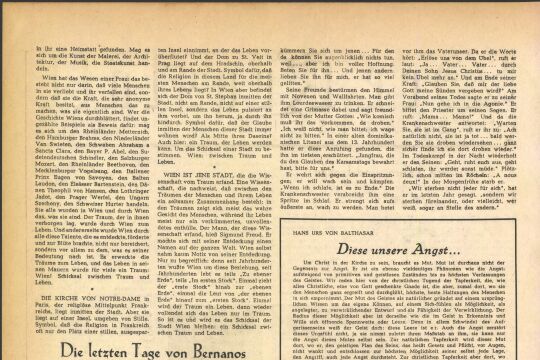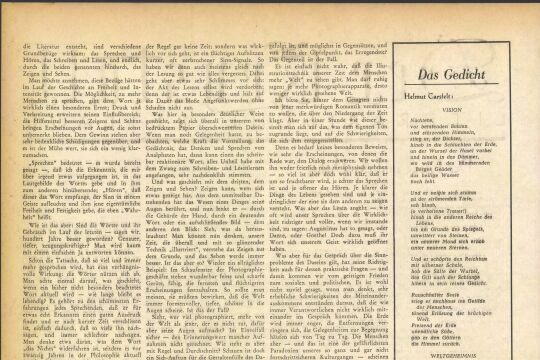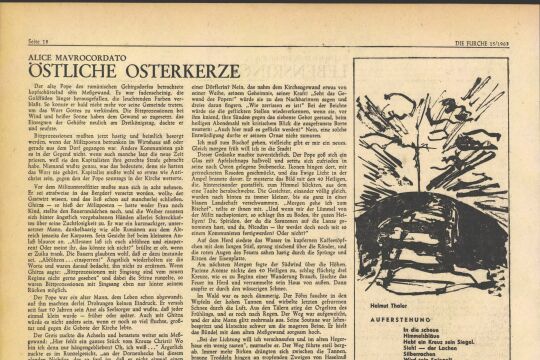Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Pferdchen
In unserem Keller steht ein Pferd, ein Schaukelpferd; ich bekam es vor sechzig Jahren, und vor fünfundzwanzig Jahren schenkte ich es dem älteren Sohn, und vor siebzehn Jahren versuchte ich es dem Jüngsten anzubieten.
Pferde standen nicht hoch im Kurs, ob lebend oder aus Holz. Ich sagte zu meinem Ältesten: Setz dich drauf, du kannst reiten.
Er umging es zweifelnd. Es ist ein Fuchs, mit blonder Mähne und blondem Schweif, echtes Pferdehaar, es bläht die Nüstern, hat die Trense im Maul, der Sattel, mit den Steigbügeln daran, ist aus echtem Leder.
Als ich den Ältesten aufforderte zu reiten, erinnerte ich mich, daß ich nicht gezögert hatte als Kind; jetzt wunderte ich mich, daß es für ihn so schwierig war, mit den Fü-
ßen in den Steigbügeln das vor-und zurückfallende Gewicht des Körpers auszugleichen, während das Pferd auf den Kufen schaukelte. Ich brauchte es nicht zu lernen, dachte ich, und: ich habe das richtige Geschenk nicht getroffen, und nahm eine Niederlage hin.
Doch noch ließ ich nicht locker, es ging um die Rettung des Pferdes nach so langen Jahren. Ich stieg auf, preßte die Schenkel an die Pferdeschulter (meine Knie reichten fast über den Pferdekopf hinaus), nahm die Zügel, und es ging los, ein treues, unermüdliches Pferd.
Es vertrug sich gut damals mit den zwei Norikern des Nachbarn, Botenpferde, die Lasten in die Nachbarorte brachten, weil es dorthin keine Bahn gab. Da waren Fried, der Knecht, der Stall und das Licht abends im Winter, wenn er mit den Pferden und dem Wa-• gen heimkam. Mein Bruder und ich standen am Fenster, hörten die Stimme des Knechtes, sahen, wie er die Laterne vom Langwied nahm und die abgeschirrten Pferde hineinführte, hörten die Hufe dumpf auf den Bohlen. Fried schloß das Tor, und dann blieb nur das Licht im verstaubten Stallfenster und unser Entschluß, zu Fried und den Pferden zu gehen.
Fried kannte uns, wir halfen mit, schütteten den Hafer in die Tröge, stiegen in den Heuboden und warfen Heu durch die Luke. War Fried brummig, standen wir abseits. Das Fell der Pferde taute auf, der Geruch nach frischen Pferdeäpfeln vermischte sich mit der Ausdünstung und mit der Würze des Hafers und des Heus.
An einem Wintertag setzten wir unseren Wunsch durch, mit Fried zu fahren, saßen in Mantel und Decke neben ihm, blickten auf die sich wiegenden Pferdekruppen, erfuhren, woher das Eis im Fell kam, der Schnee auf Frieds Hut und schlugen selbst Schnee aus den Mänteln, froh um den warmen Stall und um das Licht aus der schmutzigen Laterne. Wir riefen die Pferde beim Namen, durften in die Boxen treten, das zuk-kende Fell tätscheln, der Dunst lagerte in unseren Kleidern, stieg mit uns ins Bett, wir träumten von den Pferden, am anderen Tag brachten wir Brot und Zucker mit.
Gute wie schlechte Botschaften gehen durch den Magen, auch bei Pferden. Das bestimmte meinen Umgang mit ihnen, und ich weiß nicht, wie mein Bruder später damit verfuhr: rasch etwas ins Maul der Pferde. Hat man etwas in schlechten Zeiten, soll man den anderen teilhaben lassen.
Die russischen Panjepferde im Krieg nahmen die Handvoll Stroh wie die Noriker den Zucker. Stroh war köstlich, eine Handvoll goldgelbes Stroh. Diese Pferde waren klein und zäh, es machte ihnen Freude, gegen Wind und Schnee zu laufen, oft durch Gegenden ohne Herberge. Als das Ende des Stellungskrieges die Lebensgewohnheiten auflöste, waren die besseren Zeiten vorbei. Aber die kleinen Pferde fügten sich ins Unvermeidliche; die volle Krippe oder das dürre Büschel Stroh vom Dach, immer standen sie mit einem Huf im Grab. Sie trabten vor ihrem Tod her unter dem hölzernen Bogenjoch, begleitet von den Einschlägen der Artillerie im Schnee, unser Ostpreuße verängstigt und entschlossen auf dem Kutschbock. Neunzehnhundert-undeinundvierzig, Kälte und Hunger, Stroh wurde zu Asche, und viele kamen um im Schnee, starr die Augen und weiß die Haut unter dem struppigen Fell.
In meiner Kindheit weideten sie in Herbstnächten unter dem Mond, waren Zigeunerpferde, die Vorderbeine lang-gebunden, traten ans Gebüsch, es raschelte, und sie schlugen mit den Hufen ins Wasser und tranken. Ein langgezogenes Prusten der Erleichterung. Jede Nacht dieses Prusten und Schnauben, Reiben am Baumstamm, und die Leute blieben, von Frost und Schnee überrascht, schlugen das Eis im Bach auf, heizten das Fallholz und schlichen um die Höfe.
Ich begegnete ihnen wieder oder ihren Brüdern als Kriegsgefangener in Montana, als seien sie auferstanden bei Schneeschmelze und vollzählig, als der Schnee wiederkam in den Rocky Mountains. Der Pullmanzug dampfte den Paß hinauf, über Trassen, durch Schluchten, erreichte ein Hochtal; verstreute Felsblöcke und dazwischen — man traute den Augen nicht — scheckige Wildpferde, die sich nicht um den Zug kümmerten.
Im warmen Pullmanwagen schlug ich die Brücke: Schnee und Schnee kann zweierlei sein, Todesnähe und Freiheit verdünnen sich und lösen sich auf, und noch verharrte ich auf der Brücke: ehe wir nach Kalifornien aufbrachen, stand der kleine Schimmel da oben an der kanadischen Grenze, nachts, bei dreißig Grad Kälte im Freien. Er war mir mehr als Pferd, Sinnbild einer Welt ohne Ausweg.
Da war ein Haus, aber man hatte keinen. Platz für ihn, oder wie das war —; ich verließ die Baracke, wenn ich fror, sah ihn stehen an dem Pfahl, ohne Schatten. Ich weiß nicht, warum er nicht erfror, und wenn ich fror auf dem Feldbett unter den Decken, ging ich hinaus und hoffte, ihn nicht mehr zu sehen. Doch er stand da, ich sah hinüber, erwartete ein Zeichen. Ich las die Bibel, das einzige Buch, das es hier gab, beobachtete das Feuer im Kanonenofen, las, ging hinaus, kam und las wieder und wurde den kleinen Schimmel nicht los, und auf der Fahrt nach Süden, im raschen Wechsel vom Winter in den Frühling, verlor der kleine Schimmel an Wirklichkeit.
Heute zweifle ich an der Tatsache; doch der Schimmel stand da, ich bin mehrmals hinausgelaufen, er bewegte die Ohren, und wenn er sich auflöste, waren die Umstände schuld: die fetteren Zeiten verwischten die Erinnerung; hier, in Kalifornien, war die Orangenernte im Gange, es war schwierig, einen Tannenbaum aufzutreiben, schließlich wurde es eine Kiefer. In Montana wären wir dem Gewohnten nahe gewesen mit Bibel und Pferd, Kälte und Schnee. Hier gab es Tulpen und Orangen. Auch die Kiefer ist nicht richtig, sagten wir.
Man trug das Eigene ins Fremde hinein, sang den Tannenbaum, sang Mamatschi von der Küste des Pazifik über Afrika, Nordeuropa bis nach Sibirien, das Lied von den Pferdchen aus Marzipan, die er nicht haben wollte. (Ich wußte noch nichts von meinen Söhnen und daß sie mein Schaukelpferd verschmähen würden.) Der Sänger verschmähte die Pferdchen aus Marzipan, das
Lied schmeichelte Männern, die härter waren, und später, daheim, bei Betriebsfeiern, stand einer auf, sang das Lied, und es brachte das Eismeer herbei, die Steppe oder die Wüste.
Ich sah meinen ältesten Sohn an und las in seinen Augen den Zweifel; ich wollte das Pferd eigentlich nicht, hieß das. Wenn ich hartnäckig blieb, dann nur, weil ich bereit war, eine Niederlage ein zweites Mal einzustecken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!