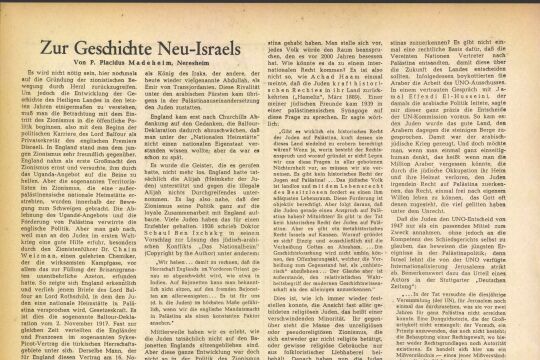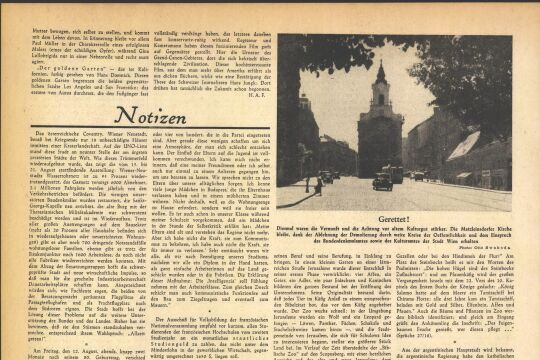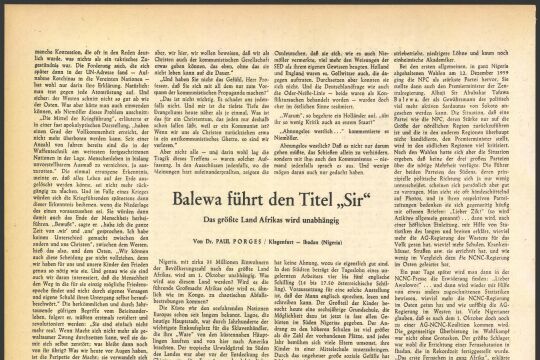Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die neue Levantisierung
Was geschieht, wenn zwei Straßenlaternen zertrümmert werden, eine im Rechavia-Viertel von Jerusalem, das zum größten Teil von ehemals deutschen Juden bewohnt wird, und die andere im Armenviertel Nach-laot? Auf diese Frage antwortete ein junger orientalischer Jude aus Nach-laot: „In Rechavia wird ein Jecke (ein ehemaliger Deutscher) sofort die Stadtverwaltung anrufen und bitten, man möge die Laterne reparieren — aber nichts dergleichen wird geschehen. Daraufhin wird er einen Brief an den Bürgermeister schreiben — und er wird keine Antwort erhalten. Daraufhin wird er einen Leserbrief an seine Tageszeitung schreiben, der wird veröffentlicht werden, die Presseabteilung der Stadtverwaltung erhält den Zeitungsausschnitt, mit diesem begibt sich der Leiter der Presseabteilung sofort zum Bürgermeister und bittet, die Laterne schleunigst reparieren zu lassen, um das Image der Stadtverwaltung zu wahren.“
„Warum tun Sie dasselbe nicht auch in Nachlaot? Auch Sie können ja Briefe schreiben“, fragt man den jungen Mann. Seine Antwort: „Unser Stadtviertel ist eben schöner, wenn es dunkel ist und wenn man es nicht sieht.“
Diese Episode veranschaulicht den Unterschied zwischen orientalischen und europäischen Juden. Es gibt keine offizielle Diskriminierungspolitik, im Gegenteil, von Seiten der Regierung wird alles versucht, die krassen Klassenunterschiede, die in Israel auch Rassenunterschiede sind, soweit wie möglich zu verringern. Im Norden Tel-Avivs gab es ein Armenviertel (Machlul), das sich auf bestem Baugrund befand. Die Einwohner des Viertels erhielten so hohe Abfindüngen, daß jede Familie sich daraufhin eine schöne Luxus-Wohnung in einem Neubau im Norden Tel-Avivs kaufen konnte. Diese Familien wurden völlig in ihre neue Umgebung integriert.
Im Süden der Stadt befand sich ein anderes Armenviertel. Es wurde geräumt und die Einwohner erhielten Wohnungen in einer neuen Wohnsiedlung. Heute ist diese Siedlung fast schon wieder zu einem Slum geworden, denn hierher hat man die Menschen verpflanzt, ohne den Versuch zu machen, ihr gesellschaftliches Niveau zu heben.
Wegen seinen sozialen Rückständen wird ein orientalischer Jude oft nur Hilfsarbeiter werden und hält sich für diskriminiert, weil ein Ingenieur das Dreifache verdient. Der Orientale versteht nicht, daß der Ingenieur ein jahrelanges Studium hinter sich hat. Dazu kommt, daß die Aussichten eines Orientalen, Ingenieur zu werden, um vieles kleiner sind als die eines Europäers.
In den fünfziger Jahren, als die großen Einwanderungswellen aus den orientalischen Ländern nach Israel kamen, wurden diese Juden in neugegründeten Entwicklungsstädten und landwirtschaftlichen Siedlungen angesiedelt. Der Staat hatte kein Geld, und obwohl die meisten Familien kinderreich waren, erhielten sie nur kleine Zweizimmerwohnungen. Sogar das Schulsystem war in den Siedlungen rückständig and ist es zum größten Teil auch noch heute. Jeder bessere Lehrer zieht es bei gleichem Gehalt vor, in einer der drei Großstädte des Landes zu unterrichten, da die Aussicht auf gesellschaftlichen Kontakt in der primitiven Umgebung der Neueinwanderer nicht gerade verlockend ist. Diese Tatsache führte dazu, daß die zweite Generation der orientalischen Juden auch heute schon deswegen diskriminiert ist, weil sie eine viel schlechtere Erziehung erhalten hat. Hinzu kommt noch, daß ein auf europäischem Standard aufgebautes Erziehungssystem nicht immer den Fähigkeiten einer Jugend aus rückständigen Ländern entspricht. Auch die Schulen der Armenviertel von Tel-Aviv und Jerusalem sind kaum besser. In den reicheren Bezirken der Stadt hat ein Lehrer Aussicht, mehr Geld durch Privatunterricht zu verdienen und er unterrichtet zudem Schüler aus seiner eigenen Gesellschaftsschicht.
Als in den siebziger Jahren die Neueinwanderer aus der Sowjetunion und aus Südamerika kamen, erhielt jede Familie bereits eine Drei- oder Vierzimmerwohnung, obgleich die Neubürger nur ein bis zwei Kinder im Durchschnitt hatten, die orientalischen Juden aber vier bis acht. Wenn heute eine orientalische Familie ins Land käme, würde sie eine ähnliche Wohnung erhalten, doch es kommen keine Orientalen mehr. Mit Recht halten sich die orientalischen Neueinwanderer der fünfziger Jahre für diskriminiert, da sie bis heute ihre Wohnungsprobleme nicht lösen konnten. Die Rassendiskriminierung beruht auf Vorurteilen, die nicht ohneweiteres zu überwinden sind. Die herrschende Schicht Israels ist seit der Staatsgründung eine europäische, die aus verständlichen Gründen ihre eigenen Leute (insbesondere Russen und Polen) vorzieht.
67 Prozent der Volksschüler sind in Israel orientalischer Abstammung. 56,5 Prozent der Mittelschüler sind Orientalen, aber nur 12 Prozent der Studenten des ersten Semesters an den Universitäten sind orientalischer Herkunft und nur vier Prozent der Universitätsabsolventen.
Nur 18 von den 120 Parlamentsmitgliedern und drei von den 19 Kabinettsmitgliedern sind Orientalen, obwohl 48 Prozent der jüdischen Bevölkerung orientalischer Abstammung sind.
Das Gefühl der Diskriminierung ist bei der orientalisch-afrikanischjüdischen Bevölkerung sehr verbreitet, obwohl ein großer Teil von ihnen wirtschaftlich gut situiert ist. Die orientalische Bevölkerung nimmt auch an Einfluß immer mehr zu, was in gewissen Fällen zur Levanti-sierung des Straßenbildes beigetragen hat. Das Minderwertigkeitsgefühl der Zurückgesetzten kommt insbesondere bei Arbeitskonflikten zum Ausdruck.
Das Problem der orientalischen Juden ist heute das weitaus wichtigste innerhalb der israelischen Gesellschaft, denn diese Juden werden in Zukunft nicht nur das Bild des Staates prägen, sondern auch das Bild der Armee.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!