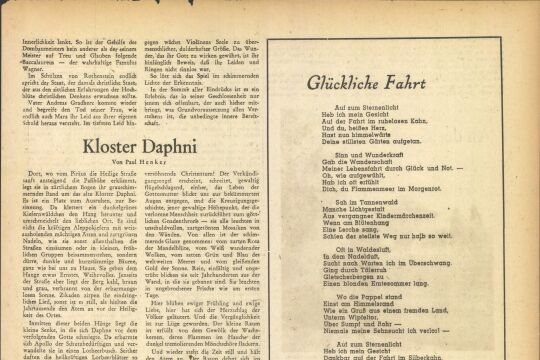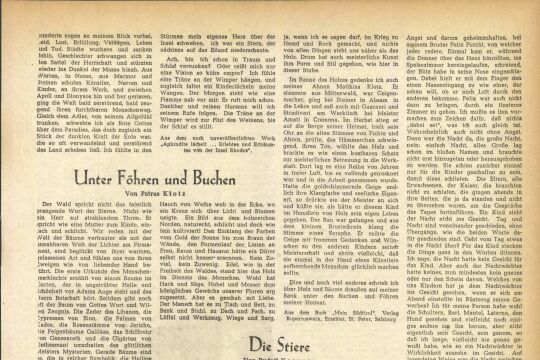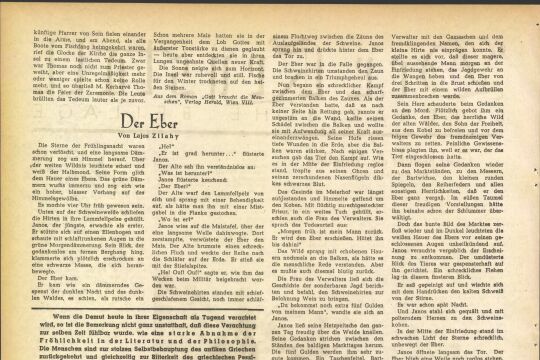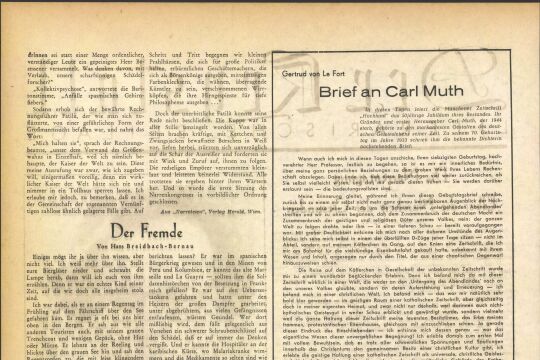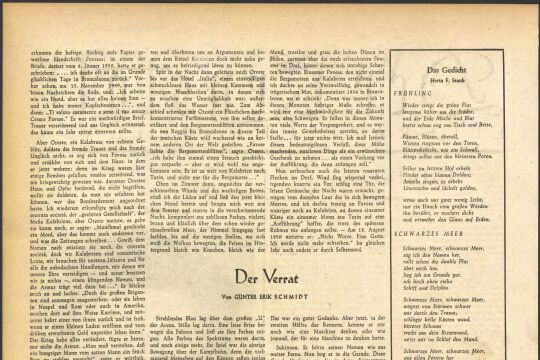Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Phönix aus der Asche
Schulz, der Kaufmann, den alle Phönix nannten, hatte sich längst mit seinem Spitznamen abgefunden, fast gefiel er ihm. Als Kleinkind war er lebend aus einem brennenden Haus gerettet worden, in dem sonst nur noch Leichen lagen. Seither blieb ihm der Name: Phönix. Die Silben hafteten und verdrängten auf natürliche Weise seinen wirklichen, gewöhnlichen Namen.
Der Knabe galt als ein besonderes Kind, obwohl es ihn jahrelang quälte, wenn die Leute ohne Anlaß und Ubergang stets vom Wunder seiner Rettung sprachen. Auch war ihm der Sinn dieses Spitznamens lange nicht bewußt. Erst viel später, als sein Herz und sein Gehör stumpfer wurden, sprach er das Wort dann selber mit Leichtsinn aus. Das frühe Wunder, an das er keine Erinnerung hatte, überzeugte ihn endlich, daß ihm nichts Schlimmes widerfahren könnte.
Seine Firma, die er in jungen Jahren gründete, nannte er „Phönix Enterprise“. Er fürchtete nichts und keinen. Auch das allgemeine Geschwätz vom Weltuntergang, das seine Zeit begleitete, kümmerte ihn nicht. Da er mit den Gegebenheiten, wie er sie sah, nicht einverstanden war, wünschte er der Welt geradezu diesen letzten Tag. Er vergaß dabei, daß er selber Teil des Planeten war. Ohne sich ausdrücklich aus der allgemeinen Komödie auszuschließen, bezog er sich dennoch nicht in sie ein. Hauptrollen lehnte er ab. Man hätte ihn gedankenlos und unverantwortlich schelten können, aber ebensogut paßte das Lob zu ihm, er stünde über den Dingen.
Eines Morgens saß Phönix beim Frühstück und stellte fest, daß er gegen unsichtbare Wände lief. Er beobachtete seinen Zustand nur noch mit klinischem Interesse. Warum lebte er, warum hatte er überlebt? Den Hinweis sogenannter Geistesmenschen, er wäre nicht umsonst vom Schicksal aufgespart worden, quittierte er mit Spott. Das Schicksal, die Zukunft hätten viel mit ihm,vor L Es war zu lächerlich. Ein Kaufmann hat keine Zukunft, so oder so, dachte Phönix. Auf keinen Fall wollte er an eine Sendung glauben. Die Bilanzen reichten ihm. Nichtsdestoweniger hatte er von seiner Existenz genug. Es war an der Zeit, sich eine neue Geburt zu verordnen.
Phönix wollte diesen Entschluß auf der Stelle in die Tat umsetzen. Um einen richtigen Anfang ging es ihm. Er wußte nicht, ob das weichgekochte Ei, in dem er gerade löffelte, noch zum alten oder schon zu seinem neuen Leben gehörte.
Er war, wie an den meisten Tagen, spät aufgestanden, er arbeitete gern nachts und bestimmte seine Bürostunden nach Laune. Es war nicht seine Schuld, wenn das Immobiliengeschäft, in dem Phönix tätig war, einen wenig seriösen Boden hatte.
Um der Erde, in der sein Erfolg verankert war, nur recht nah zu sein, ging Phönix zu Fuß in sein Büro, obwohl diese Wanderung einer Ohrfeige ins Gesicht jener Zivilisation gleichkam, deren blühendes Produkt der Kaufmann war. Seine Hartnäckigkeit, auf die eigenen Füße zu vertrauen, war ein Betrug an der Gegenwart. Längst schon erweckten Fußgänger Mißtrauen. Phönix aber spazierte durch die häßlichsten Viertel und Vorstädte, er sah weniger die Wirklichkeit als die — immerhin traumverwandten — Möglichkeiten.
Er schaute jeden Flecken Erde auf seinen Kauf wert hin an, dabei hielten die Vorüberfahrenden ihn für einen Bettler. Phönix, eben weü er Bequemlichkeit und Luxus liebte, rebellierte gegen den Verkehr. Er stemmte sich mit jedem Schritt, mit der Bestimmtheit seiner guten Schweizer Schuhe, gegen das allgemeine Fließen. So ging er, schweißüberströmt auch an kühlen Tagen, an den Straßenrändern dahin.
Schon oft hatten Polizeiwagen neben ihm angehalten, und eher kalt als besorgt war er gefragt worden, ob er Hilfe brauchte. Nein, er ginge bloß gern zu Fuß, antwortete er dann, aber er fühlte nur zu deutlich, wie er sich —
schuldlos - schuldig fühlte.
Er, der Millionär, vermochte dem Polizisten nicht in die Augen zu blicken. Hunde bellten Phönix nach, mitleidige Autofahrer luden ihn zum Mitkommen ein. Es war nicht einfach, so viel Besorgtheit abzulehnen. Das Allernatür-lichste erforderte Heldentum. Nicht aus Vorliebe für Eleganz, sondern aus Freude an angenehmen Dingen trug Phönix teure Anzüge und Krawatten, dennoch kam er sich mehr und mehr wie ein Landstreicher vor.
Vielleicht lag darin eine Zukunft. Der Chef verachtete ohnedies seine Chefetage. An den Abenden saß er lange beim Fenster, er brachte nicht die Kraft auf, den Wolkenkratzer zu verlassen. Draußen stolperte der Blick über eine Vielzahl ähnlicher Türme. Sie waren allesamt hell erleuchtet und doch menschenleer.
Phönix hörte die kalten Gebäude dem einzelnen unmißverständlich zurufen, wie klein er sei. Wer hier arbeitete und sein Leben verbrachte, der rutschte unbemerkt ins Verbrechen ab. Selbst die lauterste Ehrlichkeit neigte zum Kriminellen. Der Gedanke streifte Phönix und fiel wieder ab. Die schneidende Geometrie der modernen Linien zerriß jedes Gefühl. Aber die Angestellten lobten ihren modernen Arbeitsplatz. Einsam empfand Phönix sein Traumbüro im dreißigsten Stockwerk als Erniedrigung. Ergab das irgendeinen Sinn?
Daran scheiterte auch die Neugeburt: Nämlich an der Unfähigkeit, den Blick nach oben zu heben. Phönix fürchtete sich vor seinem täglichen Weg über die Parkplätze, die die Wolkenkratzer umgrenzten. Auf diesen Gängen entdeckte Phönix seine Gewöhnlichkeit. Da merkte er, wie er vom Staub kam und zum Staub zurückkehrte, allen hohen Vorsätzen zum Trotz. Er war ja unfähig, seine Blicke oben zu halten. War er dafür aufgespart worden, in dem großen Feuer seiner Kindheit?
Immer wieder nahm Phönix sich vor, nur auf die Baumkronen zu achten, die sich dem Licht und dem Wind hingaben. Täglich befahl er sich: Ich will in die Ferne schauen, auf die Hügel am Ende der Straßenzüge. Er beschloß seine Neugeburt und sah dann doch nur die Nummerntafeln der Autos. Aufkleber und Schilder las er, lernte sie auswendig, verachtete sich für seine Optik des Niederen. So kannte er weder die Bäume noch die Sehnsuchtshügel am Horizont, wohl aber die Blechschäden der Fahrzeuge. Er war aus der Asche hervorgestiegen, um in Asche zu ersticken.
Wie würde es weitergehen mit ihm, denn es geht doch weiter, oder nicht? Herr Schulz will, daß es weitergeht; um jeden Preis. Dafür ist er gerettet worden, das weiß er gewiß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!