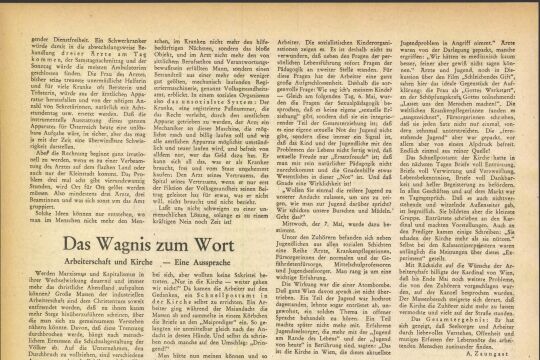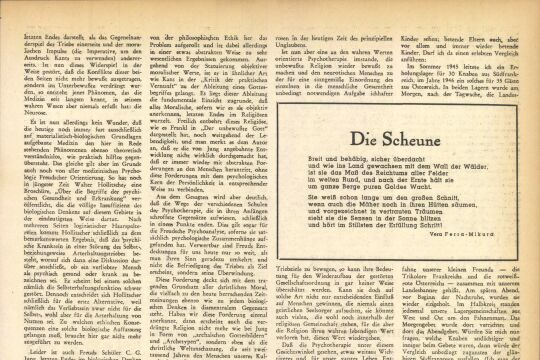Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fanfarenstoß ohne Echo
Schon der Raum ist symbolisch. In einer aufgelassenen Wiener Straßenbahnremise, in einer durch die Entwicklung funktionslos gewordenen Halle, werden Bilder, Montagen. Plakate, Erinnerungsstücke aus einer Zeit gezeigt, die noch voller Hoffnung war: „Mit uns zieht die neue Zeit".
Schon der Raum ist symbolisch. In einer aufgelassenen Wiener Straßenbahnremise, in einer durch die Entwicklung funktionslos gewordenen Halle, werden Bilder, Montagen. Plakate, Erinnerungsstücke aus einer Zeit gezeigt, die noch voller Hoffnung war: „Mit uns zieht die neue Zeit".
Mit uns zieht die neue Zeit: So begann das Lied der Jugend damals, unter diesem Motto steht auch die Ausstellung, die die „Arbeiterkultur von 1918-1934“ in Erinnerung rufen will.
Mit uns zieht die neue Zeit! Das klingt wie ein Fanfarenstoß; er verhallt ohne Echo. Wohin ist die neue Zeit gezogen? Spüren wir sie, vermissen wir sie wenigstens? Ein Gang durch die Ausstellung ist eine Reise in die Vergangenheit, mit Wehmut und ein wenig Trauer, eine Reise auch in die eigene Vergangenheit.
Ja, so haben wir gewohnt in den 20er Jahren in einer Zimmer-Küche-Woh- nung mit der Bassena und dem Abort am pang, mit dem immer brüllenden Hausherrn, vor dem die Frauen ihre Kinder versteckten. In der Küche brannte noch die Petroleumfunzel, aber sie gab Licht zum Lesen. In ihrem Schein hat die Mutter Bücher gelesen, die sie verstehen wollte, und die sie doch kaum verstand.
Eine einklassige Volksschule auf dem Land hat sie besucht, und auch die nicht zu Ende. Denn mit elf Jahren mußte sie als „Kindsdirn“ in den Dienst gehen. Nach schwerer Tagesarbeit saß sie abends im Volksheim und hat Vorträge über Geschichte, über Dichtung und Volkswirtschaft gehört. Die Augen sind ihr oft zugefallen, aber sie hat nicht aufgegeben.
Hunderte Arbeiter und ihre Frauen saßen so wie sie nach harter Tagesarbeit auf harten Bänken, sie hatten Hunger nach Bildung, nach dem Brot des Wissens. Sie haben gedarbt, damit ihre Kinder studieren konnten. Wissen ist Macht, hat man ihnen gesagt. Wissen war für sie auch Reichtum, Fülle, Menschsein.
Mit uns zieht die neue Zeit! Wo ist sie geblieben? Die Söhne und Enkel haben ein Wochenendhaus oder eine
Zweitwohnung, der Farbfernseher ersetzt den Vortrag, der Doppelliter auf dem Tisch das Buch. Ins Volksheim geht man, wenn überhaupt, um ein paar Brocken Spanisch für den Urlaub auf Mallorca zu lernen oder raffinierte Rezepte für tolle Parties zu erfahren.
Der Fuß tritt nicht mehr auf weichen Waldboden, sondern auf das Gaspedal, die Wanderlieder sind vergessen, am Abend singen sie beim Heurigen „Mir raubt nix mei Ruah, mein goldnen Ha- mur“, die Bundeshymne des ÖGB, hat ein Witzbold gemeint.
Die neue Zeit sollte von einer neuen Kultur geprägt werden, gleichzeitig sollten aber die Arbeiter an die „bürgerliche“ Kultur herangeführt werden. Arbeitersymphoniekonzerte hat es gegeben, viele Arbeiter hatten Tränen in den Augen, als sie zum ersten Mal eine Beethoven-Symphonie hörten.
Uber soviel romantischen Überschwang würde die Jugend heute lächeln. Sie hält sich lieber an die Diskotheken. Auch Arbeiterdichter hat es gegeben; ich habe noch einen gekannt, er war Stahlarbeiter in Königsberg, aber meist arbeitslos. Er hat Gedichte gemacht, die sich reimten, die Berge und die Liebe besangen und auch die Arbeit im Walzwerk und den trostlosen Alltag der Arbeitslosen. Die Arbeiter haben diese Gedichte verstanden und waren stolz auf ihren Kollegen. Gibt es heute noch Arbeiterdichter?
Die neue Arbeiterkultur sollte auch eine neue Körperkultur sein. Der eigene Körper wurde neu entdeckt, in großflächigen Bildern zeigt die Ausstellung die neue Freude am Leib, Bilder von der Arbeiterolympiade im Wiener Stadion. Die Zeit ist auch hier Wege gegangen, die die Arbeiter von damals nicht verstehen würden.
Eine „Sex-Kultur“ war ihnen dem Wort und dem Begriff nach fremd. Ihre Enkel würden über ihre Prüderie lachen. Damals aber haben sie nicht viel zu lachen gehabt, denn die Autorität des Vaters war gerade in der Arbeiterschaft unbestritten. Eine antiautoritäre Erziehung hätten die Arbeiter als Widerspruch in sich verstanden.
Auch die Freidenker gab es, die Ausstellung hat sie nicht vergessen. Sie kommen uns heute wie ein Trachtenoder Wanderverein vor. Die Natur, in die sie wanderten, war Für sie eine „gottlose“ Natur und ihr Faschingskränzchen stellten sie unter das Motto „Im Reiche des Satans“.
Sie waren nicht sehr zahlreich, aber sie hatten viel zu reden in der Partei. Sie selbst redeten - wie alle Atheisten - immer nur über Gott. Es soll sie heute wieder geben. Ob sie noch immer Kränzchen veranstalten unter dem Motto: „Im Reiche des Satans“?
Die Masse der Arbeiterschaft hat damals der massiven Kirchenaustrittspropaganda der Partei widerstanden. Ein Bild taucht auf; nicht in der Ausstellung, in der Erinnerung: Vater und Mutter in der Küche, das Kind auf dem Wasserbankerl. Die Mutter weint, der Vater hat gesagt: „Jetzt verlangen sie von uns, daß wir aus der Kirche austreten“. Er ist nicht aus der Kirche ausgetreten. Aber auch das sollte wohl zur neuen Zeit und zum neuen Menschen gehören: alle Reste einer „abergläubischen“ Vergangenheit sollen ausgetilgt werden.
Die Ausstellung vergißt auch die Religiösen Sozialisten nicht, jenes kleine Häufchen von Arbeitern, die ihren religiösen Glauben mit der marxistischen Überzeugung verbinden wollten. Sie standen zwischen zwei Blöcken, sie wurden beargwöhnt und nicht ernst genommen, von der Kirche nicht und nicht von der Partei.
1934 mit dem Ende der Partei endet für diese Ausstellung auch die Arbeiterkultur. Der Februar 1934 ist der Schlußpunkt. Mit den Bildern von den Februarkämpfen wird eine Legende illustriert: der Heldenkampf der Arbeiter gegen den Austrofaschismus.
Wieder steigen Bilder auf: Februar 1934 im Gemeindebau in Wien-Simmering. Zwei Schutzbündler ziehen einen verwundeten Heimwehrmann im Maschinengewehrfeuer Uber die Sandsackbarrikaden in den Hof. „Aufhängen! Darmausreißen! Umbringen!“
schreien einige Weiber von den Fenstern.
Vorsichtig heben die Schutzbündler den verwundeten Heimwehrler von der Bahre. Dann wendet sich einer den Schreierinnen zu: „Des is genau so a Kämpfer wie mir!“ In der Nacht haben sie sich auf den Laaerberg zurückgezogen, in den Ziegelteichen haben sie ihre Maschinengewehre und ihre Karabiner und ihre Toten versenkt und auch ihre Fahnen. Dann sind sie den letzten Weg gegangen, der für vieje in den Todeslagern des Stalinregimes endete.
Die Schutzbündler waren letzte Kämpfer der alten Armee, sie haben gekämpft, tapfer und treu, aber ohne Zuversicht, wie es Prinz Eugen von den österreichischen Soldaten sagte. Sie waren verloren von Anfang an. Ihre Führer waren geflohen, die Arbeiter haben sie im Stich gelassen, die Setzer und Drucker stellten die Zeitungen her, die Eisenbahner Führten die Panzerzüge des Bundesheeres und das Volk sah zu, mit Verbitterung oder in Lethargie.
Schon 1933 war ein Drittel der Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Auch das vermerkt die Ausstellung. Sie aber, die Schutzbündler, haben geglaubt, und sie haben gekämpft und sie sind gestorben. Wer sie ehren will, soll heute schweigen, aber nicht mit ihrem Tod sich Lorbeerkränze winden.
Mit uns zieht die neue Zeit! Wo ist diese neue Zeit geblieben? Ist sie in die Partei der Bankdirektoren, der „Lei- der-nein“-Millionäre, der Wirtschaftsmanager, der Demelianer, der satten Kleinbürger eingegangen?
Aber auch Zynismus und Schadenfreude wären letztlich Heuchelei. In Wehmut und Trauer verläßt der Besucher die Ausstellung. Hier war einmal ein Glaube, eine Hoffnung, eine Zuversicht, hier hat es den Hunger nach Bildung, den Hunger nach Gerechtigkeit, hier hat es einmal Solidarität gegeben.
Wo ist das alles geblieben? Auch die jungen Christen sangen damals das Lied von der neuen Zeit, sangen „Christus, Herr der neuen Zeit!“ Auch die Katholiken könnten in einer funktionslos gewordenen Kirche eine ähnliche Ausstellung machen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!