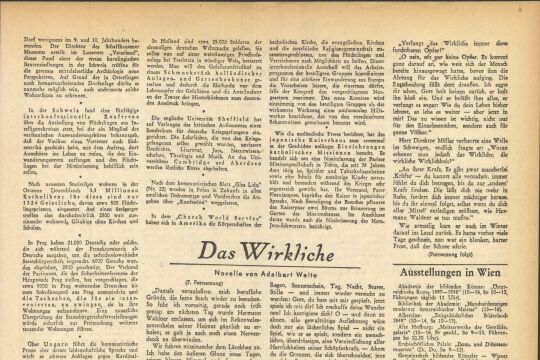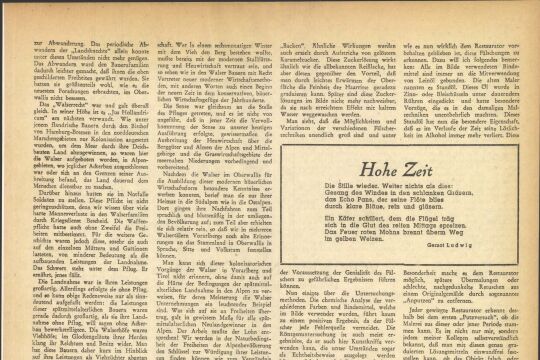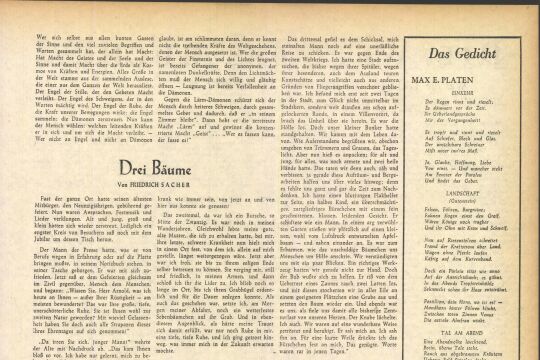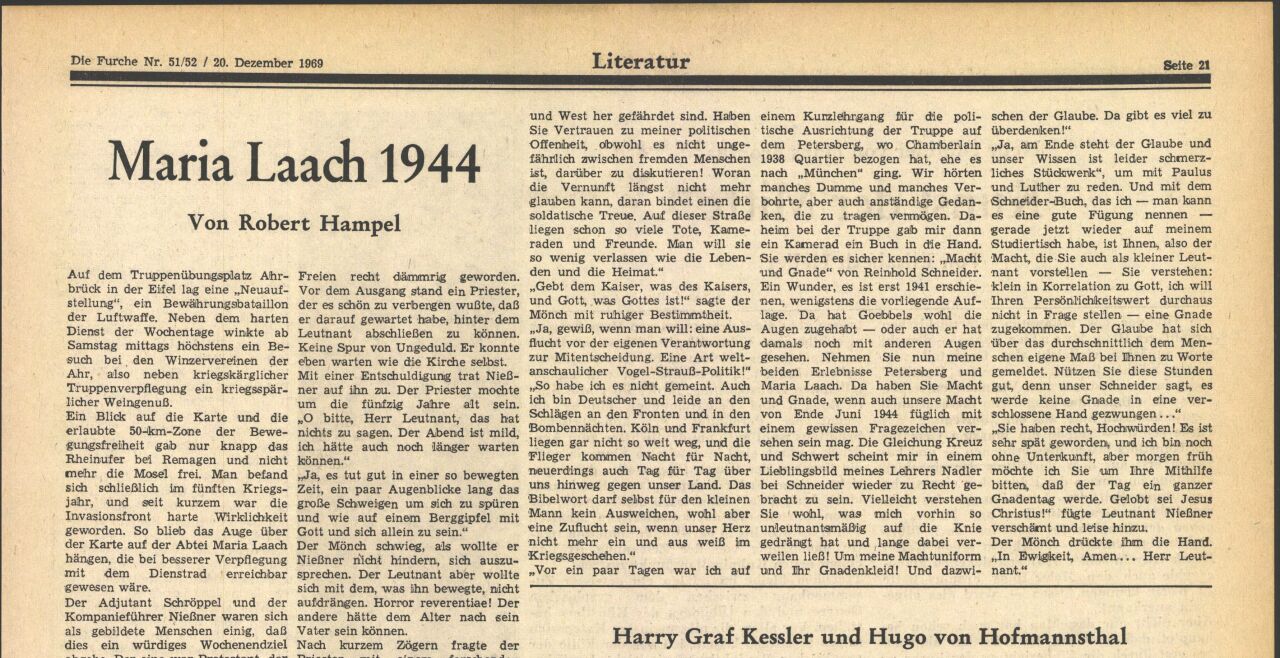
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Maria Laach 1944
Auf dem Truppenübungsplatz Ahrbrück in der Eifel lag eine .Neuaufstellung“, ein B e währ ungab a taillon der Luftwaffe. Neben dem harten Dienst der Wochentage winkte ab Samstag mittags höchstens ein Besuch bei, den Winzervereinen der Ahr, also neben kriegskärglicher Truppenverpflegung ein kriegsspärlicher Weingenuß.
Ein Blick auf die Karte und die erlaubte 50-km-Zone der Bewegungsfreiheit gab nur knapp das Rheinufer bei Remagen und nicht mehr die Mosel frei. Man befand sich schließlich im fünften Kriegsjahr, und seit kurzem war die Invasionsfront harte Wirklichkeit geworden. So blieb das Auge über der Karte auf der Abtei Maria Laach hängen, die bei besserer Verpflegung mit dem Dienstrad erreichbar gewesen wäre.
Der Adjutant Schröppel und der Kompanieführer Nießner waren sich als gebildete Menschen einig, daß dies ein würdiges Wochenendziel abgebe. Der eine war Protestant, der andere Katholik. Parteimitglieder waren beide im Frieden gewesen, aber das war lange genug her. Die Abtei, war zudem nicht nur Kirche, sondern auch hohe deutsche Kunst. Da der Chef unter dem Namen „Dienstreise“ ins Wochenende heimfuhr, mußte der Adjutant als sein Vertreter bleiben. So schrieb er seinem Kriegskameraden von Smolensk und vom Mius einen Dienstreiseausweis zum Zahnarzt nach Andernach, und der Rest war mit einem Wochenendurlaubsschein per Flügelbahn und zu Fuß unschwer zu schaffen.
Die Dörfer zwischen Brohl und dem Laacher See wirkten nicht so romantisch wie die Siedlungen am Mittelrhein. Das große Waldstück, das Nießner zu durchwandern hatte, gefiel ihm schon besser, und er versäumte sich geraume Zeit mit den vielen köstlichen Erdbeeren am Rande seines Wanderweges. So kam er erst am späten Nachmittag an den See und sah die Abtei vor sich liegen.
Ja, die Kirche wußte zu bauen in der Landschaft, die sie einst kultiviert hatte. Das kleine Stück Brot der Wegzehrung war längst aufgezehrt, und ein lebhaftes Verlangen nach einem Imbiß machte sich bemerkbar. Noch mehr aber lockte es den Wanderer in Uniform, das Gotteshaus zu betreten. Ein Stammgericht werde hernach im Gasthof schon noch zu bekommen sein.
Der Leutnant trat ein in den romanischen Kirchenbau und genoß nach dem heißen Wandertag die Kühle. Als Söhn des Alpenlandes hatte er bisher nur Barock und Gotik auf sich wirken lassen können. In den deutschen Städten hatte er genug Neugotik und Neuromanik gesehen. Anständige Architektenarbeit gewiß, aber hier lebte edle Kunst als Ausdruck einer alten, kaum umstrittenen Religiosität. Unklare Zusammenhänge stiegen in Nießners Denken auf, warum es für den westdeutschen Katholizismus nie jenen Gegensatz auszutragen galt, der in der Heimat zwischen national und religiös seit Generationen hochgespielt worden war.
Vorne knieten Mönche in ihren Stühlen und sangen in ergreifender Weise die Matu tin, die während des Krieges am Abend gesungen werden mußte. Ein Wunder an gläubigem Emipfindungsreichtum lag in diesen Stimmen. Ein überzeugender Preisgesang für den Herrn der Welt, dem die große Welt draußen nicht mehr zu gehorchen schien.
Auch Nießner kniete unweit des Ausganges in einer Bank und hielt Einkehr ohne eigentliches Gebet, doch mit vielen ernsten Gedanken, die von der Kinderzeit in einer Klosterschule bis in die soldatische Gegenwart gingen und die Lieben daheim einschlossen. So ging ein Soldat mit seinem Herrgott zu Rat. Nießner wußte nicht, wie lange er so kniete. Als er wieder „nach außen" fand war der Gesang der Mönche längst verklungen, und es war im
Freien recht dämmrig geworden. Vor dem Ausgang stand ein Priester, der es schön zu verbergen wußte, daß er darauf gewartet habe, hinter dem Leutnant abschließen zu können. Keine Spur von Ungeduld. Er konnte eben warten wie die Kirche seihst. Mit einer Entschuldigung trat Nießner auf ihn zu. Der Priester mochte um die fünfzig Jahre alt sein. „O bitte, Herr Leutnant, das hat nichts zu sagen. Der Abend ist mild, ich hätte auch noch länger warten können.“
„Ja, es tut gut in einer so bewegten Zeit, ein paar Augenblicke lang das große Schweigen um sich zu spüren und wie auf einem Berggipfel mit Gott und sich allein zu sein.“
Der Mönch schwieg, als wollte er Nießner nicht hindern, sich auszusprechen. Der Leutnant aber wollte sich mit dem, was ihn bewegte, nicht aufdrängen. Horror reverentiae! Der andere hätte dem Alter nach sein Vater sein können.
Nach kurzem Zögern fragte der Priester mit einem forschenden Blick: „Was führt Sie zu uns, Herr Leutnant?“
Nießner stellte sich vor und sagte: „Eigentlich wollte ich, da meine Truppe in der Nähe liegt, das Wochenende zum Besuch Ihrer berühmten Abtei nützen. Ich bin Germanist. Ihre Bibliothek, Stefan George, die „Stimmen von Maria Laach“, Ildefons Herwegen, der romanische Dom aus der Kunstgeschichte ... das lockte mich. In ungewiß naher Zeit geht es wieder an die Front. Da möchte man eben vorher noch ein wenig abendländische Kultur in friedlicher Schau erlebt und ins geistige Marschgepäck ausgenommen haben. Das war das Motiv meines Kommens. Flucht aus dem soldatischen Alltag, der eine Pflicht und letztlich keine Neigung ist. Einkehr in die Beflissenheit meiner Studienjahre, auch alter Wandertrieb und...“
„Und...?“
.. das Wanderziel brachte mehr als der Vorsatz es wollte. Es wurde eine kleine Einkehr daraus. Ihr prächtiges Gotteshaus und der Gesang Ihrer Mitbrüder hat einen Panzer aufgebrochen, den die grausame Zeit um mich geschmiedet hat. Sie wissen: Tote und Schlachten, Märsche und Gefahren, Sorgen und Nöte machen hart oder weich. Laut Nietzsche kommt es dabei nur auf das Material an. Ich wäre mehr für’s Weiche, doch da gäbe ich midi als Fußsoldat selbst auf. Aber ich halte Sie jetzt noch länger auf, hochwürdiger Herr, als es ohnedies schon der Fall ist...“
„Ich bin Priester und Mönch, Herr Leutnant, Soldat in Uniform war auch ich einmal, als ich Ihr Alter hatte. Nun aber mtiles ecclesiae und daher immer im Dienst. Im Beichtstuhl wie da drüben im Lazarett, das nun die ersten überlebenden Opfer der Invasionsfront in unsere Gemeinschaft aufgenommen hat. Und warum nicht hier an der Pforte zwischen Gott und Welt, zwischen Tag und Nacht? Vielleicht kann ich helfen oder wenigstens raten! Schließen Sie Ihr Herz nicht zu schnell vor dem grauen Alltag! Hier ist viel Gnade!“ „Ja, Gnade! Darüber ließe sich manches Wort reden..
„Wollen Sie beichten und zum Tisch des Herrn gehen, Herr Leutnant? Ich stehe zu Ihrer Verfügung, auch wenn es nicht gleich wäre und wenn es irgendwelche Barrieren zu überwinden gelte.“
„Gerne, obwohl ich mir’s nicht vorgenommen hatte, aber wenn die Furche so aufgetan ist, mag das Saatkorn hineinfallen. Zuerst ein paar Worte des offenen Bekenntnisses: Ich bin Katholik und bin noch immer Nationalsozialist. Sie werden darin gewiß viel sich Ausschließendes finden, und auch ich bin mir mancher Unvereinbarkeit bewußt. Aber so wie ich 1938, als man die Kirche bestürmte, sie mit meinem Bekenntnis nicht verließ, so möchte ich jetzt auch die Partei nicht verlassen, selbst wenn ich dies könnte, weil die deutschen Dinge von Ost und West her gefährdet sind. Haben Sie Vertrauen zu meiner politischen Offenheit, obwohl es nicht ungefährlich zwischen fremden Menschen ist, darüber zu diskutieren! Woran die Vernunft längst nicht mehr glauben kann, daran bindet einen die soldatische Treue. Auf dieser Straße liegen schon so viele Tote, Kameraden und Freunde. Man will sie so wenig verlassen wie die Lebenden und die Heimat.“
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist!“ sagte der Mönch mit ruhiger Bestimmtheit. „Ja, gewiß, wenn man will: eine Ausflucht vor der eigenen Verantwortung zur Mitentscheidung. Eine Art weltanschaulicher Vogel-Strauß-Politik!“ „So habe ich es nicht gemeint. Auch ich bin Deutscher und leide an den Schlägen an den Fronten und in den Bombennächten. Köln und Frankfurt liegen gar nicht so weit weg, und die Flieger kommen Nacht für Nacht, neuerdings auch Tag für Tag über uns hinweg gegen unser Land. Das Bibelwort darf selbst für den kleinen Mann kein Ausweichen, wohl aber eine Zuflucht sein, wenn unser Herz nicht mehr ein und aus weiß im Kriegsgeschehen.“
„Vor ein paar Tagen war ich auf einem Kunzlelhrgang für die politische Ausrichtung der Truppe auf dem Petersberg, wo Chamberlain 1938 Quartier bezogen hat, ehe es nach „München“ ging. Wir hörten manches Dumme und manches Verbohrte, aber auch anständige Gedanken, die zu tragen vermögen. Daheim bei der Truppe gab mir dann ein Kamerad ein Buch in die Hand. Sie werden es sicher kennen: „Macht und Gnade“ von Reinhold Schneider. Ein Wunder, es ist erst 1941 erschienen, wenigstens die vorliegende Auflage. Da hat Goebbels wöhl die Augen zugehalbt — oder auch er hat damals noch mit anderen Augen gesehen. Nehmen Sie nun meine beiden Erlebnisse Petersberg und Maria Laach. Da haben Sie Macht und Gnade, wenn auch unsere Macht von Ende Juni 1944 füglich mit einem gewissen Fragezeichen versehen sein mag. Die Gleichung Kreuz und Schwert scheint mir in einem Lieblingsbild meines Lehrers Nadler bei Schneider wieder zu Recht gebracht zu sein. Vielleicht verstehen Sie wohl, was mich vorhin so unleutnantsmäßig auf die Knie gedrängt hat und lange dabei verweilen ließ! Um meine Machtuniform und Ihr Gnadenkleid! Und dazwi schen der Glaube. Da gibt es viel zu überdenken!“
„Ja, am Ende steht der Glaube und unser Wissen ist leider schmerzliches Stückwerk“, um mit Paulus und Luther zu reden. Und mit dem Schneider-Buch, das ich — man kann es eine gute Fügung nennen — gerade jetzt wieder auf meinem Studiertisch habe, ist Ihnen, also der Macht, die Sie auch als kleiner Leutnant vorstellen — Sie verstehen: klein in Korrelation zu Gott, ich will Ihren Persönlichkeitswert durchaus nicht in Frage stellen — eine Gnade zugekommen. Der Glaube hat sich über das durchschnittlich dem Menschen eigene Maß bei Ihnen zu Worte gemeldet. Nützen Sie diese Stunden gut, denn unser Schneider sagt, es werde keine Gnade in eine verschlossene Hand gezwungen ...“
„Sie haben recht, Hochwürden! Es ist sehr spät geworden, und ich bin noch ohne Unterkunft, aber morgen früh möchte ich Sie um Ihre Mithilfe bitten, daß der Tag ein ganzer Gnadentag werde. Gelobt sei Jesus Christus!“ fügte Leutnant Nießner verschämt und leise hinzu.
Der Mönch drückte ihm die Hand. „In Ewigkeit, Amen... Herr Leutnant.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!