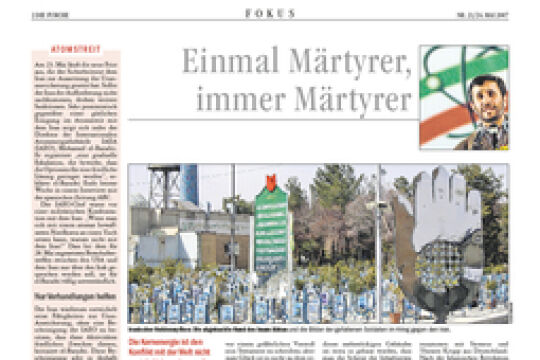Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fünfzig Jahre zurück
Elf Jahre nach Beginn der isla- mischen Revolution im Iran ist ein Ende der konkreten Unterdrük- kung nicht abzusehen. Anders als in Ländern mit Militärdiktaturen, erzählt ein etwa dreißigjähriger Student aus dem Iran in Wien, sind die Menschen seines Heimatlandes in erster Linie von der wirtschaft- lich aussichtslosen Lage bedroht.
„Der Kampf ums tägliche Über- leben nimmt die Iraner heute über- mäßig in Anspruch", berichtet der seit kurzem Verheiratete, der erst vor einer Woche von einem Hei- maturlaub nach Österreich zurück- gekehrt ist. „Meine Landsleute wol- len in Ruhe leben. Für mich ist es selbstverständlich, daß ich, wenn
ich nach Hause komme, mit den Kindern ausgehe, Zeit für die Familie habe. Das ist im Iran heute nicht möglich. Die Verantwortung und die Sorge für die Familie ist übermächtig geworden."
Somit stellt sich die momentane wirtschaftliche Situation des Iran als „eine Art der Unterdrückung" dar.„Das Hauptproblem liegt dar- in, daß die Ajatollahs alles, was ihnen in den Sinn kommt, mit Allah rechtfertigen", betont der FUR- CHE-Gesprächspartner. Auch eine dringend notwendige Agrarreform, die lange Zeit hindurch verspro- chen wurde, ist „im Namen Allahs" bisher hintangehalten worden.
Was gut funktioniert, gibt sich der Informant überzeugt, ist der internationale Waffenhandel mit dem revolutionären Iran. Viele Ira- ner geben den Großmächten die Schuld an der eigenen Misere, weil sie an diesem Deal nach wie vor größtes Interesse hätten; Wasser auf die Mühlen der Ajatollahs. Die Verknüpfung politischer Ziele mit religiösen Vorstellungen, wie sie die Mullahs praktizieren, ist für den jungen Iraner „die gefährlichste Art, auf die man in einem Land herrschen kann".
Wo bleibt der politische Wider- stand, wenn die Leute so leiden? Was werden sich die Iraner noch alles gefallen lassen? „Sehen Sie, bei uns gibt es so viel zu tun, um am Leben zu bleiben, daß wir gar keine Zeit haben, uns politisch zu betäti- gen." Die Iraner, müde der Revolu- tion, haben sich aufs Abwarten eingerichtet. Die Zeit muß sich halt ändern, sagen sie.
Der Student, der sehr gerne in Wien lebt, schildert seine Lands- leute als nette, arme Bauern mit einem guten Herzen, deren Lage man sehr leicht ausnützen kann. „Sieglauben an das einfache Leben und tun alles, was man ihnen sagt."
Nach wie vor zeigt das iranische Fernsehen Bilder von Massende- monstrationen, bei denen den Mul- lahs zugejubelt wird. Es entsteht der Eindruck, daß noch viele an die Revolution glauben. Ist diese me- dial vermittelte Begeisterung auch im iranischen Alltag zu spüren? Unser Informant hat bemerkt, daß im TV Ausschnitte früherer Mani- festationen gezeigt werden. „Ich habe bei einem derartigen Bericht das offenbar vom Cutter übersehe- ne Datum von 1987 gesehen."
Die Revolution war besonders erfolgreich unter den Armen des Landes. „Wenn einem, der nichts hat, etwas angeboten wird, dann nimmt er es doch gerne an", sagt der junge Iraner. Und jetzt, nach Beendigung des Krieges mit dem Irak (siehe Kasten), nachdem viele ihre Kinder verloren haben, wird mit dem Lob gearbeitet: Ihr habt doch etwas für Allah geleistet.
Damit wird einigermaßen ver- ständlich, warum es - obwohl viele gegen das Geistlichen-Regime ein- gestellt sind - keine politische Gegenbewegung im Lande gibt.
Im Iran hat auch die Jugend die
Revolution mitgetragen. „Und unsere Jugend ist jetzt tot. Entwe- der als Opfer des fast zehnjährigen irakisch-iranischen Krieges oder als frühe Widerstandskämpfer, die man entdeckt hat.
Die pessimistische Sicht des ira- nischen Studenten in Wien deckt sich in den Grundzügen mit Aussa- gen, die in Wien lebende Volksfe- daj in-Vertreter gegenüber der FURCHE Ende 1986 machten. Diese Widerständler waren davon über- zeugt, daß die Mullahs Religion bloß als Herrschaftsinstrument benütz- ten, moralische Überlegungen kei- ne Rolle spielten, die einzige reale Basis auch widerstreitender Kräfte innerhalb der schiitischen Hierar- chen der durch die Revolution er- richtete islamische Staat sei, den es unter allen Umständen und unter Austricksen aller Gegner zu erhal- ten gelte.
Die Volksfedajin setzten vor vier Jahren ihre Hoffnung auf Verände- rung auf den für den Iran verhee- renden Ausgang des Krieges mit dem Irak. Doch dieses jahrelange Gemetzel wurde beendet. Jetzt regiert die Angst im Land. Nie- mand möchte derzeit durch oppo- sitionelle Aktionen seine Familie gefährden.
„Der Respekt vor dem Leben ist aber in unserem Land geschwun- den", sagt der junge Mann und verweist auf die Revolutionsgardi- sten (Pasdaran). Viele Arbeitslose schließen sich diesen Milizen nur an, um wenigstens ihr Dasein fri- sten zu können. Pasdaran müssen die Befehle der Geistlichen Praxis werden lassen, das alltägliche Le- ben auf den Straßen beobachten und Verstöße gegen die Koranin- terpretation der Mullahs verhin- dern. Das gleiche Ziel hat auch eine Abteilung des Gerichtshofes, Mon- kerath genannt, die nur Verstöße gegen das islamische Gesetz ahn- det. „Mädchen und Frauen, die ihr Gesicht nicht bedecken, werden verwarnt oder bei mehrmaligen
Vergehen verhaftet, geprügelt und gesteinigt. Das passiert heute noch."
Der iranische Student erzählt von einem Freund, der, weil er nach einem Verwandtenbesuch am Abend seine Cousine im Auto nach Hause gebracht habe, von Monke- rath-Leuten aufgehalten und dar- auf hingewiesen worden sei, daß er nur seine eigene Frau mitnehmen dürfe. Das Mädchen, Mitglied der kommunistischen Fedajin, hatte unglücklicherweise ein paar Flug- blätter in der Tasche. Zusammen mit ihrem Cousin sei sie ohne Be- nachrichtigung der Eltern festge- nommen und verprügelt worden.
Für wen wurde die Revolution eigentlich gemacht? „Wir kannten die Ajatollahs nicht", antwortet der Student fast wie entschuldigend, „die Revolution hat nichts gebracht, wir liegen jetzt 50 Jahre zurück. Das einzige, was sie bewirkt hat, ist, daß die Leute gezwungen wur- den zu überlegen, was eine miß- brauchte Religion mit der Freiheit und mit der Wirtschaft alles anstel- len kann." Die ältere Generation habe zwar die Jugend gewarnt, aber die Jungen hätten nicht zugehört. „Wir haben gelernt, aber es ist zu spät. Daß wir nicht nachdachten, hat die Jugendlichen das Leben gekostet."
Politische Gefangene sind rar geworden im heutigen Iran, weil es keine Widerstandskämpfer mehr gibt. „Jetzt werden noch Diebe, Mörder, Vergewaltiger hingerich- tet; auf schlimme Art. Menschen- rechte werden in unserem Land nicht respektiert. Es geht der Obrig- keit einfach darum, Ruhe zu haben, deswegen räumt man alles weg, was diese Ruhe stört. Daß sich jemand, wie das hier in Europa geschieht, Gedanken über einen Verbrecher macht, würde nur als unnötige Arbeit angesehen."
Junge Iraner verklären jetzt die Schah-Ära. Auch unser Gesprächs- partner sieht die Pahlevi-Zeit eher rosig und glaubt daran, daß der
Sohn des Schah eine politische Al- ternative zu den Mullahs sein könn- te. „Er ist dazu zweifellos fähig, weil er dafür ausgebildet wurde. Zudem wissen wir, woran wir bei ihm sind. Eine Gefahr sehe ich darin, daß er noch jung ist. Den Exilpoli- tiker Bani Sadr (der sich jetzt im Irak befindet, Anm.d.Red.) halten wir Wiener Studenten aus dem Iran, für nicht fähig, unser Land zu füh- ren. Der Sozialdemokrat Bachtiar wäre geeignet, wenn er sich davor hütete, alles Europäisch-Westliche den Iranern aufzupfropfen. Es geht bei uns um einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem Glauben der Menschen und den Erforder- nissen des modernen Lebens. Falsch wäre es, wie es der Schah versuch- te, aus dem Iran mit einemmal ein westliches Land zu machen. Wir brauchen langsame Veränderun- gen, die mittels politischer Ent- scheidungen herbeigeführt werden müssen."
Die Leute hätten seinerzeit nicht mitgekriegt, was der Schah wirk- lich gewollt habe. Warum sollten Mädchen plötzlich keinen Tscha- dor mehr tragen? Der Hauptgrund dieses Unverständnisses liegt für unseren Interviewpartner im An- alphabetentum seiner Landsleute. „Statt mit Freunden unterwegs zu sein, habe ich früher unentwegt Bücher aus aller Welt gelesen.
Deswegen waren mir die Ajatol- lahs immer suspekt. Irgendetwas in meinem Inneren sagte mir, das ist nichts Gutes. Das kam daher, weil ich - mittels der Bücher - meine eigenen Gedanken entdeckte. Ich sehe, wie hier in Europa die Leute sogar in der U-Bahn Bücher und Zeitungen lesen. Das gibt es bei uns nicht."
Iran soll wieder ein„lebendiges Land" werden, erwartet der junge Student und fügt hinzu, daß das kulturelle Leben, die traditionelle Gastfreundschaft, „Gott sei Dank" nicht tot seien. „Arme Leute sind immer bestrebt, dem Fremden alles zu bieten." Davon könnte sogar Österreich lernen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!