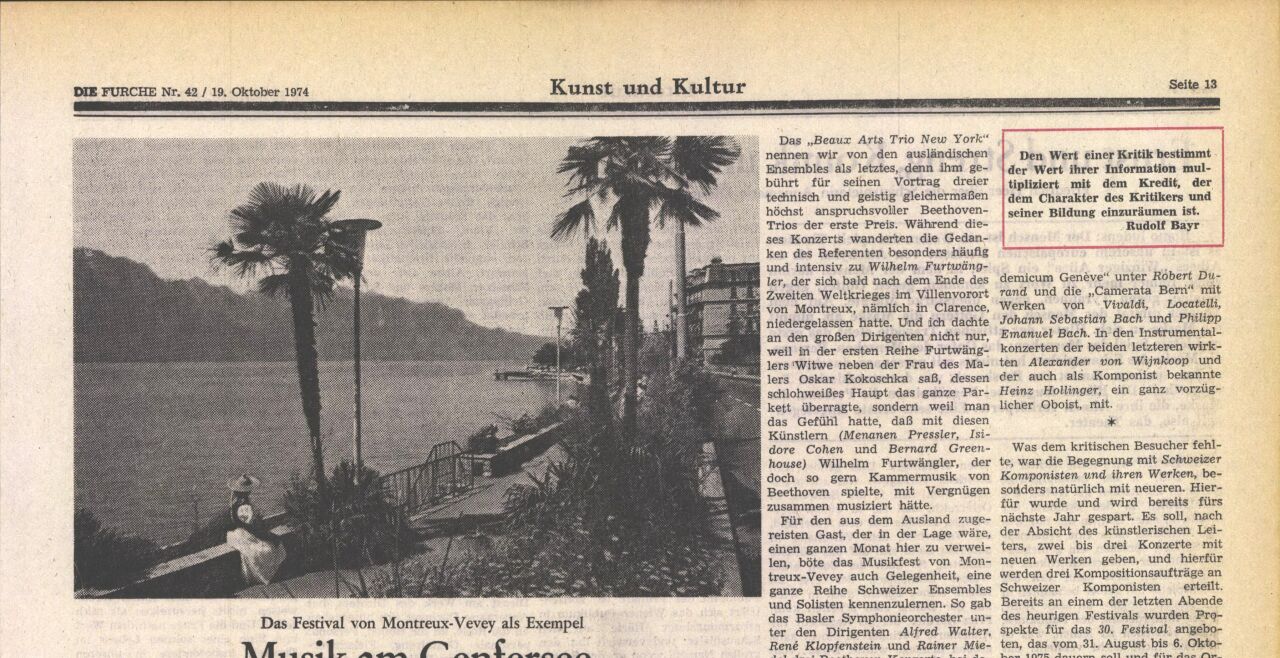
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kampf dem Lustspielklischee
Wie unter ein unausgesprochenes Motto gestellt, erschienen die ersten Premieren der neuen Grazer Saison, so als gälte es, mit allen Mitteln wirkliche oder vermutete Klischeevorstellungen im Zuschauer abzubauen und ihm zu zeigen, daß Lustspiele und Komödien eigentlich gar nicht lustig sind.
Zuerst kämpften Gert-Hagen Seebach als Regisseur und Christian Schieckel als sein Bühnengestalter ziemlich verbissen gegen die herkömmliche Auffassung, Büchners „Leonce und Lena” sei doch so etwas wie ein Lustspiel. Abgesehen davon, daß hier mit großem Eifer offene Türen eingerannt wurden — denn wer ist wirklich so naiv, Büchners Stück als Lustspiel herkömmlicher Art zu sehen —, bot das Werk den Interpreten ein weites Feld zur bildhaften Gestaltung existentieller Probleme. Zunächst einmal wurde Büchner, was ja nicht schwerfällt, in eine Linie mit Autoren wie Camus, Bernhard und Beckett gestellt. Damit waren aber auch schon die Grundpfeiler einer aktuellen szenischen Deutung errichtet: die Marionettenexistenz des Menschen — „Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen” (Danton) — und die fatale Lethargie eines sinnberaubten Daseins, das selbst in seinen freudvollen Sequenzen den Keim des Todes in sich trägt: „Die Erde hat sich ängstlich zu-sammengeschmiegt wie ein Kind, und über ihre Wiege schreiten die Gespenster.” In einer solchen Welt kann die etablierte Macht ja gar nicht anderes erscheinen denn als groteske Kamevalsmaske in einem kuriosen Land der Kinderspiele, durch das der Prinz Leonce geht und dabei versucht, die ganze Sinnlosigkeit Nes Daseins zu ertragen.
Das ist zweifellos ein gescheites Konzept, und seine Erfinder (zu denen als dramaturgischer Berater Gerhard Melzer zählt) haben es sich mit der Entschlüsselung des Stückes nicht leichtgemacht — so wenig leicht allerdings, daß beinahe schon wieder eine neue Verschlüsselung daraus wurde. Die einzelnen Szenen standen in ihrer ganzen Inkohärenz nebeneinander, ebenso isoliert wie die Figuren in der Eiseskälte des fast leeren Bühnenraumes. Indessen — der Mut der jungen Interpreten ist zwar zu loben, aber die totale Absenz eines Bühneninstinkts, der auch ans Publikum denkt, ist nicht zu tolerieren. In narzißhafter Haltung wurde da eine beinahe esoterische literarische Seminararbeit unter Verwendung endloser Pausen zelebriert. Die Zelebranten machten es sich allerdings zu leicht, wenn sie die negativen Reaktionen der Zuseher mit der typischen Haltung spießerischer Kulturkonsumenten erklären wollten…
Mit tiefem Ernst bemühte sich auch der Regisseur Jean-Paul Anderhub um ein wenigstens teilweise lustig sein wollendes Stück: Heinrich Lautensacks „Pfarrhauskomödie”, mit der seinerzeit die Schell nicht gerade rühmlich durch die Lande gezogen war, diente auf der Grazer Probenbühne als Beweis dafür, daß es ich doch nicht lohnt, den Autor Lautensack neu zu „entdecken”. Peinlicherweise ergab eine schwache, oberflächlich-konventionelle Inszenierung des dritten Lustspiels der Saison — „Das Konzert” von Hermann Bahr —, daß dieses Stück in einer so vergröbernden, nuancenlosen Wiedergabe gar nicht lustig, sondern nur ärgerlich ist.
Aber auch die Oper zog zu Felde geigen das Lustspielkidschee. Es geschah an Hand von Mozarts „Don Giovanni”, der als festliche Vorstellung zur 75-Jahr-Feier des Grazer Opernhauses über die Bühne ging. Der Dresdener Intendant Harry Kupfer begnügte sich nicht mit dem Gemeinplatz, daß das „dramma gio- coso” in d-Moll steht. Er entdeckte einen gewissermaßen sozialistischen Helden, dem die „der gesellschaftlichen Norm genügenden Partnerschaften zu klein” sind und der deshalb als Sprachrohr des Komponisten Mozart fungiert, der wiederum diese Oper als „schonungsloseste Abrechnung mit der spätfeudalen Welt” gemeint hatte…
Solch naive Eingleisigkeit tendenziöser Auslegung kommt hierzulande nicht gut an; um so weniger, wenn der szenische Anteil der Aufführung dadurch ein zwar lebendig bewegtes, aber inkonsequentes Bild ergibt. Eine derbere erotische Interpretation gibt allerdings dem Geschehen saftigen Realismus, doch das unschön zu- sammenigestoppelte Bühnenbild aus Barocktheater, El Greco und ein bißchen Carmen-Folklore (Wilfried
Werz, Berlin) störte erheblich. Für die szenischen Mängel wurde das Publikum jedoch in reichem Maße entschädigt durch die hohe Qualität der musikalischen Wiedergabe: Ernst Märzendorfer war es gelungen, das Orchester zu unerwarteter Höchstleistung an Präzision, Klangschönheit und Transparenz zu führen; seine Interpretation ist beispielgebend: kraftvolles Temperament und kammermusikalische Feinarbeit halten einander die Waage. Hervorragend der Don Giovanni von Claudio Nicolai und der Leporello des jungen Helmut Berger-Tuna.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































