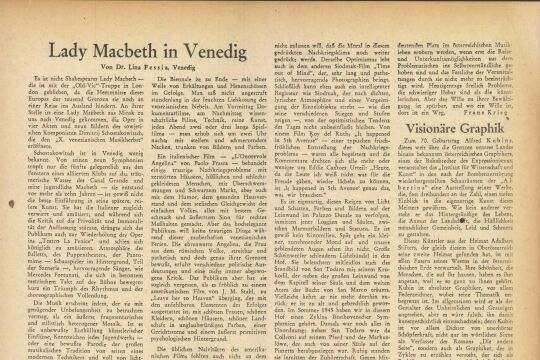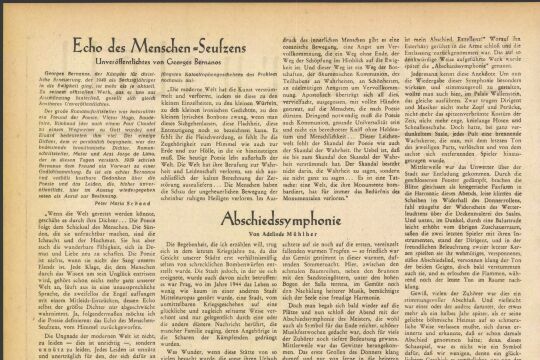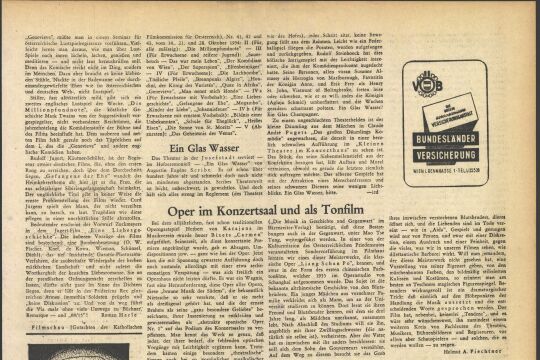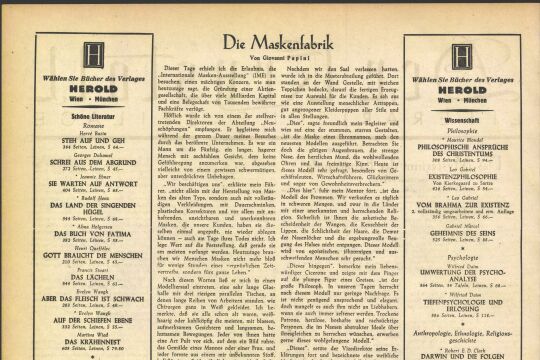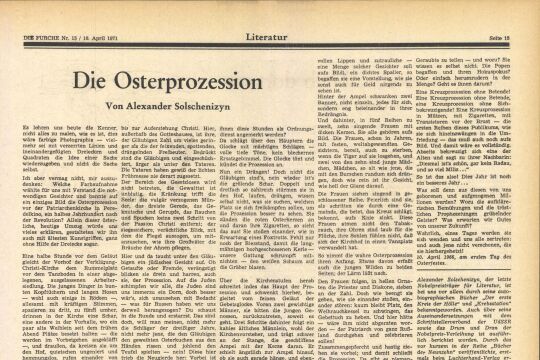Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mahabharata, Ramayana
Die ersten Zeugnisse indischer Tanzkunst sind die Skulpturen, die man an Hindu-Tempeln aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert entdeckt hat. Meist sind es Geschichten um den Gott Rama. Damit hat das im äußersten Südwesten Indiens, in Kerala an der Malabarküste, entstandene „Kathakali“ nicht unmittelbar zu tun, das aus dem Ritual der Tempeltänze entstanden ist und das so, wie wir es heute kennen, im 17. Jahrhundert begründet wurde. Früher kamen die Tänzer aus einer Kaste, der auch die Krieger angehörten, heute werden sie — bis vor kurzem ausschließlich Männer — in einer harten Tanzschule ausgebildet, deren physischen Anforderungen nur wenige gewachsen sind.
Die ersten Zeugnisse indischer Tanzkunst sind die Skulpturen, die man an Hindu-Tempeln aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert entdeckt hat. Meist sind es Geschichten um den Gott Rama. Damit hat das im äußersten Südwesten Indiens, in Kerala an der Malabarküste, entstandene „Kathakali“ nicht unmittelbar zu tun, das aus dem Ritual der Tempeltänze entstanden ist und das so, wie wir es heute kennen, im 17. Jahrhundert begründet wurde. Früher kamen die Tänzer aus einer Kaste, der auch die Krieger angehörten, heute werden sie — bis vor kurzem ausschließlich Männer — in einer harten Tanzschule ausgebildet, deren physischen Anforderungen nur wenige gewachsen sind.
Was sie im „Mahabharata“ vorführten, war, als Handlung, im großen und ganzen überschaubar, nicht zuletzt dank eines gesprochenen Kommentars (weitere, ins Detail gehende Aufschlüsse gab das Programmheft). Doch was diese streng stilisierten Gesten im einzelnen bedeuten, konnte der Laie — und das ist jeder, der sich mit indischer Tanzkunst nicht eingehend beschäftigt hat — nur ahnen. Denken konnte man sich dabei mancherlei. Aber ob es immer das Richtige war? Wir können über diese Darbietungen daher auch nicht urteilen, sondern nur unsere Eindrücke wiedergeben.
Da ist zunächst ein überaus prächtiges optisches Bild vor nachtdunklem Hintergrund, vermittelt durch die Kostüme und die grellbunten Bemalungen der Gesichter. Etwa ein Dutzend Tänzer — eigentlich Schauspieler, Pantomimen — traten bei „Mahabharata“ in Aktion, die Farben ihrer weiten prunkvollen Gewänder sind Weißrot und Gold. Die meisten Gesichter, mit blutroten Lippen und blauumschatteten Augen, sind grün geschminkt. Dieses grelle Schminken schafft Distanz zur Wirklichkeit, dadurch werden die Darsteller zu Helden und Göttern in den Augen des Publikums. (Die Prozedur des Schminkens dauert angeblich doppelt so lange wie die Aufführung, die ihrerseits fast drei Stunden in Anspruch nimmt.) — Gespielt wird barfuß, mit nur wenigen Requisiten, viele Szenen sind von statuarischer Ruhe, andere von unerwartet ausbrechender Wildheit.
Die Geschichte also: Die Pandavas und die Kauravas sind zwei Gruppen feindlicher, rivalisierender Vettern. Zur blutigen Auseinandersetzung kommt es wegen einer Frau, Draupati (ebenfalls von einem Mann gespielt), die vier Brüdern gemeinsam gehört und die von den Rivalen gezwungen wird, sich vor den Augen aller zu entkleiden. Aber das geschieht auf der Bühne nur sehr andeutungsweise, indem sie sich aus einem weißen Schal wickeln läßt, unter dem sich noch viele andere Bekleidungsstücke befinden. Zuweilen wird auch eine bunte Gardine hochgehoben, aber nicht, wenn etwa, im Laufe der epischen Aktion, zwei Feinde genußvoll abgeschlachtet werden.
Hier schlägt jenes Element von Wildheit durch, das gleich von allem Anfang an durch die Kostüme mit ihrem barbarischen Prunk, die mit Silberkrallen bewehrten linken Hände aller Krieger und die lautstarke, „harte“ Musik suggeriert wird.
Die Musik spielte eine wichtige Rolle: sie untermalt, begleitet, berichtet. Ausführende sind: zwei Trommler mit mittelgroßen, schmalen Geräten in Hoch- und Querformat, das erstere mit Schlägeln, das letztere mit den Fingern geschlagen, die in einer Art von Holzhandschuhen stecken. — Die beiden anderen Musiker bedienten einen kleinen Gong und winzige Becken — und sangen: nie zweistimmig, sondern abwechselnd. — Was sie produzieren, wirkt zunächst „monoton“ (und es gibt in der Tat einige ostinate Rhythmen), aber bald bemerkt man eine ganz außerordentliche Variabilität, eine Vielfalt, vor der sich die Polyrhythmiker der neuesten Musik sowie Boris Blacher mit seinen variablen Metren verstecken können. Diese Musik ist fest in einem uns fremden melodisch-tonalen System verwurzelt, in dem — anscheinend — nur die relative Tonhöhe von Bedeutung ist.
Faszinierend ist die Einheit, zuweilen auch die Ergänzung, von Instrumentalklang und Gesang sowie deren auf Bruchteile von Sekunden genaue Übereinstimmung mit den Aktionen auf der Bühne. Das allein schon ist faszinierend und läßt Schlüsse auf den hohen künstlerischen Rang der Truppe zu.
Mit seinem zweiten Programm brachte das Kathakali-Theater das uralte indische Epos „Ramayana“, und wer den ersten Abend besucht hatte, konnte jetzt leichter und mit größerem Vergnügen, allerdings auch mit noch größerem Respekt vor dieser Truppe und ihrer Kultur, den Darbietungen folgen. „Ramayana“ erzählt die recht komplizierte Geschichte von dem Königssohn Rama und seiner schönen Frau Sita, von den Verfolgungen des mächtigen Rama, der Sita für sich gewinnen will, aber von seiner Frau Mando-dari noch rechtzeitig zurückgeholt wird, so daß der „Herr der 14 Welten“ sich eine Blamage erspart und am Schluß zum König gekrönt werden kann. Diese letzte Szene ist überaus prunkvoll, es sind auch mehr Personen an ihr beteiligt, und hier mag eine Konzession an den Geschmack eines breiteren europäischen Publikums gemacht worden sein. Das ganze Stück aber zeigt die gleiche strenge Stilisierung, die überaus prächtigen Gewänder, die nur noch von dem grellbunten Kopfschmuck übertroffen werden.
Auch hier spielen die Akteure stumm, nur ab und zu stoßen sie heftige, unartikulierte Schreie aus. Ununterbrochen begleiten die Musikanten (auf der senkrechten Chenta-Trommel und der waagrechten Maddalam sowie die beiden Gong und kleine Becken schlagenden Sänger) die Handlung, aufs genaueste mit jeder ihrer Bewegung synchronisiert. — Einem neuen Element sind wir hier begegnet: dem Grotesken. Es dominiert in den Szenen mit dem Affenkönig.
Wiederum bewunderte man das Spiel und den Gesang der Musiker in ihren weißgoldenen, den ganzen Oberkörper freilassenden Saris, aber auch die Anmut des Tänzers, der, mit kompliziert-verfeinerter Gebärdensprache, die schöne Sita darstellte (die übrigens auch die passive Heldin der Novelle „Die vertauschten Köpfe“ von Thomas Mann ist). Bis dann zum letzten Male zwei Sarigeschmückte die bunte Gardine hoben — was das Ende der einzelnen Akte und der Aufführung anzeigt, die durch das Blasen des Muschelhornes und heftiges Trommeln eingeleitet worden war. •
Der zweite Abend verging uns.wie im Flug, und man kann sich vorstellen, daß man nach diesem Theater „süchtig“ werden könnte ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!