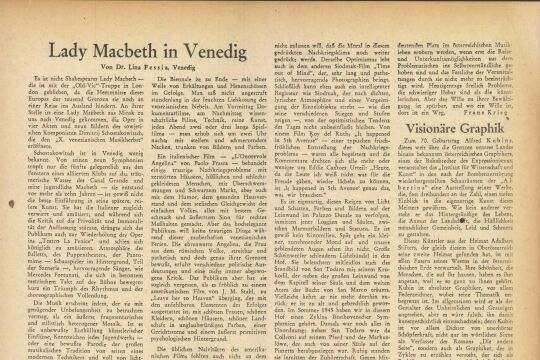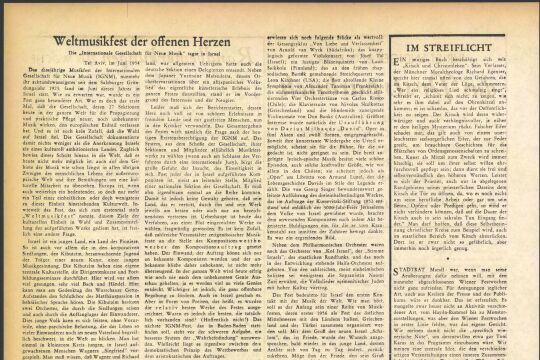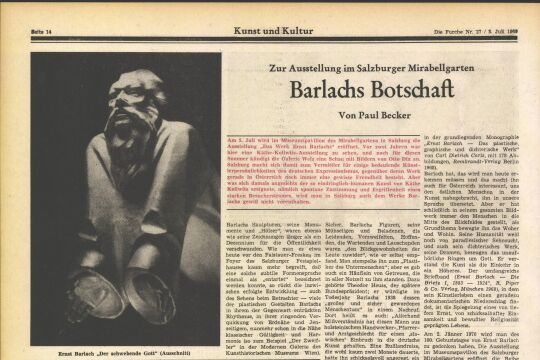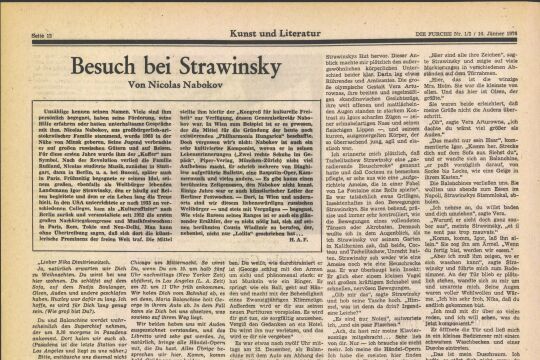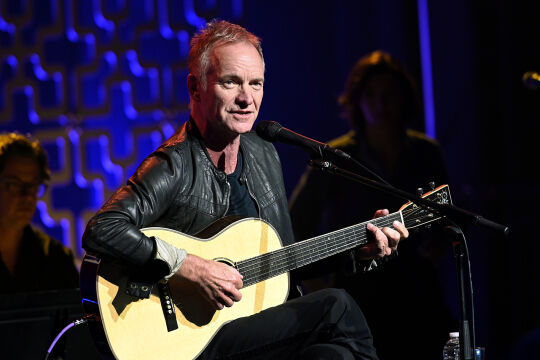Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mitternachtsbazar asiatischer Musik
Der Iran strebt politisch und wirtschaftlich nach dem Westen. Es bestehen bedeutsame Allianzen mit europäischen Wirtschaftspartnern; der Name Persien ist aus dem politischen Vokabular gestrichen. Das Kaiserreich bemüht sich aber auch um einen Platz im internationalen Festspielreigen. Hier ist das Wort „Persien” wieder zugkräftiger, weil es an das kulturelle Kapital gemahnt, das Erbe der Achämeniden, Parther und Sassaniden, an die Historie eines machtvollen Reichs unter Dareios, Xerxes, Artaxerxes. Kaiserin Farah Diba ist die moderne Schirmherrin der Künste; sie hat vor acht .Jahren das Festival of Arts in Shiraz und Persepolis ins Leben gerufen, bei dem sich Orient und Okzident künstlerisch die Hand reichen. Das Festspiel ist zunächst ein Instrument der Repräsentation, es zeugt vom Bemühen, gegenüber Europa aufzuholen, verschlingt viel Geld und hat in seiner jungen Tradition noch nicht die gewünschte Effektivität erreicht. Das konzeptionelle Experimentieren hält noch an.
Der Iran strebt politisch und wirtschaftlich nach dem Westen. Es bestehen bedeutsame Allianzen mit europäischen Wirtschaftspartnern; der Name Persien ist aus dem politischen Vokabular gestrichen. Das Kaiserreich bemüht sich aber auch um einen Platz im internationalen Festspielreigen. Hier ist das Wort „Persien” wieder zugkräftiger, weil es an das kulturelle Kapital gemahnt, das Erbe der Achämeniden, Parther und Sassaniden, an die Historie eines machtvollen Reichs unter Dareios, Xerxes, Artaxerxes. Kaiserin Farah Diba ist die moderne Schirmherrin der Künste; sie hat vor acht .Jahren das Festival of Arts in Shiraz und Persepolis ins Leben gerufen, bei dem sich Orient und Okzident künstlerisch die Hand reichen. Das Festspiel ist zunächst ein Instrument der Repräsentation, es zeugt vom Bemühen, gegenüber Europa aufzuholen, verschlingt viel Geld und hat in seiner jungen Tradition noch nicht die gewünschte Effektivität erreicht. Das konzeptionelle Experimentieren hält noch an.
Doch der Besucher, vom Rendezvous der großen Gesellschaft in Salzburg oder auf dem Festspielhügel in Bayreuth an Etikette, Smoking und Fliege gewöhnt, an Festspielpreise und an die in klingender Münze bezeugte Finanzkraft der High-Society, wundert sich dann doch, bei diesen kaiserlichen Spielen in Shiraz und Persepolis kein pluto- kratisches Festival anzutreffen. Dagegen wehren sich Landschaft und Klima sowie die Dezentralisation auf verschiedene Orte und Spielstätten, die Freilichtaufführungen unter nächtlichem Himmel. Und nicht zuletzt das Programm selbst. Der Film ist integriert. Es lief in diesem Jahr eine Bunuel-Retrospektive vom „Andalusischen Hund” bis zum „Diskreten Charme der Bourgeoisie”; etwas ganz Neues, vor allem für die persische Jugend, die hauptsächlich von der Begegnung mit dem Surrealismus fasziniert war. Das Cinėma Ariana in Shiraz hatte täglich drei vollbesetzte Vorstellungen. Einen Großteil des Publikums stell ten Studenten und junge Leute in Blue Jeans und T-Shirt.
Für den Europäer war die musikalische Seite des Programms besonders interessant Es wurde zum Mittemachtstoazar asiatischer Musik, vermittelte ein Kompendium, wie es hierzulande in dieser Vielfalt und Konzentration nicht zu hören ist. Die Konzerte fanden jeweils um 24 Uhr in einem Heiligtum von Shiraz statt: dem Garten des Hafis, wo sich auch sein Grabmal und eine kleine Bibliothek mit seinen Werken befindet. Zu dieser Stunde bot der mit Pechpfannen illuminierte Garten ein exotisch-phantastisches Bild, die Sitzplätze reichten meist nicht aus, um alle Besucher zu fassen. Klassische iranische Musik, indische Ragas, heitere Folklore aus Afghani- tan, religiös-mystische Musik aus dem sunnitischen Torbat-e Jam, virtuose Demonsträtion auf dem arabischen Ud (einer Kurz- bzw. Knickhalslaute mit bauchigem Corpus) oder Klänge aus Belutschistan wechselten einander ab und gaben ein imposantes Bild von der Vielfalt an Formen und Rhythmen in der asiatischen Musik, die man in unseren Breiten so gern undifferenziert als monoton in einen Topf wirftj
Im Orient fragt man nicht, was gespielt, sondern wie gespielt wurde. Der Künstler hat improvisatorische Freiheiten, muß die Technik der Verzierung und Ausformung beherrschen. Die Art des Spiels ist von der Intuition abhängig. Und der ausführende Musiker hat nicht das Ziel, verstanden oder gewürdigt zu werden, ist unbeeinflußt von der Meinung anderer — eine Praxis, die uns nicht immer begreiflich ist, aber letztlich beneidenswert erscheint. Die kunstvollste Musik war in dem gehörten Rahmen zweifellos die traditionelle persische. Sie ist heptato- nisch und kennt zwei musikalische Systeme: Dastgah und Avaz. Die sieben Modalsysteme des Dastgah sind die ursprünglichen, die fünf des Avaz die abgeleiteten, so daß die klassische Musik Persiens insgesamt zwölf Modi kennt.
Ein Modus des Dastgah oder Avaz wäre also in etwa zu vergleichen mit dem „Ton” im deutschen Meistergesang, dessen Funktion er zumindest erfüllt. Beim Konzert mit persischer Musik demonstrierten hochsensible Instrumentalisten die zwölf Systeme als eine äußerst farbenreiche und klanglich wie rhythmisch stark differenzierte Palette.
Ein anderes Phänomen offenbarte die indische Musik. Pandit Pran
Nath, einer der berühmtesten indischen Raga-Sänger, hatte es geschafft, innerhalb einer Stunde einen Teil des Publikums zum Gehen zu bewegen, die verbleibenden Hörer größtenteils aber einzuschläfern. Ein Raga (Hauptelement der indischen Musik) darf nach Auffassung der indischen Kunst nicht zu einer beliebigen Zeit gespielt oder gesungen werden. Jeder Raga ist mit einer Jahreszeit, einer Mondphase oder einer bestimmten Stunde am Tag verbunden, ist desgleichen an den Ort fixiert, und wenn gegen diese Regel verstoßen wird, folgt daraus nach indischer Ansicht eine Verwirrung der Atmosphäre und der menschlichen Seele. Als Pandit Pran Nath am Tag nach seinem Konzert auf dessen einschläfernde Wirkung hin angesprochen wurde, sprach er vorn „Yoga des Klangs”, bei dem der Spieler alles Körpergefühl verlieren könne, und er fügte hinzu: „Es war Mitternacht und Schlafenszeit. Die Leute haben geschlafen, Sie sehen also die Wirkung der Musik. Ich sang ein Raga, das Schlaf bringen soll und die Leute schliefen.” Wäpe es anders gewesen, hätte der Künstler versagt, und hätte er andere Ragas gesungen, wäre dies so unpassend gewesen wie ein Trauermarsch zur Hochzeitsfeier. Auf ähnliche Absichten können sich Interpreten der klassischen abendländischen Musik leider nicht hinausreden.
Europäische Musik gab es in mehreren Konzerten. Das Kammer orchester des Iranischen Rundfunks und Fernsehens spielte Werke von Schönberg, Xenakis und Mozart; die bei Festspielen offenbar groß ins Geschäft kommende London Sinfo- nietta huldigte im wesentlichen der Wiener Schule und machte Effekt durch eine eigenwillige Aufführung des „Pierrot lunaire”: Prallbehost in glänzender schwarzer Seide und auch sonst recht sexy, sang Mary Thomas die expressionistischen Texte von Giraud im Sinne eines Ausspruchs von Pierre Boulez, der das Werk ein „Cabaret supėrieur” genannt hat. In der Gestik hätte ihr ein Regisseur helfen sollen, ansonsten schien bei dieser Version der ketzerische Gedanke gar nicht so absurd, Schöntoerg könnte seinen „Pierrot” für Marlene Dietrich geschrieben haben.
In den Ruinen von Persepolis wurde einige Tage nach einer persischen Aufführung des „Caligula” von Camus die gespannt erwartete Produktion Ruth Escobars der „Autossacramentales” nach Calde- ron zu Schutt und Asche. Das Gastspiel in Victor Gardas Regie wurde ein kleiner Skandal: Nach sehr verspätetem Beginn erklärte Ruth Escobar dem Publikum, daß vorgesehen war, einige Schauspieler nackt auftreten zu lassen. In letzter Minute kam das Verbot - des persischen Kultusministeriums. Weil aber mit Zwangsbekleidung das Konzept nicht mehr stimmte, trat die Gruppe geschlossen in weißen Overalls auf und gab das portugiesisch gesprochene Stück der Verständnislosigkeit preis. Gardas Regie, die so etwas wie ein folkloristisches Mysterium beabsichtigt hatte, blieb unbegreiflich, so daß die ratlos in den Programmheften herumstochernden Zuschauer nur eine Überraschung erlebten: daß es plötzlich zu Ende war. Das Stück hätte anschließend in Berlin bei den Festwochen gespielt werden sollen. Doch der anwesende Berliner Festspielmanager lud die Gruppe an Ort und Stelle wieder aus, dasselbe tat die Leiterin des Festivals von Belgrad, und so war der Anfang dieser Tournee zugleich ihr Ende.
Die Skala der Aufführungen zwischen Shiraz und Persepolis war damit längst nicht erschöpft. Es gab ein Gastspiel der brasilianischen „Capoeiras of Bahia”, eine Gruppe, die nicht zu verwechseln ist mit den grassierenden Show-Unternehmen von „Brasil tropical” oder „Fiesta brasiliana”. Diese Capoeiras waren erst einmal in Europa (in Frankreich und Italien). Sie huldigen dem Mythos ihrer Vorfahren in Opferbräuchen, bei denen in den Ekstasen (es werden lebende Hühner zerbissen und das Blut auf Menschenopfer gegossen) etwas vom Kannibalismus nachklingt, der aus religiösen Motiven noch im 17. Jahrhundert auf Bahia geherrscht hat. Der Kanadier Bob Wilson zeigte unter dem Titel „A Mad Man” Aktionen mit einem geistesgestörten Jungen, ein etwas makabres Spiel, das indes die Absicht verfolgt, Verständnis zu wecken und solche Sorgenkinder weitgehend zu integrieren.
Die Vielfalt war groß, es taten sich die Kontraste zwischen Asien und Europa auf, und das Festival zeigte nicht nur seine Attraktionen, sondern mittelbar auch seine Probleme, die im Grunde auch die unseren sind: Wie bringt man die Kultur unters Volk? Nur mit dem Unterschied, daß es in Shiraz der kleine Mann leichter hat als bei Karajan und Strehler in Salzburg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!