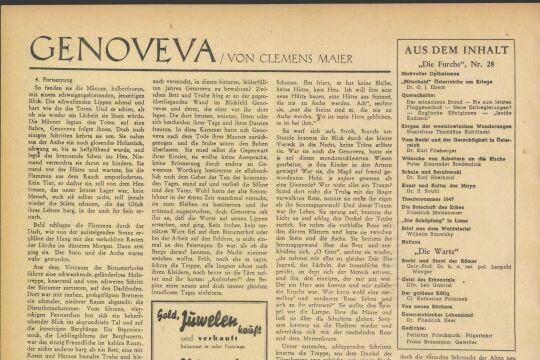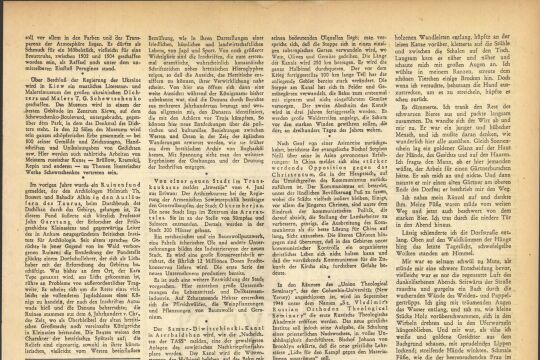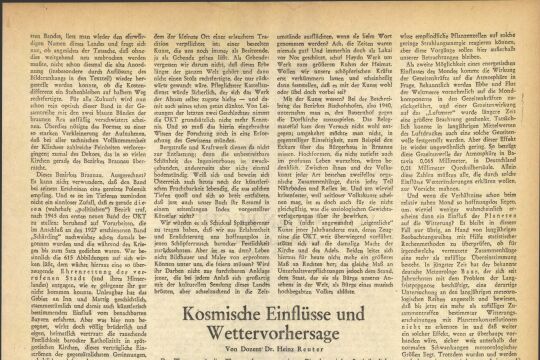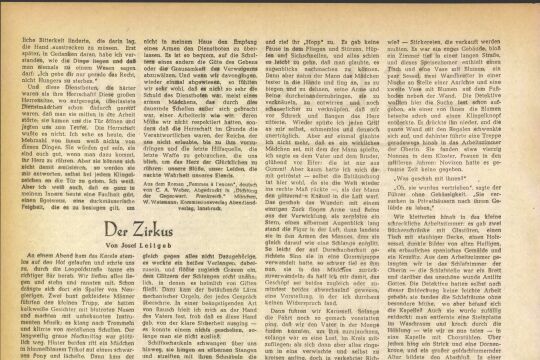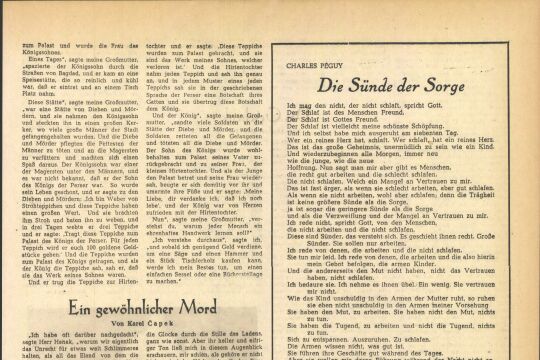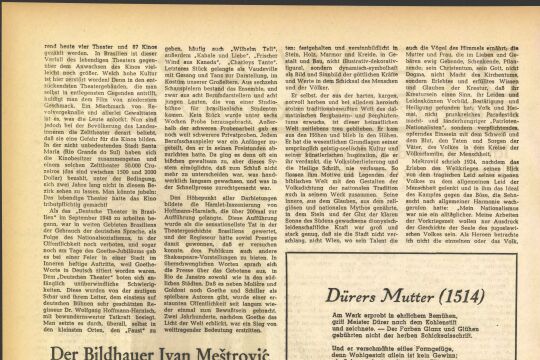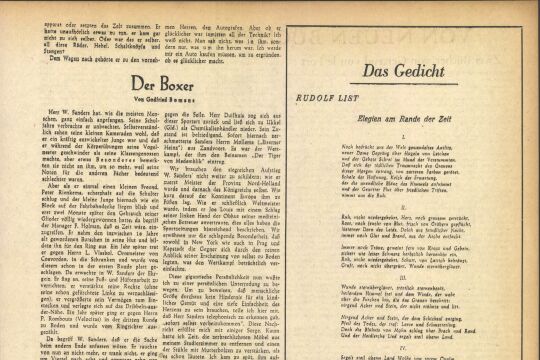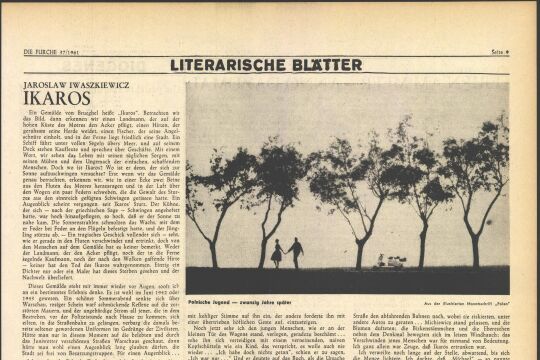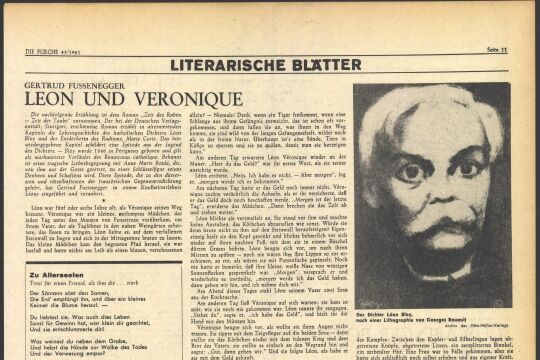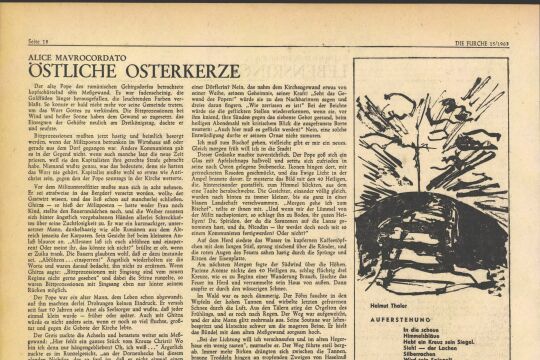Leon war fünf oder sechs Jahre alt, als Veronique seinen Weg kreuzte, Veronique war ein kleines zerlumptes Mädchen, das jeden Tag unter den Mauern von Fenestreau vorüberkam, um seinen Vater, der als Taglöhner in den nahen Weinbergen des reichen Bambou-eheur arbeitete, das Essen zu bringen. Leon liebte es, auf dem verfallenen Steinwall zu liegen upd sich in der Mittagssonne braten zu lassen. Das kleine Mädchen kam den begrasten Pfad herauf, sie war barfuß und hatte nichts am Leib als einen verschossenen blauen Leinenkittel. In der Hand trug sie einen Korb und in diesem Korb einen irdenen Topf, in dem die Suppe ihres Vaters schwappte. Leon sah sie kommen und vorübergehen. Ihr Haar war kupferfarben, über dem Nacken gescheitelt und hing ihr in einem Gewirr, das selten geflochten und nie gekämmt schien, zu beiden Seiten über die Schläfen herab. Ihr Kleid klaffte unter dem Hals offen bis fast zum Gürtel und ließ die milchweiße Haut unter einem sonnigen Schimmer weißblonder Härchen sehen.
Leon schaute ihr nach, wie sie den flachen Hügel erstieg, der das Gelände von Fenestreau von Bamboucheurs Weingärten schied. Ihre kleine Gestalt trat über den Hügelrand und schien schließlich vom Licht des mittäglichen Himmels verschluckt.
Die Kinder hatten noch kein Wort miteinander gewechselt. Sie tat, als habe sie Leon nicht einmal bemerkt. Aber eines Tages blieb sie unter seinem Liegeplatz stehen, hob die Augen zu ihm auf und lächelte ihn an.
„Du bist Leon“, sagte sie. „Ich heiße Veronique.“
Von nun an hielt sie sich immer bei ihm auf, wurde zutraulich, stellte den Korb ins Gras, kletterte den Steinwall hinauf, legte Arme und Kopf neben den Kopf und die Arme des Knaben und redete mit ihm.
Sie wußten einander nicht viel zu sagen: Leon erfuhr, wieviel Geschwister sie hatte, sie erfuhr, daß er im nächsten Jahr zur Schule gehen werde. Leon fing eine Eidechse und wollte, daß Veronique sie anfaßte. Veronique verbarg ihre Hand hinter dem Rücken und sagte: „Du willst bloß, daß sie mich beißt.“
So ging es eine Weile fort. Täglich wartete Leon, bis Veronique kam, er fragte sie auch, wann sie, wenn sie ihrem Vater das Essen gebracht habe, zurückkehre. Aber das wollte sie ihm nicht sagen, ihren Rückweg hüllte sie in ein Geheimnis.
Eines Tages — es ging schon dem Herbst zu — wußte Veronique etwas Aufregendes zu berichten: „In der Stadt ist Jahrmarkt Sie haben ein großes Zelt gebaut, dort zeigen sie Tiger und Schlangen, die Tiger müssen durch brennende Reifen springen, und die Schlangen sind zahm und tanzen.“
„Das gibt es doch nicht“, sagte Leon. „Du lügst.“
„Das gibt es aber doch“, sagte Veronique, „ich habe die Leute davon reden hören, ich möchte die springenden Tiger sehen und die zahmen Schlangen.“ Leon schwieg.
„Möchtest du sie nicht auch sehen?“ fragte Veronique. „Aber man muß einen Sou zahlen, damit man hinein darf.“
Als Leon nach Hause zurückkehrte, fragte er Tante Eugenie, ob man in der Stadt wirklich Tiger und Schlangen sehen könne. Gleich mischte sich Bruder Paul ins Gespräch. „Freilich“, sagte dieser, „seit vorgestern ist ein Zelt beim Turm von Vesone aufgebaut, es ist groß wie eine Kirche mit lauter Scharlach rings herum. Wer einen Sou bezahlt, darf hinein.“
„Ich möchte hingehen, Tante Eugenie“, sagte Leon, „ich möchte auch die Tiger sehen.“
Tante Eugenie war gutherzig, dann und wann steckte sie den Neffen ein paar Centimes zu, damit sie sich Bärendreck oder türkischen Honig kaufen könnten. Doch: einen ganzen Sou, nur um die Bestien zu sehen, das war zuviel. „Nein, Leon“, sagte sie, „wenn du sie sehen willst, dann wollen deine Brüder auch, Paul, George und Marc — macht mit dir vier Sous. Nein, keinesfalls, der Vater würde es auch nicht erlauben.“
Also versuchte Leon sein Glück bei der Mutter. Sie aber zeigte sich ängstlich: „Allein zum Zirkus — ihr Kinder — niemals, niemals. Denk, wenn ein Tiger freikommt oder wenn eine Schlange aus dem Gefängnis flieht, das ist schon oft geschehen, und dann fallen sie an, was ihnen in den Weg kommt, sie sind wild von der langen Gefangenschaft, wilder noch als in der freien Natur; es ist ja wohl überhaupt eine Sünde, die Tiere in Käfige zu sperren, nur, damit man sie herzeigen und anschauen kann.“
Am anderen Tag erwartete Leon Veronique wieder an der Mauer. „Hast du das Geld?“ war ihr erstes Wort, als sie seiner ansichtig wurde.
Leon errötete. „Nein, ich habe es nicht, aber morgen“, log er, „morgen werde ich es bekommen.“
Am nächsten Tag hatte er das Geld noch immer nicht. Veronique zuckte verächtlich die Achseln, als er ihr versicherte, morgen werde er die zwei Sous bestimmt erhalten haben. „Morgen ist der letzte Tag“, sagte sie, „dann brechen sie das Zelt ab und ziehen weiter.“
Der Knabe blickte sie verzweifelt an. Sie stand vor ihm und machte keine Anstalten, das Körbchen abzustellen wie sonst. Würde sie heute nicht zu ihm auf den Steinwall hinaufsteigen? Eigensinnig hielt sie den Kopf gesenkt und blickte beharrlich vor sich nieder auf ihren nackten Fuß, mit dem sie in einem Büschel dürren Grases bohrte. Leon beugte sich vor, um ihr Gesicht zu sehen: Noch nie waren ihm ihre Lippen so'rot erschienen, so rot, als wären sie mit Purpurfarbe gepinselt.
Am Abend dieses Tages stahl Leon seinem Vater zwei Sous aus der Rocktasche.
Am anderen Mittag ließ Veronique auf sich warten, sie kam so spät, wie sie noch nie gekommen war. Leon rannte ihr entgegen. „Siehst du“,sagte er, „ich habe das Geld!“ Und er hielt ihr die Hand mit den Münzen hin.
Veronique beugte sich vor, als wollte sie ihren Augen nicht trauen. Sie tippte mit dem Zeigefinger auf die beiden Sous, dann stellte sie das Körbehen nieder mit dem irdenen Krug und dem Brot des Vaters, sie stellte es einfach an den Wegrand hin und sagte: „Gut, dann gehen wir.“ Und sie folgte Leon, als habe er sie mit dem Geld gekauft.
Niemand wußte nachher zu sagen, wie es geschehen war und woran es eigentlich gelegen hatte, denn die Leute, die zu der Zeit im Zelt gewesen, und der letzten Fütterung beigewohnt hatten, zerstreuten sich sehr rasch, vielleicht, weil sie sich schämten, daß sie sich durch ein Nichts so sehr hatten erschrecken lassen, vielleicht auch, weil sie sich fürchteten, zur Verantwortung gezogen zu werden. Denn, obgleich man das Kind erst später fand, mußte sich doch in den meisten die Empfindung festgehakt haben, daß während der plötzlichen Panik in dem rasenden Gedränge irgendein Unglück geschehen sei.
Die Tierwärter beteuerten, daß sie keine Schuld trügen, daß alles wie immer gewesen sei, wenn man die Leute in den Teil des Zeltes einließ, in dem die Fütterung stattfand. Die Gitter waren nach vorne geschlossen und eine Schränke trennte, wie vorgeschrieben, Beschauer und Käfige. Wie immer, hatten die Wärter die Leute ermahnt, die Barriere nicht zu übersteigen oder gar die Hand zu den Bestien hinein-zustrecken.
Man habe, gaben sie zu, die Tiere ein wenig gereizt, das sei nun einmal Brauch, die Leute wollen ja etwas für ihr Geld, sehen, sie kamen ja her, um ein Schauspiel zu haben; i|.an mußte die faulen Katzen aus ihrer Ruhe. scheuchen und die Schlangen veranlassen, um ihre Nahrung zu kämpfen.
Doch das war, wie gesagt, Brauch, und niemand hatte bislang etwas dabei gefunden.
Das Unglück war, daß die Kette der großen Petroleumlampe riß, die vor der Barriere an einer eisernen Stange hing. Hatte sie jemand in Schwingung versetzt oder gar an ihr gezerrt? Die Lampe schlug herunter, und in das Klirren und Splittern und in die jäh eintretende Dunkelheit erscholl das Gebrüll des großen Tigers Jussuf.
Im Kampf um den Ausgang war eine Frau niedergestoßen und eine der roten Tuchportieren abgerissen und sogar der Tisch mit der Kasse umgestürzt worden, so daß die ganze Tageslosung in den Staub rollte. Nachher fand man auf dem Platz die Spuren des Kampfes: Zwischen den Kupfer- und Silbermünzen lagen abgerissene Knöpfe, abgetretene Litzen und Röcksäume, ein zersplittertes Binocle und ein zerbeulter Hut. Das kleine Mädchen fand man erst später unter einer umgestürzten Bank, platt auf dem Boden liegend, regungslos.
Es ist Nacht geworden in Perigueux, und die Straßen sind fremd, und die Häuser sind fremd, alles ist fremd für das Kind, das herumirrt und nicht weiß, wohin.
Irgendwo ist Fenestreau, sind Vater, Mutter, die gute Tante Eugenie, irgendwo ist das weiße weiche Bett im Winkel, die kleinen Brüder, Wärme, Sattheit und Schlaf.
Hier ist Nichts, schreckliches Nichts, leere, grausig leere finstere Gassen. Die Häuser stehen hinter den verriegelten Läden stumm und feindlich und wie versiegelt.
Eine Gasse hinter der anderen, und der eigene stolpernde, rennende Schritt hallt schrecklich laut durch das finstere Labyrinth. Das Kind denkt: Wo bin ich? Ist das Perigueux? Hier bin ich noch nie gewesen, hier nicht und auch hier nicht, Großvater und Großmutter wohnen in einer anderen Stadt. Im Käfig brüllen die Tiere, sie schlagen mit ihren Tatzen, sie springen gegen die Stäbe, sie kommen frei. Veronique haben sie verschlungen, mich werden sie verschlingen, sie kommen mir nach.
Niemand ist auf der Gasse, die Menschen haben sich in ihre Häuser geflüchtet, haben die Türen hinter sich versperrt und die Lichter gelöscht, damit die Tiere nicht wissen, wo sie wohnen. Die Menschen stehen hinter den Fenstern und spähen durch die Spalten, spähen, ob sie schon kommen, die' Tiger, die Affen, die Schlangen, die hinter mir her sind, hinter mir — hinter mir, dort duckt sich der Tiger zum Sprung.
Und niemand wird mir auftun, wenn er heran ist.
Das Kind keucht eine Gasse hinauf, eine Gasse hinab, es setzt um die Ecken, es rennt im Kreis, eine Treppe hinauf, einen Graben entlang. Da, mit einem Male wird es hell, die Häuser treten auseinander, ein großer Platz liegt vor ihm, aus leichten Wolkenschleiern tritt der Mond und überschwemmt den Raum mit seinem zarten Licht. Dort, in der Mitte des Platzes erhebt sich groß und feierlich ein Riesenbau mit Türmen, Kuppeln, breiten Treppen: der Dom. Das Kind erkennt: hier bin ich schon einmal gewesen.
Hier war es — irgendwann, die Mutter trug mich. Ich saß auf ihrem Arm, die Arme dicht um ihren Hals, ich spürte ihr Gesicht. Sie trug mich dort hinüber und hinein.
Etwas Süßes, Kühles wehte mir entgegen, es kam aus dem offenen Tor, eine tönende Woge, ein wogender Duft, ein duftender wogender Wind. „Horch, die Orgel“, sagte die Mutter, und der duftende wogende Wind trug mich und sie die Stufen empor. Dort stellte sie mich nieder und tauchte ihre Hand in Wasser und berührte mit dem befeuchteten Finger meine Stirn, meinen Mund, meine Brust.
Die Tiere sind vergessen, hinten geblieben, von der schwarzen, bösen, stinkenden Stadt verschluckt. Hier ist nur Mondlicht — rings um den Dom ein silberschuppiges Flimmern, das weite gepflasterte Rund, über dem tausend Lichtzungen raunen. Das Kind sieht seinen eigenen Schatten wandern, er wandert geradewegs zum Tor von Saint Front hinauf.
Ach, jetzt erkennt es das in die Wand versenkte Portal, die Bogen, die Giebel, die Nischen, und auf zwei steinernen Löwen stehen zwei Säulen auf und tragen ein hohes, mit funkelnden Spitzen besetztes Dach.
Der Knabe bleibt stehen und schaut hinauf. Irgend etwas durchschaudert ihn, süßer und zarter noch als damals, als die Mutter ihn trug und die Orgel erbrauste. Er sieht: ein großes Auge tut sich über ihm auf.
Das Auge ist tief wie die Welt und schaurig schön wie die gestirnte Nacht, und unter seiner Braue haust das Herrliche: ein Mann sitzt auf einem Thron, hält ein Kreuz dm Arm und in der Hand eine Waage.
Könige sind sein Gefolge, Engel seine Trabanten, alle Nischen sind von ihnen erfüllt; einer steht auf des anderen Schultern, wie Trauben drängen sie aus dem Gewände, wie ein ungeheurer steinerner Rebstock rankt sich ihr Chor um das Bild des Gerichts.
Die Löwen unten, die die Säulen tragen, wie liegen sie friedlich mit gekreuzten Tatzen, weiß und glänzend, glattgeschliffener Marmor, die Locken der Mähnen zu schönen Ringen gelegt. Sie scheinen zu lächeln, ihre Mäuler klaffen, furchtlos schiebt Leon seine Hand zwischen ihr Gebiß.