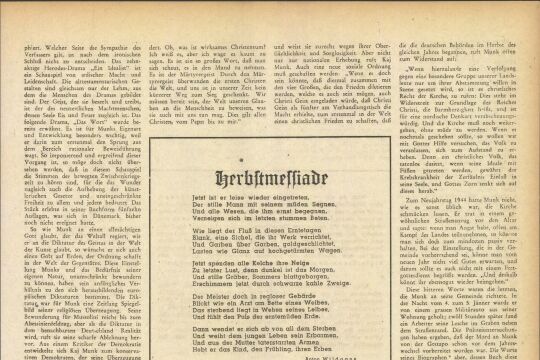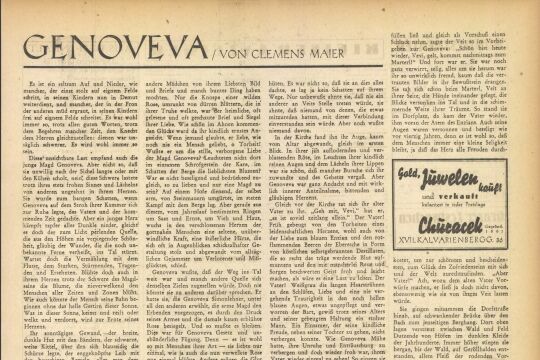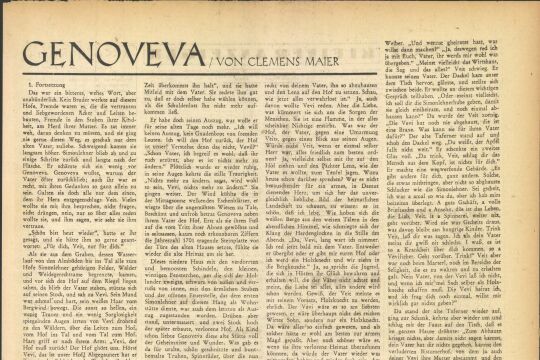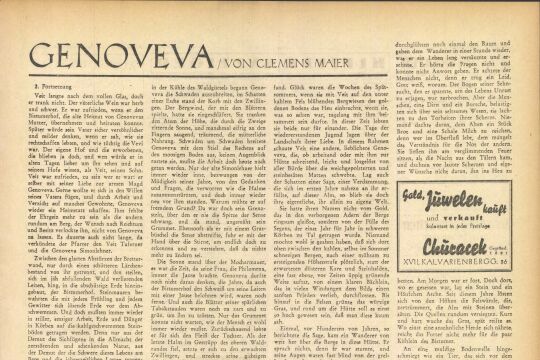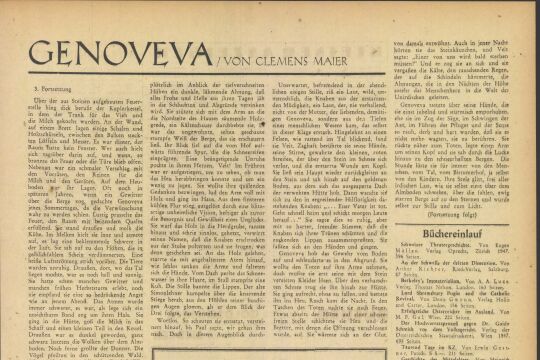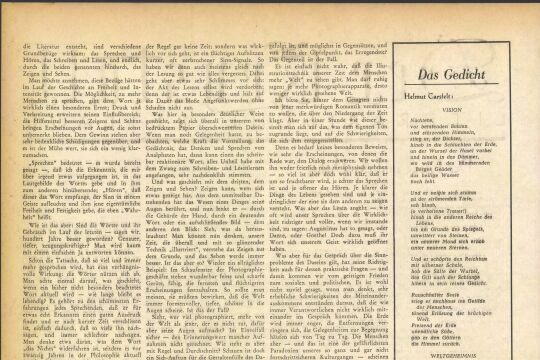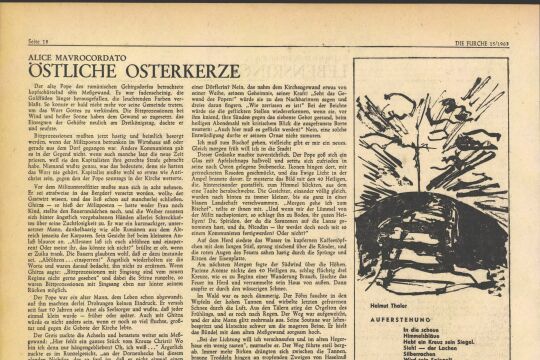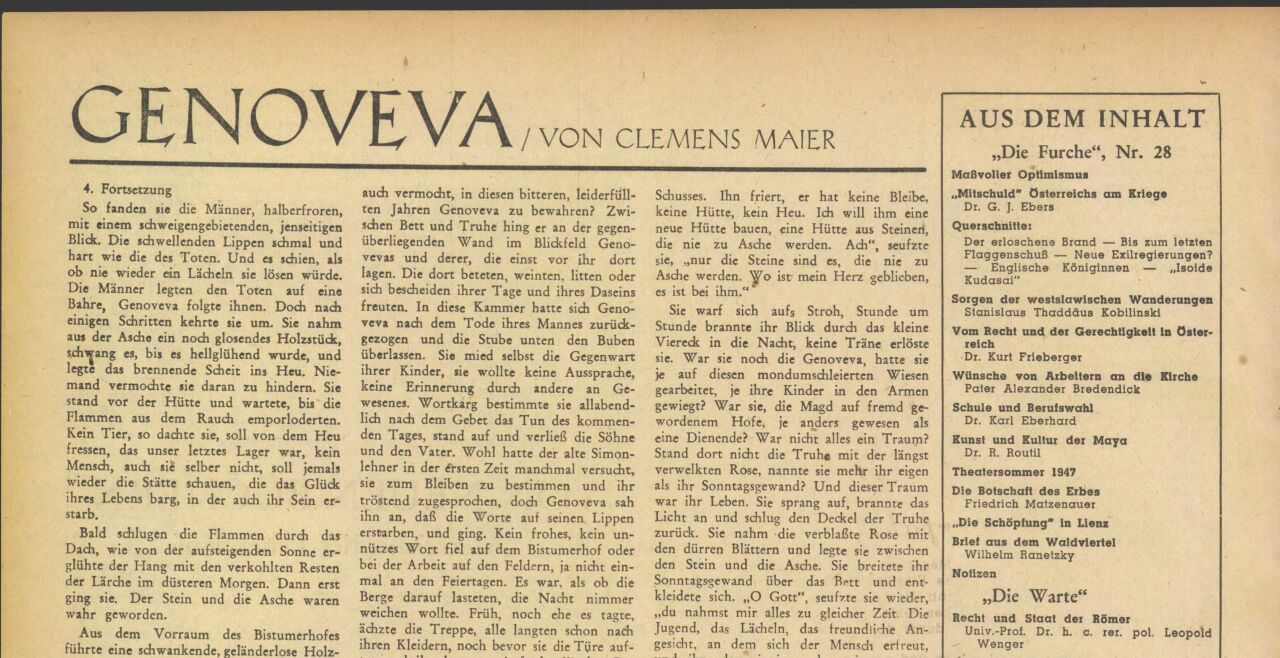
So fanden sie die Männer, halberfroren, mit einem schweigengebietenden, jenseitigen Blick. Die schwellenden Lippen schmal und hart wie die des Toten. Und es schien, als ob nie wieder ein Lächeln sie lösen würde. Die Männer legten den Toten auf eine Bahre, Genoveva folgte ihnen. Doch nach einigen Schritten kehrte sie um. Sie nahm aus der Asche ein noch glosendes Holzstück, schwang es, bis es hellglühend wurde, und legte das brennende Scheit ins Heu. Niemand vermochte sie daran zu hindern. Sie stand vor der Hütte und wartete, bis die Flammen aus dem Rauch emporloderten. Kein Tier, so dachte sie, soll von dem Heu fressen, das unser letztes Lager war, kein Mensch, auch sie selber nicht, soll jemals wieder die Stätte schauen, die das Glück ihres Lebens barg, in der auch ihr Sein erstarb.
Bald schlugen die Flammen durch das Dach, wie von der aufsteigenden Sonne erglühte der Hang mit den verkohlten Resten der Lärche im düsteren Morgen. Dann erst ging sie. Der Stein und die Asche waren wahr geworden.
Aus dem Vorraum des Bistumerhofes führte eine schwankende, geländerlose Holztreppe, knarrend und vom schweren Schritt der Bistumer zertreten, auf den Dachboden. Dort war mit rauhen, grobgefügten Brettern ein schmaler, niederer Raum abgeteilt: die Dienstbotenkammer. Vom kleinen, viereckigen Fensterchen bot sich ein beherrschender Blick ins abgrundtiefe Tal und auf die jenseitigen Berghänge. Ein Begonienstock, die Lieblingsblume der Bergbauern, war das einzig Freundliche im kahlen Raum, der nichts anderes barg als ein Bett, eine mit Rosen und Herzen bemalte Truhe und hie-hergehörig wie in keinem Dom und in keinem, nur der Sitte halber errichteten Herrgottswinkel einen alten, rußgeschwärzten Christus mit der Dornenkrone um das sterbende Haupt. Wer auch als Christus wäre fähig gewesen, den jeweiligen Bewohnern dieses Raumes die Demut und die Kraft zum Ertragen ihres Loses zu geben? Und wer von all den Menschen hätte es auch vermocht, in diesen bitteren, leiderfüllten Jahren Genoveva zu bewahren? Zwischen Bett und Truhe hing er an der gegenüberliegenden Wand im Blickfeld Genovevas und derer, die einst vor ihr dort lagen. Die dort beteten, weinten, litten oder sich bescheiden ihrer Tage und ihres Daseins freuten. In diese Kammer hatte sich Genoveva nach dem Tode ihres Mannes zurückgezogen und die Stube unten den Buben überlassen. Sie mied selbst die Gegenwart ihrer Kinder, sie wollte keine Aussprache, keine Erinnerung durch andere an Gewesenes. Wortkarg bestimmte sie allabendlich nach dem Gebet das Tun des kommenden Tages, stand auf und verließ die Söhne und den Vater. Wohl hatte der alte Simon-lehner in der ersten Zeit manchmal versucht, sie zum Bleiben zu bestimmen und ihr tröstend zugesprochen, doch Genoveva sah ihn an, daß die Worte auf seinen Lippen erstarben, und ging. Kein frohes, kein unnützes Wort fiel auf dem Bistumerhof oder bei der Arbeit auf den Feldern, ja nicht einmal an den Feiertagen. Es war, als ob die Berge darauf lasteten, die Nacht nimmer weichen wollte. Früh, noch ehe es tagte, ächzte die Treppe, alle langten schon nach ihren Kleidern, noch bevor sie die Türe auftat und ihr hartes: „Aufstehen!“ den Beginn eines neuen und doch immer gleichen freudlosen Tages einleitete.
Nur einmal, es war wieder um Maria Lichtmeß, nach einem milden, schneearmen Winter, vermißten sie zur gewohnten Zeit den Schritt über die Stiege. Selbst als die Sonne schon hochstand, kam sie noch immer nicht. Die Brüder warteten beunruhigt und sagten zum alten Vater: „Geht nachschauen, Vater.“ Der Alte nahm seinen Stock und trat zur Treppe, er blieb stehen, lauschte, kam wieder zurück. „Geht ihr“, sagte er, „ich geh so schwer über die Stiege.“ „Geh du Paul“, „geh du Peter“, ermunterten die Brüder einander, keiner wollte gehen. Sie hatten Angst, sosehr waren sie gewohnt, nichts zu tun, was gegen den Willen der Mutter gehen konnte. Aber als sie auch um Mittag nicht kam, stiegen alle drei empor und Paul drückte mutig die Türe auf. Das Bett war leer, die Mutter nicht da. Verwundert sahen sie sich an. Niemand hatte gehört oder gesehen, daß sie wegging. An diesem Tage lastete das Unheil doppelt auf ihnen, keine Arbeit wollte gelingen. Und sie fühlten, wie sie ihr alle trotz ihrer Härte in Sorge und Liebe zugetan waren. Erst als Peter, der mit dem Ochsen Holz herunterstreifte, berichtete, er habe eine Schneespur gegen den goldenen Boden gesehen, und Paul die anderen erinnerte, daß vor vier Jahren der Vater verunglückte, wurden sie ruhiger. Gegen Abend kam Genoveva zurück. Sie überzeugte sich von der getanen Arbeit, gab die Anordnungen für den nächsten Tag und ging, ohne zu essen, in ihre Kammer.
Aus ihrem Kopftuch nahm sie eine Handvoll verkohlter Asche und einen Stein, der vom Felsen, an dem sich Veit erschlug, abgebröckelt war. Beides legte sie auf das Wandbrett zu Füßen des Gekreuzigten. „Mit den Steinen“, sagte sie zu Christus gewendet, „habe ich seit je gerungen. Ich las sie, für jeden Halm einen, von den Äckern und Feldern, davon zeugen die Steinmauern, wohin man sieht. Und was ist unser Leben, unsere Liebe, der bescheidene Bau unserer Hoffnungen: Asche! So will ich, wenn ich dich sehe, zu dir bete, auch den Stein und die Asche sehen. Du verlangst mehr vom Menschen, als er zu tragen vermag. Der Lohn für ein demütiges Herz ist geringer als der Löhn einer Magd. Ich war bei ihm. Ich habe ihn gesehen. Auf dem goldenen Boden lebt er, wenn die Einsamkeit lautlos ihre Flügel über die Weite spannt und die Sonne sich zur Neige wendet. Niemand kann ihn sehen als ich, denn niemand weiß die Stunde. Er jagt auf Schneehühner, ich hörte das Echo seines Schusses. Ihn friert, er hat keine Bleibe, keine Hütte, kein Heu. Ich will ihm eine neue Hütte bauen, eine Hütte aus Steinen, die nie zu Asche werden. Ach“, seufzte sie, „nur die Steine sind es, die nie zu Asche werden. Wo ist mein Herz geblieben, es ist bei ihm.“
Sie warf sich aufs Stroh, Stunde um Stunde brannte ihr Blick durch das kleine Viereck in die Nacht, keine Träne erlöste sie. War sie noch die Genoveva, hatte sie je auf diesen mondumschleierten Wiesen gearbeitet, je ihre Kinder in den Armen gewiegt? War sie, die Magd auf fremd gewordenem Hofe, je anders gewesen als eine Dienende? War nicht alles ein Traum? Stand dort nicht die Truhe mit der längst verwelkten Rose, nannte sie mehr ihr eigen als ihr Sonntagsgewand? Und dieser Traum war ihr Leben. Sie sprang auf, brannte das Licht an und schlug den Deckel der Truhe zurück. Sie nahm die verblaßte Rose mit den dürren Blättern und legte sie zwischen den Stein und die Asche. Sie breitete ihr Sonntagsgewand über das Bett und entkleidete sich. „O Gott“, seufzte sie wieder, „du nahmst mir alles zu gleicher Zeit. Die Jugend, das Lächeln, das freundliche Angesicht, an dem sich der Mensch erfreut, und ihn, den einzigen, der mir gut war. Der ein Herr sein konnte und mir zuliebe ein Knecht war. Wer kann wohl eine verwelkte und verdorrte Rose lieben und sich an ihr erfreuen?“ Sie stellte den Spiegel vor die Lampe, löste die Haare und ließ sie über die Schultern gleiten. Sorgsam knotete sie die Flechten wieder und schmückte sich mit der raschelnden Rose und dem Myrtenkranz.
Unter tastenden, schleppenden Schritten knarrte die Treppe, aus dem Dunkel des Türrahmens trat gebückt, auf seinen Stock gestützt, ihr Vater.
„Vevi“, sagte er gebietend und strafend wie zu einem Kinde, „was tust du?“ Sie wandte sich ab und gab keine Antwort. Der alte Simonlehner humpelte näher, schloß die Truhe und setzte sich darauf. Er stieß mit dem Stock zu Boden: „So geht das nicht weiter. Neben dir müssen wir alle zugrunde gehen. Du bist närrisch geworden. Auch andere Leute trifft manches Unglück. Sie ertragen es, oft schon der Kinder wegen und bleiben Menschen, aber du bist ein Unmensch geworden. Wo soll das hinführen. Denk .an die Kinder, nicht immer nur an den Veit. Sie leben und er ist tot. Wie du.“ Da wandte sich Genoveva zornflammend um: „Er ist nicht tot, er lebt, was wißt ihr. Ich habe ihn gesehen, oben, im goldenen Boden. Kümmere dich nidit um mich, kümmere dich um deinen Schnaps und um deinen Hof und geh! Geh zum Lenz in deinen Auszug, hier rede ich und tue ich, wie ich will. Du hast den Schmerz um die MutAr in Branntwein ertränkt und abgehaust, ich ertränke mein Leid in Liebe und hause auf. Was wißt ihr von Liebe, ihr Taglöhner ums Brot, das euch alles ist.“
Der alte Vater neigte sich immer tiefer über seinen Stock. Alles Blut wich aus seinem Gesicht. „Vevi“, bittend, brüchig klang seine Stimme, „komm doch zu dir. Die Kinder, wir alle sind wach geworden, als wir dich hörten, es ist so unheimlich im Hause. Vevi, versündige dich nicht.“ „Ich bin bei mir“, herrschte sie ihn an, „geh, ich will dich auf meinem Hofe nicht mehr sehen, du willst wohl, daß ich den Veit vergessen soll.“ Und sie riß die Türe auf, durch die der Alte wortlos hinausschlurfte.
Genoveva aber tat ihre besten Kleider an, trat hinaus auf den mondüberfluteten Gang und lächelte — es war das erste Lächeln seit Veits Tode — hinauf zum goldenen Boden. Sie weitete die Arme und flüsterte mit verhaltener Stimme: „Veit, ich komme.“
Am nächsten Morgen ging der alte Simonlehner, begleitet, von Peter, der seine Habe trug und ihn über den vereisten Graben hinüber auf den benachbarten Hof führte, ohne Abschied von Genoveva wieder heim. Der Lenz, dem der Taferner schon lange den Hof übereignet hatte, empfing ihn unfreundlich als unnützen Esser und zum Hof gehörige Last. Nur das Barbele, seine Tochter, hatte für beide ein Lächeln und ein Willkommen. Sie brachte ihm auch gleich seine Milch und ein Brot, räumte die Stube auf und sorgte für Wärme. Peter half ihr dabei und es mochte wohl nicht zum erstenmal sein, daß sie sich verlegen und zugetan gegenüberstanden. Steht doch die veraschte Sehnsudit der Alten neu aufflammend im Antlitz der Jungen und nidns mag ewiger sein als diese Flamme.
„Gelt, Barbele“, bat Peter beim Weggehen, „schaust ein wenig auf den Vater.“ Barbele versprach es und meinte, „magst wohl selber auch öfter herüberkommen zum Vater“. Und während der Alte, zusammengesunken, verfallen und vergrämt sich auf die Ofenbank setzte und wieder zum hilflosen Kinde geworden ein Gebet buchstabierte, schritt der Junge, eine noch ferne Sonne im Herzen, beschenkt mit einem verheißungsvollen Blick, selbstbewußt heimwärts. Aber im Anblick des Bistumerhofes wurde er wieder zum gehorsamen Knaben -ohne eigenen Willen, und ihm bangte vor der kommenden Zeit, in der er die ausgleichende väterliche Freundlichkeit des liebgewordenen Alten vermissen wird.