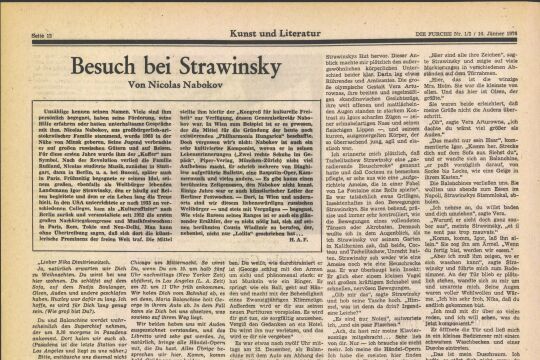Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Teuflisches
An drei Abenden gastierte während der vergangenen Woche das Ensemble der Stuttgarter Oper mit Pendereckis „Die Teufel von Loudun“ im Großen Haus am Ring. Günther Bennert führte. Regie, Janos Kulka stand am Pult und Leni Bauer-Ecsy hatte die Bühnenbilder und Kostüme entworfen. Was wir zu sehen und zu hören bekamen, war eine imposante Ensembleleistung nach einem wohldurchdachten Regiekonzept, waren hervorragende Leistungen zahlreicher Solisten, eines mit allen Schwierigkeiten zeitgenössischer Musik vertrauten Chores und Orchesters sowie eine bewundernswerte Bühnentechnik. — Aber das Stück, das man für dieses Millionen verschlingende Gastspiel ausgesucht hat?
An drei Abenden gastierte während der vergangenen Woche das Ensemble der Stuttgarter Oper mit Pendereckis „Die Teufel von Loudun“ im Großen Haus am Ring. Günther Bennert führte. Regie, Janos Kulka stand am Pult und Leni Bauer-Ecsy hatte die Bühnenbilder und Kostüme entworfen. Was wir zu sehen und zu hören bekamen, war eine imposante Ensembleleistung nach einem wohldurchdachten Regiekonzept, waren hervorragende Leistungen zahlreicher Solisten, eines mit allen Schwierigkeiten zeitgenössischer Musik vertrauten Chores und Orchesters sowie eine bewundernswerte Bühnentechnik. — Aber das Stück, das man für dieses Millionen verschlingende Gastspiel ausgesucht hat?
In dem 1626 gegründeten Ursuli-nenkloster Loudun im Departement Vienne soll es in den Jahren 1634 und 1635 zu einer Reihe von Fällen „dämonischer Besessenheit“ gekommen sein, die mit einem Hexenprozeß beendet wurden. Angeklagter und Opfer war der Priester und Pfarrer Urbain Grandier, der, nach vorhergegangener Folterung, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Als Gegner Richelieus geriet der Libertin Grandier, der nachweislich das Kloster der Ursulinerinnen nie betreten und keine seiner Insassinnen auch nur angerührt hat, in die staatliche Maschinerie, und die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen kamen dem königlichen Kommissionär Lauberdemont sehr gelegen...
In diese trübe Geschichte leuchtete erstmals Aldous Huxley mit einem Roman, John Whiting schrieb ein Theaterstück mit dem Titel „The Devils“, und bald kam auch ein Film. Nach diesen Vorlagen hat sich Krzysztof Penderecki das Libretto selbst geschrieben. 1969 wurde die Oper in Hamburg uraufgeführt und zwei Jahre später, im Rahmen des Steirischen Herbstes, in Graz gespielt. (Die Stuttgarter Produktion ist angeblich die weitaus beste und stärkste.)
Erstaunlich, wie sich Penderecki gleich in diesem seinem ersten Bühnenwerk als Dramatiker bewährt. Um so erstaunlicher, da seine Chor-und Orchesterkompositionen immer ein wenig amorph klingen. Hier versteht er es, zu gliedern und, wenn nicht die einzelnen Gestalten, so doch die einzelnen Szenen klanglich zu profilieren (es sind etwa 30 Kurzszenen, die in drei Akten zusammengefaßt wurden). Der Charakter und die Eigenart dieser Musik ist von seinen anderen Kompositionen nicht wesentlich verschieden: Er macht immer wieder, indem er die extremen Lagen und die verschiedenen Klangmöglichkeiten der Instrumente ausnützt, gleichsam elektronische Musik mit unseren konventionellen Orchesterinstrumenten, wobei er, wie uns das Programmheft belehrt, „mit unseren lieben alten Notenköpfen nicht mehr auskommt“ (wenn man sich so vorstellt, was mit diesen lieben alten Notenköpfen alles geschrieben wurde, kommt man unwillkürlich auf den Gedanken, daß nur ein Dummkopf so einen Satz niederzuschreiben vermochte).
Wie es vor allem Schönberg und spätere Zeitgenossen vorgeäfft haben, wird die menschliche Stimme nicht nur zum Singen und Sprechen, sondern auch auf jede andere Art eingesetzt: bis zum fast tonlosen Flüstern und lauten Heulen. Das Erstaunliche ist, daß es auch ab und zu etwas zum Singen gibt. Mit der gleichen Fertigkeit behandelt er die Chöre, und sicher isit das alles viel leichter zu hören, als auszuführen.
Denn die Ansprüche, die Penderecki an den musikalisch empfindenden und zum formalen Mitdenken erzogenen Hörer stellt, sind sehr gering. Das ist ebenso wie bei einer etwas aufdringlichen Filmmusik. Wie die Stuttgarter Sänger und Musiker mit allen diesen Schwierigkeiten unter der Leitung des sehr versierten Dirigenten Janos Kulka fertigwurden, war bewunderungswürdig. Ebenso große schauspielerische wie sängerische Leistungen boten Carlos Alexander und Colette Lorand, Heinz Cramer, Gustav Grefe und noch manche andere. Eine unerwartet brillante Koloratur ließ Ursula Koszut als Mädchen Philipe hören, die, nachdem sie gebeichtet hat, von dem Priester in den Beichtstuhl hineingezogen wird.
Und damit wären wir bei der Handlung, der krudesten und abPressestelle des Bundestheaterverbandes
stoßendsten, die wir je auf einer Opernbühne gesehen haben. Auch wenn, was in dieser Oper dargestellt wird, auf Fakten basiert, so gehören diese doch in die geschichtliche Intimsphäre des Menschengeschlechts. Und es ist ein Unterschied, ob man solche Phänomene in einem Buch kritisch analysiert und meinetwegen auch in Romanform darstellt
—oder ob man sie auf die Bühne eines Opernhauses bringt. Außer sich geratene Nonnen (Huxley spricht vom „furor uterinus“), die scharenweise eine hohe Treppe herunterrutschen und sich dabei die Kleider
—in diesem Fall die Ordensgewänder — vom Leib reißen; grob naturalistisch ausgespielte Folterszenen, denen das Kahlscheren und Nägelausreißen vorangegangen ist; die genüßlich vorbereitete und breit augespielte Verbrennung des Priesters Grandier: daß dies alles nur demonstriert wird, um gegen jede Art von Gewalt, speziell gegen Hitler und Stalin, zu protestieren — das mögen die Autoren, wie immer sie heißen, ihren Großmüttern erzählen. Hier geht es um krudeste Sensationen, und der Effekt war eine Art Pornographie des Grauens. So haben es jedenfalls viele Besucher dieser Aufführung empfunden.
Und wir haben allen Grund, Penderecki zu mißtrauen. In seinem Werkverzeichnis finden sich zwar „Psalmen Davids“ (1959), ein „Sta-bat Mater“ für drei Chöre (1963), ein „Dies Irae“ und die bekannte „Lukaspassion“ von 1966. Aber bereits damals erklärte Penderecki in einem Interview, daß für ihn der Text nur eine Art von „matiere sonore“ sei und daß er mit dem vorösterlichen Geschehen lediglich folkloristische Vorstellungen und Kindheitserinnerungen verbinde. (Also wenigstens etwas.) Nehmen wir zu seinen Gunsten an, daß er mit dieser Oper nicht seine Rückkehr nach Polen vorbereiten wollte. Den Machthabern wird sie allenfalls sehr willkommen sein. Aber dem Publikum von Krakau, Warschau oder Kattowitz? Vielleicht findet man dort dieses Stück ebenso abstoßend wie wir hier.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!