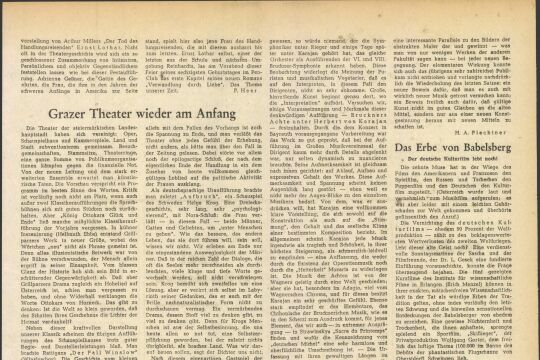Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Fall Penderecki
Krzysztof Penderecki, 1933 im ostgalizischen Debica geboren und in Krakau ausgebildet, hat sich — ohne seine polnische Heimat und sein Haus in Krakau aufzugeben — für einige Zeit in Wien niedergelassen. Nach einigen frühen experimentellen, typischen Musikfestival-Kompositionen, schrieb er die abendfüllende „Lukaspassion“, die durch zahlreiche öffentliche Aufführungen, Rundfunksendungen und Schallplatten in kurzer Zeit sehr populär wurde.
Krzysztof Penderecki, 1933 im ostgalizischen Debica geboren und in Krakau ausgebildet, hat sich — ohne seine polnische Heimat und sein Haus in Krakau aufzugeben — für einige Zeit in Wien niedergelassen. Nach einigen frühen experimentellen, typischen Musikfestival-Kompositionen, schrieb er die abendfüllende „Lukaspassion“, die durch zahlreiche öffentliche Aufführungen, Rundfunksendungen und Schallplatten in kurzer Zeit sehr populär wurde.
Was wir am vergangenen Dienstag im Großen Konzerthaussaal hörten, war als „Slawische Messe“ angekündigt und im Abendprogramm als zweiteiliges Oratorium gekennzeichnet: „Grablegung Christi“
(Slawisches Requiem) und „Auferstehung“. Seit 1965 hat Penderecki an diesen beiden Partituren gearbeitet, deren erstere im vorigen Jahr im Dom zu Altenberg, die zweite vor kurzem im Dom zu Münster urauf- geführt wurde. Als nächstes soll ein Oratorium über das „Jüngste Gericht“ folgen. Zur gleichen Zeit erklärt Penderecki jedem, der es hören will, und auch solchen, die ihn nicht darnach gefragt haben, daß er weder praktizierender Katholik noch „gläubig“ sei.
Gehört er also vielleicht zu jenen, von denen die vor kurzem verstorbene Ida Friederike Görres in einem ihrer letzten Aufsätze sagte: „Sie finden im Christemtum einiges recht brauchbare Material zu ihrem Unternehmen, neben einem Riesenhaufen Ballast — nach ihrer Meinung. Sie gehen mit hemmungsloser Tatkraft und hoher Intelligenz daran, das eine zu behauen und umzuschmelzen, das andere zu liquidieren.“
Sieht und hört man sich an, wie Penderecki mit der orthodoxen (das heißt: strenggläubigen) Karfreitag- und Osterliturgie umspringt und wie er bedenkenlos Formen, besser gesagt Stücke, der byzantinischen Hymnologie montierend verwendet, so kann das Urteil über Penderecki nur in die angedeutete Richtung gehen. — Doch Penderecki ist Künstler, Musiker. Was sagt ims seine Musik?
Nach der Wiener Erstaufführung der „Dukaspassion“ vor einem Jahr äußerte der Autor dieses Berichts, das sei „Musik für Unmusikalische“. Er ist in die Aufführung des neuen Doppeloratoriums hineingegangen mit dem guten, ja dem besten Willen, sich von Penderecki überzeugen, eines Besseren belehren zu lassen. Aber Pendereckis Manierismus, seine Willkür, seine Formlosigkeit, der amorphe Charakter seiner Musik haben sich noch verstärkt Eineinhalb Stunden lang hört man kaum einen natürlichen Ton. Anstatt Klänge produziert er — mit der größten Virtuosität, das sei zugegeben — fast nur noch Geräusche der manigfachsten Art. Zwei gemischte Chöre, ein Knabenchor und vier Solisten, werden eineinhalb Stunden lang fast ununterbrochen mißbraucht, das heißt statt zum Singen zum Sprechen, Flüstern und Schreien angehalten. Wobei für In- strumentalisten wie Sänger, im gesamten 240 Mann, häufig Glissandi vorgeschrieben sind, die besonders „häßlich“ wirken.
Mit diesem Adjektiv ist Vorsicht geboten, wir wissen es. Denn fast alle neuartige-kühne Musik wurde bei ihrem ersten Erklingen so empfunden — und dreißig oder fünfzig Jahre später hörte es sich dann „plötzlich“ ganz anders an. — Die fast „wörtlich“ übernommenen Kirchengesänge, wie sie die byzantinische Hymnologie entwickelt hat, wirken wie Oasen, machen das Ganze aber nur noch ärgerlicher. Sie stehen nicht nur völlig beziehungslos in dieser vielschichtigen (und trotzdem auf weite Strecken monotonen) Partitur herum, sondern machen auch den enormen Abstand deutlich zwischen einer echten religiösen Musik und Pendereckis schwülstig-nebulösem Tongemälde. Ein Gegenspiel: Strawinskys „Psalmensymphonie“ braucht weder den Vergleich mit der Gregorianik noch mit Bach zu scheuen.
Wollte man genauer differenzieren, so könnte man sagen, daß die ruhigere „Grablegung“ mehr erträgliche Stellen enthält, als der stürmisch-laute, auf lange Strecken leerlaufende zweite Teil. — Als Sprache bedient sich Penderecki eines adaptierten Altbulgarisch, das leider völlig unverständlich bleiben mußte.
Das lag bestimmt nicht an den Chören des WDR-Köln, des ORF und der Sängerknaben, auch nicht an dem hervorragenden Solistenquintett. Und daß der Orchesterpart nicht „schöner“ klang, war weder Schuld des ORF-Symphonieorche- sters noch des dirigierenden Pende- recki-Spezialisten Andrzej Markow- ski. Das zahlreich erschienene Publikum aplaudierte allem und allen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!