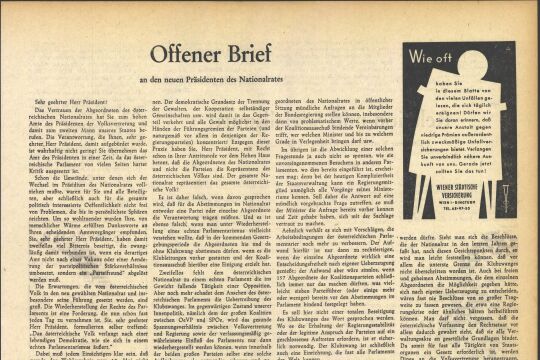Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verspielte Gelegenheit
War wirklich alles vergeblich, wie es die ersten Kommentare — resignierend oder hämisch — wahrhaben wollten? War wirklich „außer Spesen nichts gewesen“, als sich letzte Woche die Studenten aus der Hochschulreformkommission zurückzogen und damit die Bemühungen von 27 Sitzungen in dreieinhalb Jahren gescheitert schienen? Bedurfte es tatsächlich nur noch des Gnadenstoßes, um eine längst ineffektiv gewordene Einrichtung endgültig dahin zu befördern, wohin sie längst gehört hätte — in die Liquidation?
Zweifellos, die Lust der beteiligten Professoren, Assistenten und Studenten, der Politiker und Beamten und nicht zuletzt jene der Vorsitzenden Ministerin an den Sitzungen und Diskussionen der Hochschulreformkommission war seit langem auf dem Gefrierpunkt angelangt. Weder endlose Grundsatzdebatten noch DetaUformulierun-gen einzelner Ausdrücke in zahllosen Paragraphen und schon gar nicht Polemiken und Gegenpolemiken konnten dazu beitragen, über das Pflichtgefühl, über das Bewußtsein von der Notwendigkeit, zu Ende zu diskutieren, hinaus jenes Mindestmaß an Eigendynamik zu erzeugen, das einfach notwendig ist, um Aufgaben dieser Größenordnung und dieser Schwierigkeitsgrade zu bewältigen.
Trotzdem — vergleicht man die Ausgangslage im Sommer 1968, noch kein Jahr nach den Berliner Unruhen, mit dem Status quo von 1972, die Lage in Österreich mit jener in der Bundesrepublik, so erscheint auch die Leistung der Hochschulreformkommission in einem andern Licht. Die Einsetzung von Studienkommissionen — drittelparitätisch — zunächst an den technischen Hochschulen, dann schrittweise auch bei den andern, war absolut nicht der einzige wichtige Beschluß. Auch wenn man vorsichtig sein muß, ihre Erfahrungen in einer Erprobungsphase zu verallgemeinern, so denkt doch niemand daran, sie wieder abschaffen zu wollen. Es wurden wichtige Entscheidungen über Struktur, Zuständigkeiten, Laufbahn des Mittelbaus getroffen — Entscheidungen, die am Beginn des Gesprächs kaum möglich schienen.
Das Wichtigste aber war der Lernprozeß, der in allen beteiligten Gruppen vor sich ging, in Gruppen, die die Technik demokratischer Verhandlungen ebenso erst trainieren mußten wie die Bereitschaft, die Argumente der Gegenseite anzuhören, ernst zu nehmen, z,u reflektieren — und auch auf eine harte Ausdrucksweise nicht mit Uberempfind-lichkeit zu reagieren.
Warum aber dann die Unlust, die dann schließlich zum offenbar unvermeidlichen Eklat führte? Der Kern des Übels lag eben nicht in der Unfähigkeit, „sich selbst am Zopf aus dem Sumpf zu ziehen“, wie ein Sprecher in der letzten Fernseh-disktission bedauerte, sondern in der Illusion des Auftraggebers — des Bundesrates — und der interessierten, aber im Detail uninformierten Öffentlichkeit, daß es gelingen würde, die Aufgabe des Jahrhunderts in diesem Gremium innerhalb eines Jahres lösen zu können. Das Übel lag darin, daß niemand von denen, die drängten — hier haben die Zeitungen ein wesentliches Maß an Mitschuld! — zur Kenntnis nehmen wollte, was Prof. Topitsch in derselben TV-Diskussion in anderem Zusammenhang feststellte — daß der Wissenschaftler „Zeit, Zeit und nochmals Zeit“ brauchte, zum Forschen ebenso wie zur Reform seiner Universität. Die Grundrechtskommission verhandelt seit sieben, die Strafrechtskommission seit rund 15- Jahren — warum will man der Wissenschaft nicht zugestehen, was für die Justiz richtig sein soll?
Die Strafrechtskommission hatte schon Minister Piffl als Vorbild gedient, als er 1965 seinen Bat für Hochschulfragen einberief — auch hier schon Professoren, Assistenten, Studenten, Beamte und Politiker kooperativ vereint, aber damals eben ad personam ernannt, nicht delegiert, nicht paritätisch zusammengesetzt, sondern lediglich nach dem Gesichtspunkt, optimal zum gemeinsamen Werk beitragen zu können: Das Ergebnis war das Allgemeine Hochschulstudiengesetz, das vom Parlament einstimmig verabschiedet wurde und den großen Vorsprung der österreichischen Hochschulreform bedeutete.
Die „Gruppenstatik“ in der Hochschulreformkommission, die Abhängigkeit der Delegierten von der Zustimmung ihrer Verbände in einer Zeit aufgeheizter Standesinteressen und ideologisierter Argumentation mußte die weitere Diskussion erschweren, wenn schon nicht unmöglich machen. Daß trotzdem — siehe oben — einiges erreicht worden ist, spricht für das echte Bemühen aller Beteiligten — auch der Studenten, die sich gerade nicht als „gelehrige Schüler der Genossen in der Bundesrepublik“ erwiesen haben, wie es ein Kommentator meinte.
Daß unter diesen Umständen früher oder später der Tag kommen mußte, an dem man sich festgefahren sah, war klar. Eine erste Krise überwand Minister Piffl im Frühjahr 1969, als er von der Diskussion über das Institut auf die Personalstruktur umschaltete, eine zweite Minister Firnberg, als sie mit ihrem Entwurf zu einem neuen Universitätsorgani-sationsgesetz der Kommission eine konkrete Verhandlungsunterlage gab. Dazwischen hatte Minister Mock die Studienkommission über die Bühne gebracht. Nach dem Exodus der Professoren im Vorjahr konnte der Riß nochmals gekittet werden. Diesmal ist er endgültig. Die letzte Hoffnung, wenigstens in großen Zügen gemeinsam die Grundsätze für die Organisation der Universität festzulegen, hat sich nicht erfüllt.
Trotzdem wird — das dürfte doch sicher sein — diese Organisation weder einem rein etatistischen Konzept noch dem einer einzelnen Gruppe entsprechen. Dazu konnte doch in vielen Punkten ein gewisser Konsens gefunden werden. Das hat auch die Resse rileiterin eindeutig zu verstehen gegeben. Trotzdem ist es schade, daß die Gelegenheit nicht voll ausgenützt wurde, zum ersten Mal in der Geschichte der österreichischen Universität ihre Neugestaltung von ihren Mitgliedern her bestimmen zu lassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!