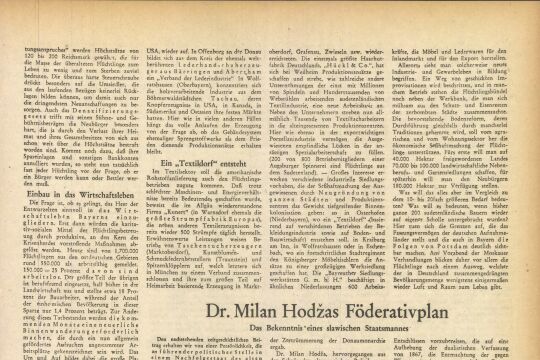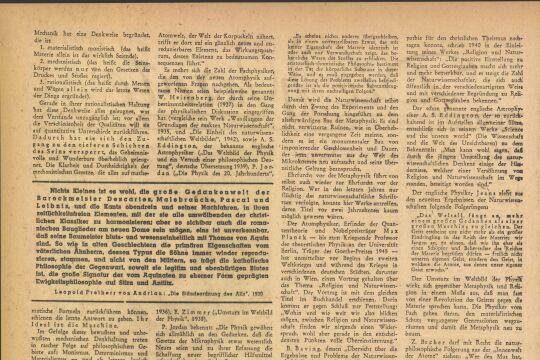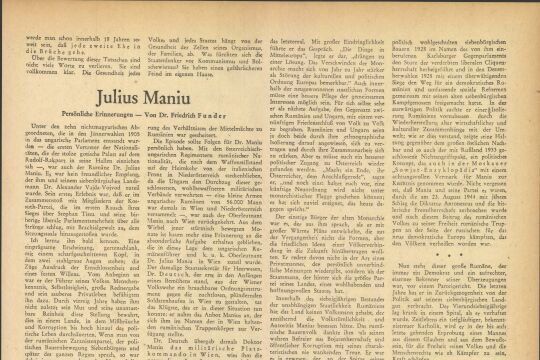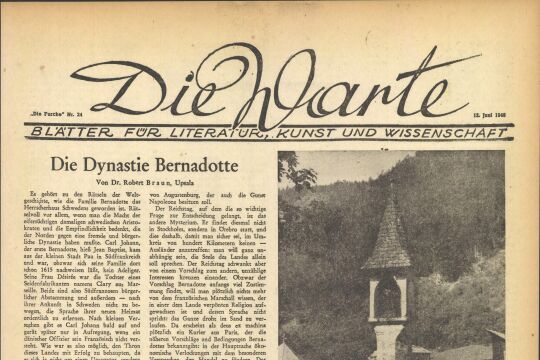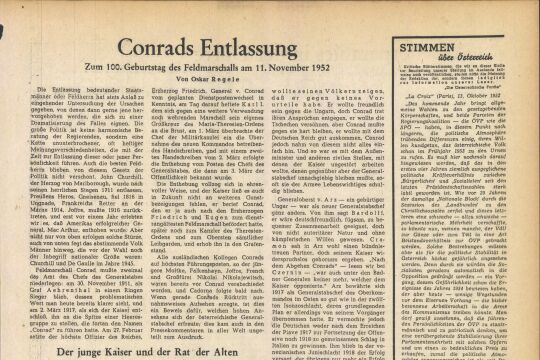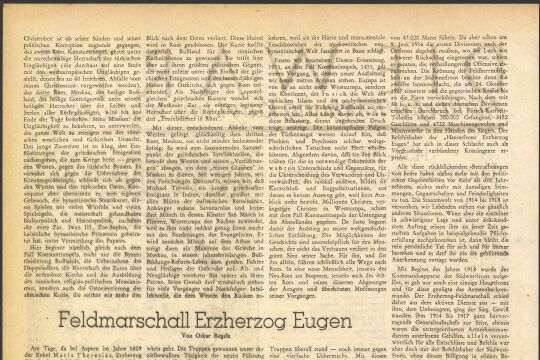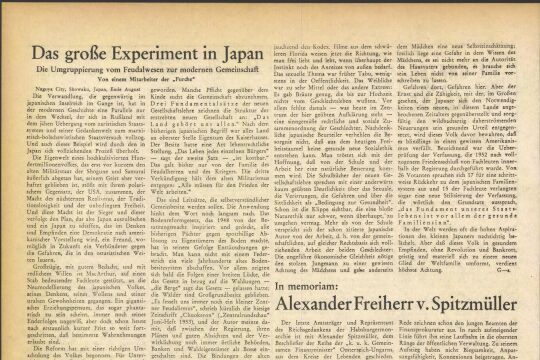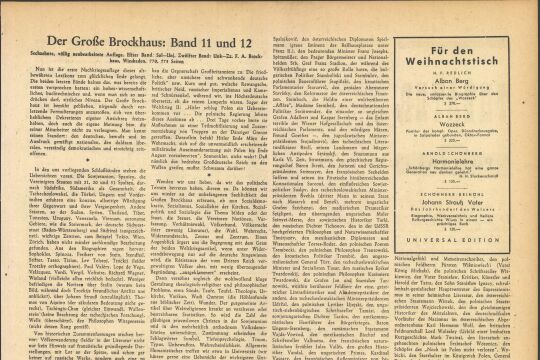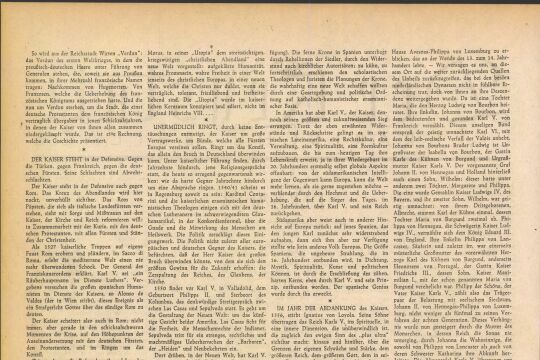Kaum zwanzigjährig trat der junge Habsburg-Lothringer seinen eigenen Weg an. Zunächst, wie alle Mitglieder des Herrscherhauses, als Offizier. Er gab sich den üblichen Freuden der Jugend seiner Sphären hin, und er schob sich nirgends in den Vordergrund. Da brachte die Katastrophe von Mayerling (30. Jänner 1889) einen jähen Umschwung. Nach Kronprinz Rudolfs Tod und angesichts des nie verhehlten Entschlusses Karl Ludwigs, im Falle eines Hinscheidens Franz Josephs auf die Krone zu verzichten, war Franz Ferdinand fortan Thronfolger. Der Kaiser verfügte, daß er dementsprechend auf sein künftiges erhabenes Amt vorbereitet werde. Dazu gehörte vor allem der Kontakt mit den wichtigsten Nationalitäten und Ländern der Monarchie. Im Hinblick auf den seit 1867 bestehenden Dualismus galt es zunächst, sich in Ungarn umzusehen. 27jährig erhielt Franz Ferdinand als Oberst das Kommando eines Husarenregiments in Ödenburg. Dort mißfiel ihm alles, die Sprache — die er nie richtig erlernte —, Art und Temperament der magyarischen Aristokratie, mit der er vor allem Verkehr zu pflegen hatte, Regierungssystem. Er weckte seinerseits lebhafte Antipathie bei der ungarischen Herrenschicht. „Die Gegner schieden voneinander, unversöhnt“, wäre als Ergebnis dieses zum Duell ausartenden Nebeneinander kurz zusammenzufassen. Die Ödenburger Episode fand durch das Auftreten eines von der Mutter ererbten und durch die Lebensweise des damals sehr der Venus huldigenden Erzherzogs verschlimmerten Lungenleidens ein Ende. Zur Heilung und um aus einer ihn beengenden Atmosphäre herauszugeraten, unternahm Franz Ferdinand eine Weltreise. Sie bereicherte die naturwissenschaftlichen Sammlungen des Kaiserhauses und zeitigte eine nicht gerade fesselnde Reisebeschreibung, bei deren Redaktion Baron Max Vladimir Beck, der schon vorher dem Thronfolger staatsrechtliche
Vorträge gehalten hatte, mithalf und so allmählich zum ersten Vertrauten seines früheren Hörers wurde. Dieser hielt sich für genesen und erhielt auf eigenen Wunsch ein Kommando in Böhmen. Doch bald brach die Krankheit mit vermehrter Heftigkeit hervor (1895). Während zweier Jahre verschwand der Erzherzog aus dem Gesichtskreis der Hofgesellschaft und der Politiker. Daß sich die meisten aus diesen Schichten sofort dem jüngeren Bruder, Erzherzog Otto, mit der vordem ihm selbst geheuchelten Servilität zuwandten, ihn aber voreilig begruben, hat dem schließlich wieder Genesenen die tiefste Menschen Verachtung eingeprägt und sein urhabsburgisches Mißtrauen gegen alle Welt, außer gegen lange und gründlich erprobte Getreue, aufs äußerste verschärft.
Kampf um persönliches Glück
Der nun folgende Lebensabschnitt des fortan in seiner Thronfolgerschaft nicht mehr Bezweifelten reicht von 1897 bis 1906. Im Mittelpunkt dieser Periode standen zwei Probleme, ein persönliches — die Heirat mit Comtesse Sophie Chotek — und ein Konglomerat sachlicher Bestrebungen: der Kampf um eine Erneuerung der Habsburgermonarchie, gegen die zentrifugalen Kräfte im Inneren und wider die den greisen Kaiser umgebenden alten Herren, die „ihren Tod verschlafen möchten“ (Karl Kraus), den eigenen und den des arg siechen Vielvölkerreiches.
Sophie Chotek, die der Erzherzog 1894 in Prag kennen- und lieben gelernt hatte, und die ihn während seiner Krankheit durch Briefe aufrechterhielt, dem Blut nach echte Prager erste Gesellschaft, also von tschechischen und deutschen Ahnen stammend, nicht ohne einen Zusatz altmagyarischen Erbes, wär eine Frau von bezaubernder Anmut, außerordentlicher Klugheit und Wendigkeit, doch eisernen Willens. Sie paßte in jeder Hinsicht zu dem ähnlich veranlagten Thronfolger.
Beide stimmten in ihrer aufrichtigen Frömmigkeit, in ihrer Pflichttreue, in ihrer Tapferkeit, in ihren — die Politiker und die Zeitungsleute, das Großbürgertum und die Literaten altmodisch anmutenden — „Stan- desvorurteilen“ überein, aber auch in ihrer Sehnsucht nach Familienglück, ja sogar in einigen minder erfreulichen Zügen, wie der übertriebenen Sparsamkeit. Franz Ferdinand wußte das, und darum, nicht nur aus Trotz und um es allen seinen Feinden „zu zeigen“, bewies er im Ringen um die Heiratserlaubnis des Kaisers eine Hartnäckigkeit und Standhaftigkeit, die zuletzt siegten. Zwei Tage vor der Hochzeit der, mit Ausnahme der guten Mama- Stiefmutter und ihren beiden Töchtern, das gesamte Kaiserhaus, auch die zwei Brüder des Bräutigams, fernblieben, hatte Franz Ferdinand am 28. Juni — offenbar seinem Schicksalstag .— des Jahres 1900 feierlich seine Heirat als unebenbürtig, morganatisch erklärt und auf die Nachfolge für die Sprossen aus dieser Verbindung verzichtet. Er zahlte diesen Preis, um das Kostbarere, die Heirat, zu erlangen. Doch seinem Geschichtsunterricht und den Erfahrungen aus seiner Leidenszeit gesellte sich nun ein Drittes hinzu: die Erinnerung an den Kampf um sein Glück.
Daß ihm dabei in erster Linie Max Vladimir Beck als Berater zur Seite gestanden war, verschaffte diesem ungemein fähigen, doch vom Ehrgeiz getriebenen Politiker und Hochbürokraten die bevorzugte Position als Chef einer Art von Nebenregierung, die sich im Wiener Palais des Thronfolgers, dem Belvedere, entwickelte.
F. F. und die Nationen
Die letzte, für die Geschichte wichtigste, Epoche im Leben Franz Ferdinands, von, 1906' bis l&i’K zeigt uns den Thronfolger, als, zu sich selbst gereifte, überragende Persönlichkeit mit festgefügten Ansichten und Plänen, an deren Einzelheiten er sich nie pedantisch klammerte, die er aber im Grundsätzlichen unnachgiebig, unbeugsam verfocht.
Franz Ferdinand war weder der Deutschenhasser, als den ihn die Schönerianer und manche liberale Kreise im Reich darstellen, noch der deutsche Mann, als den ihn, nicht ohne Männerstolz vor Führerthronen, entgegen Hitlers abgründigem Widerwillen gegen den Thronfolger, ein paar zur NSDAP hinübergeschwenkte — darunter ein geistig sehr bedeutender — einstige Leitgestalten des Belvederes und übereifrige Dissertanten beanspruchten. Er hatte eine hohe Meinung von deutscher Kultur und Sprache, die er als Verbindungsmittel Großösterreichs erstrebte, doch keinerlei Neigung zu jenem deutschen Wesen, an dem die Welt genesen sollte und an dem sie, samt den Deutschen, beinahe verwest ist. Er war kein Tschechenfeind und Germanisator, als den ihn die gesamte nichtaristokratische böhmisch-mährische Bürgerwelt betrachtete. Weder tschechi- sierte er sein Haus, Belvedere oder Konopischt, noch war er des Tschechischen unkundig: Ich habe ihn und die Herzogin geläufig Tschechisch reden gehört. Er liebte und bevorzugte Kroaten, Slowenen, Rumänen, Ruthenen, weil er sie für Eckpfeiler seines künftigen Kaisertums Österreich hielt Daß er die ungarischen Magnaten, samt der Gentry, nicht mochte, trifft zu — er hatte dafür alle Ursache —, doch das magyarische Volk hoffte er zu gewinnen, und er war ihm durchaus gewogen. Aus der Luft gegriffen ist seine Polenfeindschaft. Die aus Unkenntnis auch von Historikern behaupteten mangelnden Kontakte mit Polen waren vorhanden. Der Kunsthistoriker Graf Mycielski gehörte zum engsten Kreis des Belvedere und war oft Gast in Konopischt, der spätere Minister Twardowski nicht minder. Franz Ferdinand war gerne Gast bei Graf Roman Potocki auf Lancut. Nur die Italophobie des Thronfolgers war lückenlos, und doch hat er sich über die Heirat seines Neffen und Nachfolgers Kari mit einer Prinzessin von Parma gefreut. Zuletzt: Franz Ferdinands Antisemitismus. Auch der war solid, doch im Grunde nicht anders als der Luegers oder Karl Kraus’. Er nahm vom Ekel vor der damaligen Presse und von der Erbitterung über den übermäßigen Anteil jüdischer Intellektueller am sogenannten Freisinn und an den mannigfachsten umstürzlerischen Parteien den Ausgang. Es hat jedoch keinem der Günstlinge des Erzherzogs geschadet, daß sie den künftigen Nürnberger Gesetzen nicht entsprechende Frauen hatten, wie dies bei mehreren seiner Getreuesten und beim vermeintlich am wenigsten Getreuen,
doch nicht ob seiner Ehe Verdammten, der Fall war
Der Thronfolger, so wie er war, mit seinen scharfen, fast stets zutreffenden Urteilen und seinen wenigen, beklagenswerten Vorurteilen, zog also vom Belvedere aus gegen die Hofburg zu Felde. Das war dem ewigen Naturgesetz gemäß, das die Jüngeren wider die Älteren in die Schranken ruft Der Kaiser, durch drungen von seinem Recht und von seiner Pflicht, allein zu herrschen, im Rahmen der von ihm gebilligten Ordnung des Dualismus Österreich- Ungarn und der Achtung sowohl der Verfassung Zisleithaniens als auch des geschworenen ungarischen Krönungseides, gab nur ungern und langsam einige vorgeschobene Positionen auf. Seine ihm gewohnte und ihm werte engere Umgebung, die Generaladjutanten Graf Paar und Baron Bolfras, der Chef der Kabinettskanzlei, Baron Schiessl, und der Generalstabschef Baron, dann Graf,, verabscheuten die Ziele und die Methoden, den Gebieter und die Männer des Belvedere. Die Regierungen Franz Josephs waren selbstverständlich ebenfalls bemüht, ganz im Sinne des Monarchen zu arbeiten; sie kamen deshalb, wie von selbst, im Gegensatz zum Thronfolger und seinen Leuten. Bei den Ungarn war das selbstverständlich. Die Bedeutendsten der magyarischen Oligarchen, die Grafen Tisza, Andrässy, Apponyi, hegten für Franz Ferdinand so zärtliche Gefühle wie dieser für sie. In Österreich aber bezeugte der Fall Max Vladimir Beck, daß niemand zwei Herren dienen kann. Vom Kaiser zum Ministerpräsidenten ernannt, verlor der allzu ungeduldig Ehrgeizige, der gehofft hatte, in dieser Stellung für Franz Ferdinand einen köstlichen Schatz zu bilden, automatisch dessen Vertrauen, ja, er zog sich gar bald dessen Haß zu. Gleich Beck hatten auch andere Schützlinge des Erzherzogs, wie die gemeinsamen Minister Graf Aerenthal und Schönaich, die Huld des hohen Herrn sofort eingebüßt, wenn sie seiner Politik zuwiderhandelten.
Die Männer des „Belvedere“
Maßgebender Berater im Belvedere wurde Major (später Oberst) Alexander Brosch von Aarenau, ein genial begabter, geschmeidiger, allseitig gebildeter, energischer Offizier von lauterer Gesinnung, in dem das Zeug zu einem großen Staatsmann steckte. Chef der Militärkanzlei des Thronfolgers, war er das Regierungshaupt eines Neben- und Gegenkabinetts. Um den Thronfolger und um Brosch sammelten sich „Neben“-Minister und gelegentliche (mitunter auch ungelegene) Mitarbeiter, vornehmlich aus vier Kreisen. Zunächst das Militär, wobei Brosch und sein nicht minder begabter Nachfolger, Carl Freiherr von Bardolff, dominierten. Sodann der Chef des Generalstabes, Baron Conrad von Hötzendorf (der spätere Feldmarschall und faktische Oberbefehlshaber der k. u. k. Armee im ersten Weltkrieg); der Thronfolger anerkannte zwar die hohen fachlichen Fähigkeiten Conrads, menschlich aber ist er ihm niemals näher-
gekommen und geriet zu ihm des öfteren in Widerspruch. Zum zweiten der böhmisch-mährische Hochadel, voran die Grafen Ottokar Czernin und Heinrich Clam-MarH nitz, zwei Fürsten Schwarzenberg, Graf Jaroslaw Theun, Graf Sylva- Tarouca. Drittens staatsrechtskundige Gelehrte und hohe Beamte, in erster Linie der weltberühmte Völkerrechtslehrer Professor Lammasch, Österreichs letzter Ministerpräsident, ferner Professor Bernatzik und Sektionschef Baron Eichhoff. Viertens Politiker und Publizisten. Von Deutschsprachigen vor allem Lueger, Dr. Funder, damals Herausgeber der „Reichspost“, des Organs des „Belvedere“, später der „Furche“, der Deutsch-Ungar Dr. Steinacker, der ausgezeichnete Biograph des Thronfolgers, Theodor von Sosnosky, endlich der gedankenreiche Publizist und Ministersohn Baron Leopold Chlumetzky. Unter den Ungarn stehen voran Jözsef von Kristoffy, gewesener Minister in der bei den Magyaren verpönten „Trabantenregierung“, Vorkämpfer des allgemeinen Wahlrechts und einer Verständigung mit den Nationalitäten seines Vaterlandes, Bischof Dr. von Länyi, Graf Jänos Zichy, Führer der magyarischen Christlichsozialen, ferner die Sprecher der Minderheiten in den Ländern der Stefanskrone; der Slowake Dr. Milan Hodza, nachher tschechoslowakischer Ministerpräsident, die Rumänen Vayda-Voe- vod und Maniu, beide nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie Ministerpräsidenten Großrumäniens, der künftige Patriarch und Regent Miron Cristea, der vom Erzherzog besonders beachtete Publizist Aurel von Popovici.