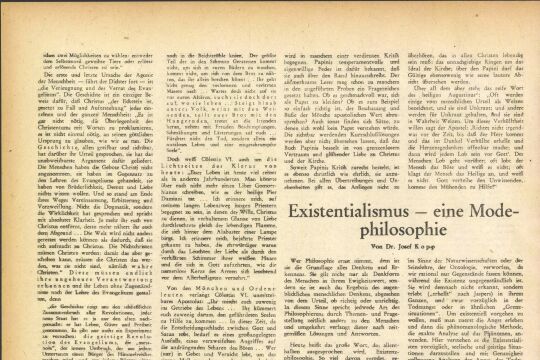Schriftsteller wie Thomas de Quincey und David Foster Wallace über Verlockungen der Drogen, veränderte Wahrnehmung – und Abgründe.
„Es wird immer offenbleiben“, schreibt der amerikanische Philosoph William James, „ob mystische Zustände nicht vielleicht erhabenere Ausblicke ermöglichen und Fenster sind, durch die das Bewusstsein auf eine erweiterte und reichhaltigere Welt hinausblickt.“
Führt man die „mystischen Zustände“ auf die Einnahme von Haschisch, Opium, Meskalin, LSD oder Kokain zurück, wird ein wesentliches Motiv sichtbar, warum besonders sensible Schriftsteller und Philosophen das Bedürfnis verspürten, die künstlichen Paradiese, die diverse Rauschmittel verschaffen, aufzusuchen, um jene archaischen Phänomene der Ekstase kennenzulernen, die im abendländischen Zivilisationsprozess ausgeblendet wurden. Der Religionshistoriker Klaus Heinrich spricht von der „Sucht nach Sog“, die darauf ausgerichtet ist, die Grenzen des rationalen Ich aufzusprengen, um in die Sphären der Imaginationen und Halluzinationen vorzudringen.
Viele Verlockungen
Die Liste der Rauschadepten ist lang; sie reicht von Thomas de Quincey und Samuel Taylor Coleridge über Charles Baudelaire und Jean Cocteau bis zu Henri Michaux und David Foster Wallace. Auch Philosophen konnten den vielversprechenden Verlockungen nicht widerstehen: So experimentierte Walter Benjamin mit Haschisch, dessen psychedelischen Wirkungen auch Ernst Bloch zugetan war. Michel Foucault neigte eher zu LSD und Roland Barthes zählte Haschisch zu den „Perversionen, die ganz einfach glücklich machen“.
Dieser Glückszustand findet eine enthusiastische Beschreibung in den „Bekenntnisse(n) eines englischen Opiumessers“ des Schriftstellers Thomas de Quincey (1785–1859), die auf die bewusstseinsverändernden Zustände des Opiums eingehen. Der Schriftsteller schildert die Initiation, die visionären Erlebnisse und den Absturz eines Adepten, der dieser Droge über Jahrzehnte verfallen war.
Vorerst benützte er das Opium, wie damals üblich, als Mittel gegen Zahnschmerzen; bald entdeckte er jedoch die Annehmlichkeiten und Glücksverheißungen der Droge: „Hier war das Geheimnis des Glücks auf einmal entdeckt, über das die Philosophen so viele Jahrhunderte diskutiert hatten“, schrieb de Quincey in den „Bekenntnissen“ über die „Freuden des Opiums“. Er spricht von einem gottähnlichen Zustand, der nach der Einnahme von Opium erfolgt. Die Droge eröffnet einen Kosmos von Imaginationen und intensiven Gefühlen, der als ein Überschäumen über alle Ränder geschildert wird; Raum und Lichtvisionen überfluten die gewohnte Wahrnehmungswelt. Das Denken nimmt rhapsodischen Charakter an, die Gedanken werden immer schneller, gleichzeitig zufälliger, beginnen sich aufzulösen und münden in einen in wahnwitzigem Stakkato vorgetragenen Rapgesang von Wortfetzen und Wortkaskaden, der an dadaistische Lautgedichte erinnert.
Die verschiedenen Halluzinationen lösen die zentrale Ich-Instanz auf, die Wahrnehmungen und Empfindungen bilden einen Strom von Impressionen, die wie in einem Film ablaufen und nicht mehr zum Halten gebracht werden können. Die starren Zeiteinheiten zerbröckeln allmählich. Die Objekte der Außenwelt erscheinen in einer verzerrten, bizarren Gestalt. Versunkene Erinnerungen treten auf, vergangene Szenen und Situationen werden gegenwärtig, vermischen sich und gleichen der Inszenierung eines surrealen Theaterstücks.
Absturz nach Ekstase
Die traditionelle Trennung zwischen Subjekt und Objekt wird aufgehoben; ein neuartiger Bezug zur Objektwelt hergestellt. Die Distanz schaffende Opposition von Ich- und Dingwelt erfährt eine Negation. „Die Dinge fangen an zu sprechen, weil der Rausch zart und höflich gegen sie macht“, notierte Walter Benjamin, „mein Stock fängt an, mir besondere Freude zu machen. Man wird so zart: fürchtet, ein Schatten, der aufs Papier fällt, könnte ihm schaden.“
Eine andere Erlebnisqualität vermittelt das Meskalin, das der französische Schriftsteller und Maler Henri Michaux in seinem Buch „Turbulenz im Unendlichen“ schildert: „Man ist in eine Schockzone eingetreten. Arabesken, Girlanden, Jahrmarkt. Ein Extremismus im Licht, das mit ausbrechendem Glanz die Nerven anbohrt. Zittern in den Bildern. Hin- und Herschwingen. Eine berauschende Optik.“ Das viel beschworene, höchste Glücksgefühl stellt sich ein; „man fühlt den göttlichen Teil seines Wesens emporsteigen“, konstatierte de Quincey.
Dem ekstatischem Glücksgefühl folgt jedoch ein Absturz in die Faktizität der Nüchternheit, die von Bertolt Brecht ironisch geschildert wird: „Ihr grünen Eilande der tropischen Zonen / Wie seht ihr aus morgens und abgeschminkt / Die weiße Hölle der Visionen / ist ein Brettervorschlag, worin Regen eindringt“. Verbunden ist diese Höllenfahrt mit Depressionen, Ich-Zerfall und Arbeitsunfähigkeit. Noch schlimmer sind die Folgen, die nach längerer Einnahme und Abhängigkeit von der Droge entstehen. De Quincey kennt sie gut genug: Im Abschnitt „Die Leiden des Opiums“ beschreibt er die psychischen Zustände, die sich nach dem Absetzen der Droge einstellen: Seine Träume sind voll düsterer Melancholie und von Angst erfüllt: „Ich schien jede Nacht hinabzusteigen, in Klüfte und sonnenlose Abgründe, in Tiefen unter den Tiefen, aus denen je wieder aufzusteigen hoffnungslos erschien.“
Trostlose Langeweile
Noch drastischer wird das Inferno der Drogensüchtigen von David Foster Wallace in seinem Buch „Unendlicher Spaß“ geschildert. In dem Werk spielt die von Drogen gesteuerte „Sucht nach Sog“ eine wesentliche Rolle. Der Ausgangspunkt von Wallace ist die sinnentleerte und trostlose Langeweile, die das durchschnittliche Leben charakterisiert und die dem Autor, der an schweren Depressionen litt, sehr vertraut war. Ein Synonym dafür ist das Berufsleben, dessen monotone Banalität Wallace in einer Rede vor College-Studenten auf den Punkt bringt: „Man steht morgens auf, fährt zu seinem anstrengenden Job und arbeitet neun oder zehn Stunden lang hart, und am Ende des Tages ist man müde und gestresst und will bloß noch nach Hause, (…) weil man am Morgen früh raus und alles noch mal genauso machen muss.“ In seinem über 1500 Seiten umfassenden Roman, der eine in atemberaubenden Tempo vorgetragene Collage von Handlungssträngen präsentiert, die den Leser, die Leserin in einen deliriumähnlichen Zustand versetzt, finden sich bestürzende Bilder aus der Innenwelt der Sucht, wie sie bisher kaum zugänglich waren. Der Schauplatz dafür ist eine Entzugsklinik, die vordergründig als Gegenwelt zu einer Tennisakademie fungiert, in der die Ideologie des Erfolges propagiert wird, die den Tüchtigen, den Leistungsträger als höchstes Produkt des menschlichen Evolutionsprozesses ansieht.
Nun ist der philosophisch höchst gebildete Autor nicht so naiv, eine Licht- und Schattenwelt zu entwerfen: Was beide Welten verbindet, sind verschiedene Arten der „Sucht nach Sog“. So kreist das Denken einiger Protagonisten ständig um Marihuana, um die Schwierigkeit, „Dope the Hope“ zu beschaffen, und um die körperlichen Auswirkungen des Drogenkonsums: „Er bekam davon einen trockenen Mund, trockene und entzündete Augen und Hände; es war, als unterminiere das Marihuana die Integrität seiner ganzen Gesichtsmuskulatur.“
Auch Hal Incandenza, der hochbegabte, sensible „Held/Antiheld“ des Romans, gibt sich der anstrengenden Tätigkeit des Kiffens hin, das ihn erschöpft und noch mehr in seine selbst gewählte Einsamkeit treibt. Ein nicht namentlich genannter Insasse der Entziehungsanstalt berichtet, dass „seine Nasenscheidewand vom Koks volle Kanne aufgelöst worden ist“. Joelle, eine Gestalt, die aus dem Umkreis von Andy Warhol und Lou Reed stammen könnte, vergleicht die Putztätigkeit unter Drogeneinfluss mit einer Meditation und Madame Psychosis, die Junkie-Queen, die sich mit den Verkrüppelten, Hässlichen und Verwahrlosten solidarisch erklärt, beendet ihr Leben durch eine Überdosis Heroin.
Besonders eindringlich sind die seitenlangen Passagen, in denen die Wahrnehmungs- und Erlebniswelt von Junkies in einer ausufernden Sprache geschildert wird, die an den Schlussmonolog von Molly Bloom im Roman „Ulysses“ von James Joyce erinnert. Der von einem „goldenen Schuss“ bewirkte Tod des Junkies C wird da so beschrieben: „C fing sofort laut zu kreischen an als er die Manschette gelöst und sich den Schuss gedrückt hatte und geht volle Kanne zu Boden hämmert mitn Hacken auf dem Metall vom Abluftgitter rum geht sich mit den Händen an die Kehle reißt total abgefuckt an sich rum (…) und kratzte für immer ab.“
Endstation Hölle
Die Endstation der „Sucht nach Sog“ ist erreicht. Von den Glücksversprechungen der künstlichen Paradiese ist nicht mehr die Rede, sondern nur mehr von einer sinnlosen, qualvollen Welt, die vom „Paradox der Rauschgiftsucht“ beherrscht wird: „Wenn eine Droge Sie erst so nachhaltig unterjocht hat, dass Sie von ihr loskommen müssen, um am Leben zu bleiben, dann ist Ihnen diese unterjochende Droge so wichtig geworden, dass Sie praktisch den Verstand verlieren, wenn Sie Ihnen genommen wird.“
Für alle, die diese Hölle betreten, gilt Dante Alighieris Ratschlag: „Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“
Nikolaus Halmer, geb. 1958, Studium der Philosophie, Romanistik, Theaterwissenschaft. Mitarbeiter der Wissenschaftsredaktion des ORF.
Bekenntnisse eines englischen Opiumessers
Von Thomas de Quincey
Aus dem Engl. von Walter Schmiele
Insel 2009. 157 S., kart., e 8,30
Unendlicher Spaß
Von David Foster Wallace
Aus dem amerikan. Engl. von Ulrich Blumenbach
Kiepenheuer & Witsch 2009
1547 S., geb., e 41,10
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!