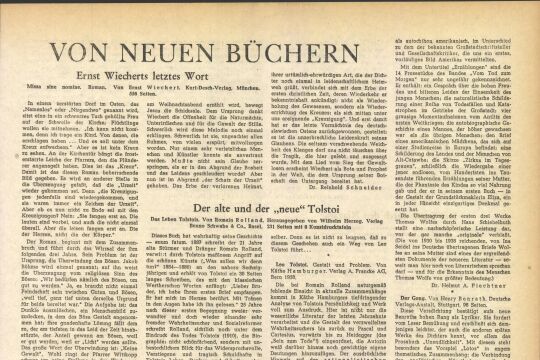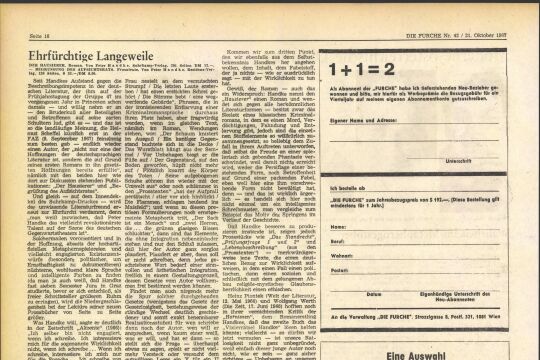"Es sind die Formen der großen Mythen, der mystischen Erzählungen und der katholischen Sakramente, in denen die alltäglichen Dinge, Naturereignisse und auch triviale Geschehnisse in einen großen, erlösenden Zusammenhang rücken." Harald Baloch
Peter Handke zum 60. Geburtstag.
Die Frage, was ich von Handke halte, wurde und wird mir oft gestellt, in den achtziger Jahren meist mit dem Unterton einer poetical correctness von jenen, welche Handkes "Langsame Heimkehr" (1978/79) und seine daran schließende Poesie als krassen Gegensatz zu seiner Sprachkritik in den frühen Werken - insbesondere dem Bühnenstück "Kaspar" (1967/68) - empfanden. Heute wenden sich nicht wenige aus political correctness von Handke ab. Seine Positionen zum Zerfall Jugoslawiens und den jüngsten Kriegen am Balkan irritieren, enttäuschen, empören. Oder werden einfach pauschal übergangen: so sei Handke immer schon gewesen, gegen den mainstream seiner Zeit, isoliert und selbstisoliert. Jedenfalls steht immer ein gesamtes Werk und eine Person zur Frage.
Erinnerungen zu Handke
Das erste Erinnerungsbild, das ich von Peter Handke habe, ist das des Schülers am Gymnasium in Klagenfurt. Mit-Schüler würde ich Handke nie nennen, denn er blieb fremd, las während des Unterrichts meist in einem unter der Bank gehaltenen Buch (Nietzsches Zarathustra oder ein Comic-Heft könnten es gewesen sein), antwortete aber auf Fragen immer gut. Er war der Schüler, von dem wir anderen sonst nichts wussten. Nur er selbst und ein, zwei Lehrer ahnten damals, dass ein großer Dichter aus ihm werden würde. Dichter und nicht Schriftsteller, ein Unterschied, den er schon als Schüler des Bischöflichen Gymnasiums in Tanzenberg in der Schülerzeitung präzise beschrieben hatten, ehe er dort rausgeworfen wurde oder ging (wie Handke heute genauer darüber denkt). Damit sei keine persönliche Beziehung zu Handke angedeutet, sondern eine gebliebene Fremdheit. Die aber kann zu einer anderen Nähe werden - der Nähe des Lesers.
Handke in den sechziger Jahren zu lesen oder seine Theaterstücke zu sehen, war ein Muss und ein Vergnügen. Alle damals kursierenden Gesellschaftskritiken überbot der "junge Handke" - bald wie der fünfte der Beatles verehrt - durch seine strukturelle Kritik an der Sprache als einer anonymen Ordnungsinstanz, die schon qua Grammatik dem Individuum ein Eigenleben entzieht. Die Selbstbehauptung des Einzelnen, der eigenen Gefühle und Wünsche nach Unmittelbarkeit, mit Hilfe der anderen Sprache der Poesie ist ein Leitmotiv Handkes vom ersten Roman "Die Hornissen" (1994) an bis heute. "Damals" hat Handke die Individualität unterdrückenden Schemata der Sprache - und in einem ersten wortlosen Theaterstück ("Das Mündel will Vormund sein", 1968) auch der Körpergesten - als Schemata sichtbar gemacht. In der Kultur von damals waren es für Handke vor allem Gefühle des Schreckens und der Angst, die mit Poesie gegen die Sprache der Mitwelt zu sichern waren. Das ändert sich später, aber das präzise Wissen um die gemäßen Formen, in denen etwas gesagt werden will, bleibt.
Den Vorwurf, Handke sei ein Formalist oder es gehe ihm nur um die Form, habe ich nie verstanden. So oft ich kann, halte ich auf der Fahrt zwischen Graz und Klagenfurt in Griffen und besuche das Grab von Handkes Mutter am Friedhof des Stiftes. Diese Frau kam mir unglaublich nahe, gerade über die Form, in der Handke ihr (und sein) durch die dörflichen und kirchlichen Rituale geprägtes Lebensschicksal zu verstehen versuchte. Ein Satz aus "Wunschloses Unglück" (1972) lässt mich nicht in Ruhe: Der Blick vom Grab, von dem die Leute sich rasch entfernten, auf die unbeweglichen Bäume: erstmals erschien mir die Natur wirklich unbarmherzig. Dieser Satz als Erfahrungssatz und als weit zurückliegender, aber immer präsenter Ausgangsort einer poetischen Sinnsuche in der Natur.
Vom Torbogen desselben Griffener Friedhofs herab spricht in Handkes dramatischem Gedicht "Über die Dörfer" (1980/81) die Erlösungsgestalt Nova. Aber da war schon der erste Schock geschehen, den Handke seinen naiven Lesern und den Literaturwissenschaftlern mit der "Langsamen Heimkehr" zugefügt hatte, und die Rede der Nova wurde kaum mehr verstanden.
Handke wendet sein Augenmerk schon im "Kurzen Brief zum langen Abschied" (1971) nicht mehr vorwiegend den Schrecken zu, die eine fremde Gesellschaft und eine fremde Natur auslösen, sondern den kurzen, in der Form mystischen, Momenten des Glücks, des Einklangs mit sich selbst, der Mitwelt und der Natur. Zum leitenden Motiv für Handke wird, solch seltenen Momenten im Leben eine Dauer durch Poesie zu geben und/oder durch Poesie den Blick auf die Wirklichkeit so zu verwandeln, dass diese Wirklichkeit glückhaft erfahren werden kann. "Verwandlung und Bergung der Dinge in Gefahr", "Réalisation" im Sinne Cézannes nennt Handke selbst diese neue Phase seines Schaffens und sagt sich - wie ehedem von der "Beschreibungsliteratur" - von Literatur als bloßer Spiegelung der Verlorenheit und Zerissenheit des Daseins offen los. Deshalb wird und wirkt Handkes Poesie spätestens ab 1978 so religiös aufgeladen.
Poesie als heiliger Text
Es sind die Formen der großen Mythen, der mystischen Erzählungen und der katholischen Sakramente, in denen die alltäglichen Dinge, Naturereignisse und auch triviale Geschehnisse in einen großen, erlösenden Zusammenhang rücken. Es geht nicht mehr um die Fremdheit des Individuums, sondern um dauerhafte Beziehung zur Welt. Paradoxerweise führte gerade dies zu großer Befremdung über Handke. Wurde Handke Lesern und Kritikern zu fromm, obwohl er oft genug betonte, Poesie sei ihm ein Erlösungsspiel und - mit Heidegger -, dass uns schon die Abwesendheit eines Gottes vor dem Verfallensein an das Seiende bewahre?
Für Handke steht Poesie in einer deutlichen, positiven Analogie zu den christlichen Riten, insbesondere zur Eucharistie. Poesie birgt gleichsam als heiliger Text Glücksmomente des Daseins. Dieser "Text" (eigentlich ein vom Text gemaltes Bild) erlaubt es, Zusammenhangserfahrungen wieder zu erinnern, er ist Wandlungsritus und zugleich Tabernakel, der immer wieder zur erlösenden Begegnung mit dem "Göttlichen", d. h. der Erfahrung eines Zusammenhangs geöffnet werden kann.
Diese Kontextualität zur mystischen und sakramentalen christlichen Tradition ist offenkundig, wird jedoch meist nur spöttisch abgehandelt. Am Beispiel des Schlusses von Handkes "Lucie im Wald mit den Dingsda" (1998/1999) möchte ich dafür mehr Verständnis wecken. Es heißt da: Das ganz letzte Wort freilich kam aus dem Nachbargarten, von Wladimir, dem Jungen aus dem baumlosesten Hohen Atlas in Nordafrika, und es war arabisch und lautete: Labbayaka'. Das heißt: Ich bin hier!Und im folgenden Sommer saß Lucie auf einer Waldlichtung im Gras und las diese ihre Geschichte.
Wenn man diesen Text als Theologe liest, taucht aus der auch für Handke unerlässlichen geschichtlichen Erinnerung jene verwandte Szene aus den Confessiones auf, da der junge Augustinus im Garten die fremde Stimme hört: Nimm und lies. Augustinus las die Heilige Schrift. Diese religiöse Valenz haben für Handke die fremde Stimme, sofern sie eine freundschaftliche ist, und der Garten/die Natur.
Dass einer jemandem zuruft, "hier" zu sein, ermöglicht Handkes Romangestalten, selbst ganz "hier" zu sein, und das heisst dann wieder: sie lesen eine, ihre Geschichte in der Natur. Poesie ist für Handke heilige Schrift: ausgerichtet aber auf ein interpretationsloses und auch nicht mehr interpretierbares glückliches Hier-Sein.
Handkes Serbien
Und was ist mit Serbien? Mit Handkes winterlichen und sommerlichen Reisen dorthin, mit den befremdenden Schilderungen der Landschaft dort und der eigenen psychischen Befindlichkeit, anstatt von den Toten zu schreiben? Mit der Verurteilung des NATO-Bombardements und der Sympathie für einen MiloÇsevi´c? Ich versuche dazu einen Zugang zu finden, der das Realgeschehen nicht leugnet und dennoch Handke gerecht wird. Es ist dies seine immer tiefer werdende Sehnsucht, dass der Blick in die Natur uns von der individuellen und kollektiven Schreckensgeschichte und deren seelischer Nachwirkung befreien möge. Nicht Wegsehen ist das, sondern ein anderes Sehen, wenn man so will sogar ein Verdrängen. Das Problem an Handkes Poesie und Interviews zu Serbien ist, dass er keine deutliche Differenz mehr zwischen politischen Aussagen und poetischer Sehnsucht macht. Der Balkan ist keine "Niemandsbucht". Eine Identität von Poesie und Leben, jenseits der Geschichte, kann einer immer nur für sich selbst beanspruchen; sie von anderen, zumal von Opfern, zu erwarten, ist unangemessen und auch unmenschlich.
Der Mensch lebt von Brot und Büchern. Darum bitte ich Sie. Nein, ich bitte um überhaupt nichts: Lesen Sie gefälligst! So frech schloss Handke am 8. November seine Dankrede zur Verleihung des Ehrendoktorats der Uni Klagenfurt. Er meinte damit nicht seine Texte, ich meine seine und auch das eben erschienene Heft 158 der manuskripte zu Handkes 60. Geburtstag.
Der Autor ist Berater für Wissenschaft und Kultur des Bischofs in Graz und Verfasser einer Dissertation über "Religion und Ritus im Werk Peter Handkes".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!