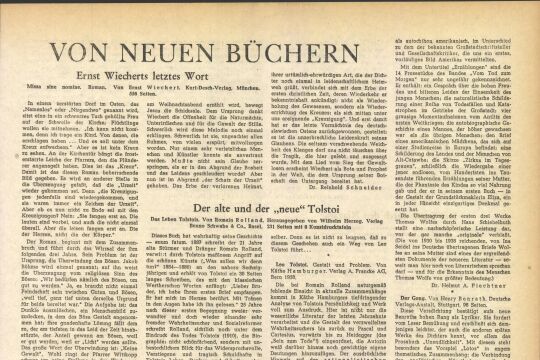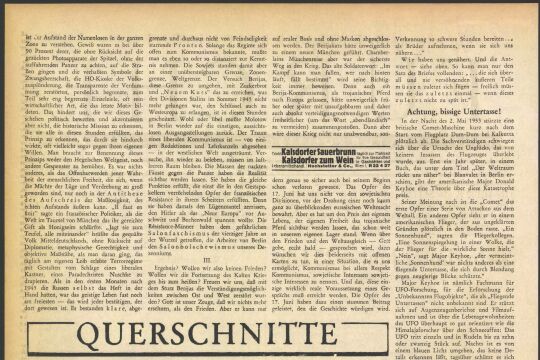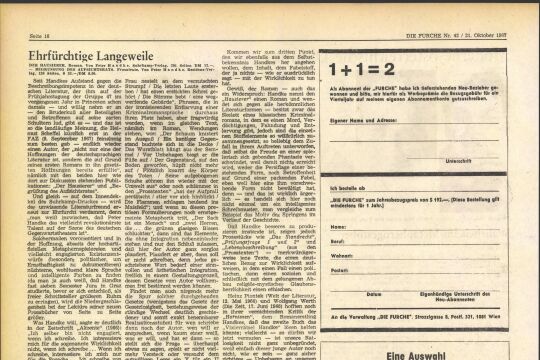Peter Handke: Von Dämonen und Redekreuzzügen
Der österreichische Nobelpreisträger Peter Handke hat vor Kurzem mit einer umstrittenen Serbienreise erneut auf sich aufmerksam gemacht. Zuvor ist der schmale Prosaband „Mein Tag im anderen Land“ erschienen, in dem er von äußerer Wanderschaft und innerer Wandlung erzählt.
Der österreichische Nobelpreisträger Peter Handke hat vor Kurzem mit einer umstrittenen Serbienreise erneut auf sich aufmerksam gemacht. Zuvor ist der schmale Prosaband „Mein Tag im anderen Land“ erschienen, in dem er von äußerer Wanderschaft und innerer Wandlung erzählt.
Der in Kärnten geborene und heute in Chaville bei Paris lebende Autor Peter Handke geht unbeirrt seinen Weg. Nachdem sich nach der Nobelpreisverleihung im Jahr 2019 die medialen Wogen langsam wieder geglättet haben, lässt er erneut mit einer umstrittenen und in jedem Fall entbehrlichen Reise nach Serbien aufhorchen. Dort hat Handke kürzlich einen Ehrungsmarathon absolviert. Dabei hat man ihm unter anderem sogar den hohen Karadjordje-Orden überreicht.
Die Annahme dieser Auszeichnungen ist nicht nur unnötig, sondern angesichts der politischen Botschaft und der damit verbundenen Vorgeschichte einfach unverständlich. Einmal mehr brüskiert er damit die Opfer der Kriegsverbrechen vor dem Hintergrund einer unbewältigten Vergangenheit.
Aktuelle politische Implikationen gibt es in seinem im Frühling erschienenen Prosawerk nicht. Vielmehr knüpft es unmittelbar an sein Schreiben abseits des literarischen Mainstreams an. In der rätselhaften Dämonengeschichte „Mein Tag im anderen Land“ werden Reise und Verwandlung zu einer Auseinandersetzung mit dem Gesellschaftswesen.
Metamorphose zum Bösen
Handke eröffnet seine Prosa mit einem Paradoxon, das er als Stilmittel durch den gesamten Text zieht. Zu Beginn gibt es eine bislang unerzählte Geschichte im Leben des Protagonisten. Obwohl er sie „in Fleisch und Blut erlebt“ hat, stammt sie nicht von ihm. Der Ich-Erzähler, ein Obstgärtner, weiß von ihr „allein vom Hörensagen“. Er schildert sie aus dem Rückblick und lässt sie im Aufschreiben Gestalt annehmen. So rauscht man mit dem Ich-Erzähler zurück in die Zeit seiner Besessenheit, als Dämonen Besitz von ihm ergriffen haben und er nicht „bei Sinnen“ war.
Euphemistischer drückt seine einzige Schwester diese „Wahnperiode“ aus. „Ohne Bewusstsein“ habe er sein Zelt auf einem Friedhof aufgeschlagen und dort in der Art eines „Schlafwandlers“ ganz reduziert von heimischen Äpfeln und Hausbrot auf seinem „Steppenwohnsitz“ gelebt. Die Leute schrecken vor ihm zurück, weil er ein Gefühl des Unheimlichen, Absonderlichen hervorruft; man wirft ihm sogar Machtwahn vor, da er ein Bändchen über Spalierobst verfasst hat. Mit all dem geht seine Metamorphose zum Bösen einher, die sich in ausfälliger Sprache, ja geradezu in „Redekreuzzügen“ widerzuspiegeln beginnt.
Ein Spiel? Die Grenze ist fließend, aber niemand kommt dem Ich-Erzähler entgegen, man nimmt vielmehr Reißaus vor ihm. Denn zornig schmäht er in der düsteren „Endphase“ der Besessenheit die „Schöpfung“, bis ein Wunder geschieht und er in einer unverständlichen Sprache zu reden und zu singen beginnt, sodass sogar Tiere innehalten, um – ähnlich wie im Mythos über Orpheus – den Klängen zu lauschen. Der Besessene gewinnt fortan an Autorität, wird sogar zum Orakel und macht sich, nachdem die Dämonen von ihm abgelassen haben, auf die Reise.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!