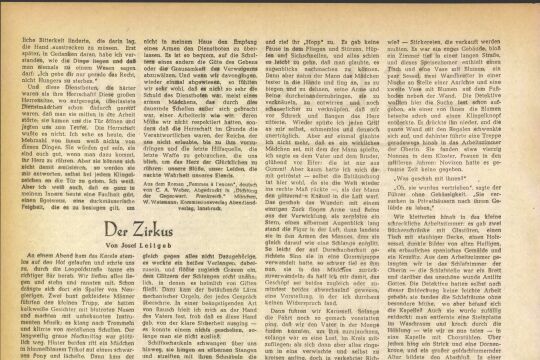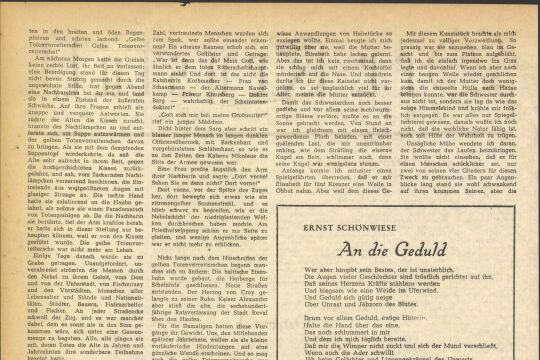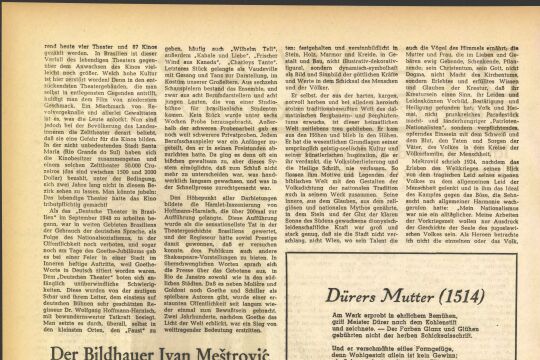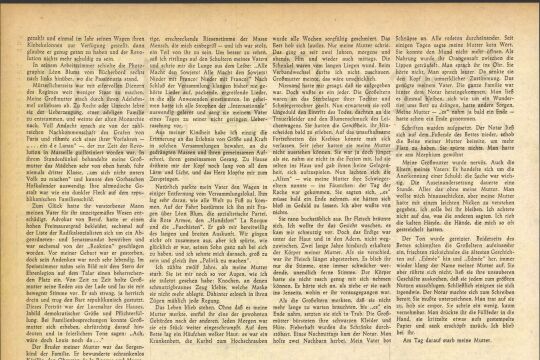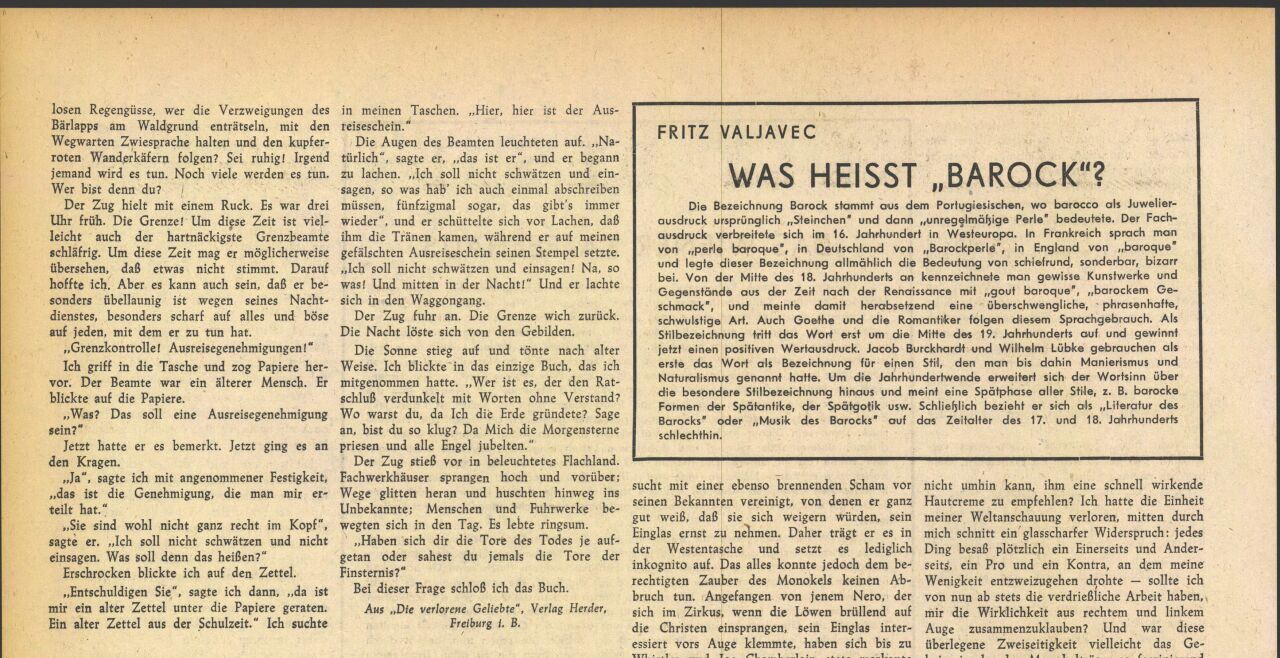
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Monokel
Wie ist es nur gekommen, daß dieses Stück Glas aus einem Augenschaden einen unleugbaren gesellschaftlichen Vorzug hat machen können? So daß selbst Menschen, die keineswegs an ungleicher Sehstärke leiden, sich dennoch deren Korrektur ins Auge klemmen? Man könnte das ja so erklären: Das geistigste Organ des Menschen ist das Auge; das bedeutende Auge blitzt; das Monokel nun verstärkt dieses Blitzen, ohne das Antlitz durch die Apparatur einer Brille zu entstellen. Aber die Erklärung taugt nichts, weil nach ihr ein Gesicht mit zwei Monokeln mindestens die gleiche faszinierende Wirkung haben müßte — und es hat sie nicht. Gerade auf damk inseitigen, ‘ tlrisymmefn’sbh n des Monokels beruht dessen funkelnder Effekt. Ein Monokelträger ist ein Polyphem, der sein Auge nicht mitten auf der Stirn, sondern merkwürdigerweise in der Ecke trägt.
Dieses Glas wirkt Wunder. Der bebrillte Mensch braucht sein Aushängeschild der Lebensfremdheit nur klirrend in die Ecke zu werfen, um sich ein Monokel vorzuklemmen — und schon ist aus dem Schlechtweggekommenen ein Dandy geworden, der das Leben mit Ueberlegen- heit meistert. Und hier durchschauen wir vielleicht das Rätsel des Monokels. Der Mensch nämlich, der es sich einklemmt, hat vor allem eines im Auge zu behalten: daß er es im Auge behält, und daher wahrt sein Antlitz eine maskenhafte Starre, die sich höchstens in ironischen Mundwinkeln regt: monocle oblige! Aber die Rückwirkung des Monokels auf seinen Träger bleibt nicht bei den Gesichtsfalten stehen, sondern geht tiefer. Es liegt hier ein organisches Gesetz vor, das ich erläutern will. Die Gewöhnung an den Zusammenhang von Ursache und Wirkung ist nämlich bei den höheren Lebewesen so ausgeprägt, daß sie vielen Wirkungen, die von außen her kommen, eine innere Ursache unwillkürlich nachliefern. Kraule einen Hund an den Rippen, und er stellt dieser Wirkung mit kraftlosen Pfotenzuckungen automatisch die Ursache bei. Reiße als Schauspieler rollengemäß die Augen weit auf — und alsbald packt deine Seele jenes Entsetzen, das diese Miene eigentlich ausdrückt. Also wirkt auch das Monokel: klemme es dir mit hochgezogenem Mundwinkel ins Auge, und dein Gesicht erstarrt zu jener stoischen Maske, welcher du nicht umhin kannst, auch die dazugehörige stoische Gemütsverfassung beizustellen. Mit der Brille auf der Nase kann ein Mensch noch ganz gut betteln, Schuhe flicken oder ein Gebet sprechen. Kann man dagegen, das Einglas im Auge, glühende Worte stammeln? In Tränen zerfließen? Einen Wutausbruch haben? — Nein, man kann es nicht, denn entweder verliert man dabei sein Monokel, oder man „verliert sein Gesicht”, wie der Chinese so treffend sagt. Und somit bilden diese paar Gramm Glas ein stärkeres Gegengewicht zur menschlichen Hemmungslosigkeit als vielleicht ganze Waggonladungen von Vorschriften. Das Monokel ist ein pädagogischer Seelen- bildner.
Dabei genießt das Monokel einen Respekt, der sich von dem Glas unwillkürlich auf die Person überträgt. Allein, damit übernimmt diese Person die Verpflichtung der Persönlichkeit: das Einglas ist ein Schaufenster, und wehe, wenn der Auslage nicht die innerlich vorrätigen Qualitäten entsprechen, denn ein Monokel und dumm — das erträgt die Welt nicht! Darum sehen wir die künstlerische Darstellung des Monokels seit den achtziger Jahren in die Aeh- äh-Type der Witzblätter entarten, was zwar den Mutbeweis des Monokelaspiranten steigerte, anderseits aber zu der bekannten Erscheinung des verschämten Monokelträgers geführt hat. Dieser ist ein Mensch, der eine brennende Sehnsucht mit einer ebenso brennenden Scham vor seinen Bekannten vereinigt, von denen er ganz gut weiß, daß sie sich weigern würden, sein Einglas ernst zu nehmen. Daher trägt er es in der Westentasche und setzt es lediglich inkognito auf. Das alles konnte jedoch dem berechtigten Zauber des Monokels keinen Abbruch tun. Angefangen von jenem Nero, der sich im Zirkus, wenn die Löwen brüllend auf die Christen einsprangen, sein Einglas interessiert vors Auge klemmte, haben sich bis zu Whistler und Joe Chamberlain stets markante Persönlichkeiten gefunden, die dem Haß des Pincenez gegen das Monokel unbewegten Blickes zu trotzen wagten.
Ich bin also unbedingt für das Monokel und habe nie das Gespöttel verstehen können, mit dem man diese vielleicht nützlichste Verwendung von Glas allzu summarisch bedacht hat. Ja, ich muß gestehen, daß ich Brillenmensch selber schon errötend zum Optiker geschlichen bin, um der Freuden eines Monokeldaseins teilhaft zu werden. Allein, dort stellte sich etwas Schreckliches heraus: ich sah die T elt doppelt. Mein Monokelauge erblickte alles in satirisch geschärften Liliputdimensionen, während sich meinem unbewaffneten Auge die rauhe Außenseite einer ungeschlachten Brobdingnag-Welt darbot. Himmel, dachte ich, soll mein rechtes Auge nicht mehr wissen, was das linke tut? Soll meine linke Pupille in Bewunderung vor einem Stumpfnäschen ersterben, während meine rechte nicht umhin kann, ihm eine schnell wirkende Hautcreme zu empfehlen? Ich hatte die Einheit meiner Weltanschauung verloren, mitten durch mich schnitt ein’glasscharfer Widerspruch: jedes Ding besaß plötzlich ein Einerseits und Anderseits, ein Pro und ein Kontra, an dem meine Wenigkeit entzweizugehen drohte — sollte ich von nun ab stets die verdrießliche Arbeit haben, mir die Wirklichkeit aus rechtem und linkem Auge zusammenzuklauben? Und war diese überlegene Zweiseitigkeit vielleicht das Geheimnis, das den Monokelträger so faszinierend machte? … — „Dann nehmen Sie doch ein Monokei aus Fensterglas”, riet der erfahrene Optiker, „das tun viele Herren … immer besser noch als gar nichts.” Allein, ich verzichtete. So ständig mit der blitzenden Vorspiegelung einer falschen Tatsache im Auge herumzuspazieren, dazu brachte ich nicht den Mut auf. Dahin, vorbei mein Traum von Eleganz! Farewell, Petronius in der Westentasche! Und ich dachte neidisch an einen Bekannten, einen Gentlemanfarmer aus der Neuen Welt, den ich kaltblütig mit dem Monokel hinterm Pflug hatte schreiten sehen — ein gigantischer Anblick, Cincinnatus, aus Cincinnati. Der hatte es gut, der hatte wirklich ein schwaches Auge.
Das Tragen eines Monokels steigert sich jedoch zur heroischen Herausforderung, wenn eine Frau es tut. Und gerade daran wird die überoptische Bedeutung des Monokels evident, denn es ist ja eigentlich nicht einzusehen, warum nicht auch eine Frau Augen von ungleicher Sehschärfe haben sollte. Doch selbst das noch schwindet zu einem Kinderspiel gegen ein Wagnis, von dem ich neulich las — als ich das Blatt vors Auge hielt, wäre mir fast mein Monokel entglitten, wenn ich eines besessen hätte. Es war der Bericht über ein Vorkommnis, das sich jüngst in London abgespielt hat. Dort wurde eine vornehme Hochzeit gefeiert, und eine Volksmenge stand spalierbildend vor dem Kirchenportal versammelt. Endlich rollte das Auto heran, die wunderschöne Braut entstieg ihm … als eine Bewegung durch die Neugierigen ging. Es war aber nicht das übliche „oh lovely!”, das von den Frauen in olchen Fällen geflüstert wird, sondern ein ganz anderes Wort, welches anschwellend immer deutlichere Gestalt gewann, nämlich: „Monocled bride! … monocled bride! … monocled bride!”
In der Tat, sie trug wirklich ein Monokel, die Braut. Es stand ihr keck, aber entzückend. Ob sie sich durch das stoische Einglas auf den stoischen Beruf der Ehe vorbereiten wollte, war vorläufig nicht feststellbar. Der Geistliche traute sich kaum, sie zu trauen. Endlich tat er es aber doch, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch der Bräutigam zuckte mit keiner Wimper.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!